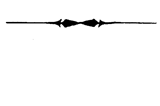|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Als Heinz die Grenze hinter sich hatte und sich nun wirklich in der Fremde wußte, wandte er sich im Wagen um und schaute lange zurück. Seine Gedanken durchmusterten unwillkürlich sein bisheriges Leben, und er sagte sich, daß nicht Alles so gewesen, wie es hätte sein sollen. Wenn er sich so allein fühlte in der Welt, so völlig vereinsamt, so mußte er erkennen, daß er großentheils selbst die Schuld daran trug. Sein Verstand sagte ihm, daß sein Hochmuth, sein Trotz es gewesen waren, die ihm so viel Unangenehmes zugezogen hatten, ihn seiner Familie, seinen Lehrern und Kameraden gegenüber isolirt und ihm das fernere Verweilen in der Heimath zur Qual gemacht hatten; aber er zog daraus keineswegs den Schluß, daß er eben im Hochmuthe seinen schlimmsten Feind habe. »Ist es nicht vielmehr,« fragte er sich, »überhaupt das Loos der Edeln auf Erden, einsam zu leben und allein?« Es ist ein wunderbares Ding, das Menschenherz! Heinz wußte gar wohl, wie unglücklich sein Vater im Grunde gewesen war, und doch trat dessen Bild, das Bild des einsamen und verschlossenen, aber von aller Welt gefürchteten Mannes verlockend vor seine Seele. Freilich, nicht ruhmlos durfte ein solch einsames Leben sein, wie das des Vaters es gewesen war. Wenngleich nicht des Umgangs mit den Lebenden, so doch der Gesellschaft der großen Todten bedurfte auch der Hochgeartete, des Verkehrs mit ihnen, nicht als staunender Bewunderer, sondern als Gleichberechtigter, Ebenbürtiger.
Heinz hatte in Bezug auf seinen künftigen Beruf noch keine Wahl getroffen. Er fühlte einerseits für keine Wissenschaft eine besondere Neigung, andererseits war er fest davon überzeugt, daß, welcher er sich auch zuwenden möge, er doch in jeder Großes leisten würde. So behielt er sich denn einen Entschluß erst für die Universität vor.
Auf Onkel Konrads Rath hatte er eine Hochschule Mitteldeutschlands gewählt und bestieg an einem lauen Sommerabende den Wagen, der ihn von der Eisenbahnstation nach Fischersbach (so wollen wir die kleine Universitätsstadt nennen) bringen sollte. Im Postwagen saß außer ihm nur noch ein alter Herr. Nachdem die Beiden eine Zeit lang geschwiegen und zu den geöffneten Fenstern in die Landschaft hinausgeblickt hatten, wandte sich der alte Mann an Heinz und bat um Feuer für seine Cigarre. Als er dieselbe in Brand gesteckt hatte, fragte er:
»Sie sind wohl Student, mein Herr?«
»Nein, noch nicht,« erwiderte Heinz, »aber ich will einer werden.«
»Sie Glücklicher!«
»Sie scheinen ein großer Freund des Studentenlebens zu sein.«
»Ich? Gewiß. Wer, der studirt hat, sollte das nicht sein! Freuen Sie sich denn nicht auf das Studentenleben?«
»Nein. Ich betrachte es nur als unvermeidliches Uebel, so etwa wie die Masern oder die Confirmation, die man eben durchgemacht haben muß, ehe man ein Erwachsener wird und in der Welt etwas bedeutet.«
»Nun, und Sie freuen sich auf die Zeit, wo Sie in Ihrem Sinne ein Erwachsener sein werden und weltfähig?«
»Gewiß.«
»Aber ist denn die Universität nicht auch eine Welt, zwar eine kleine, aber doch eine unendlich reiche Welt?«
»Pah! Eine Welt in diesem Sinne ist auch die Kinderstube. Lesen Sie Bogumil Goltz, und Sie werden sehen, daß man auch die Kinderstube zu einer Welt aufblasen kann, freilich zu einer Welt, die immer kindisch bleibt.«
Der alte Herr lächelte im Schutze der Dunkelheit, dann sagte er:
»Wenn eine Fee Ihnen verspräche, Sie in ein Land zu führen, in dem alle Menschen, welches auch immer ihr Herkommen und ihre Vermögensverhältnisse seien, ganz gleich geachtet würden, in dem ein Jeder, der Vornehme wie der Geringe, der Reiche wie der Arme, einzig und allein nach seinem inneren Werthe geschätzt wird, in ein Land, dessen Bürger sich sämmtlich nur mit geistigen Dingen beschäftigen, und zwar ganz nach ihrer eigenen Wahl, würden Sie da nicht voll heißer Ungeduld des Augenblicks harren, in dem die gute Fee auf den fernen Saum eines Waldes hinwiese und spräche: ›Da, hinter jenen bläulichen Linien liegt die Grenze?‹«
»Gewiß.«
»Nun, eine solche Welt ist die deutsche Hochschule, solch eine Zauberwelt, wie sie schöner nie in eines Dichters Phantasie entstanden ist. Wo auch des Jünglings Wiege gestanden hat, im Norden oder im Osten, im Westen oder im Süden, ob er in einem Schlosse oder in einem Dorfkirchlein getauft, ob er von Hauslehrern erzogen worden ist oder ob er sich mit Freitischen und Stundengeben durch die Schule gehungert hat, sobald sich die Thore der alma mater für ihn aufgethan haben, ist das Alles vergessen. Wie ein neuer Mensch steht er da. Der Reiche bietet seinen Ueberfluß dar und der Arme scheut sich nicht, davon zu nehmen. Ein trautes ›Du‹ vereinigt den reichsfreien Grafen mit dem Sohne des Dieners oft zu einer Freundschaft für's Leben. Nur ein offener, muthiger Sinn, ein warmes, treues Herz, ein heller Verstand geben da eine gesellschaftliche Stellung. Aber mit Nichten geht Alles friedlich neben einander her, wie eine Heerde Schafe. Es ist ja eine Welt, eine Menschenwelt im Kleinen. Es gilt mancherlei Kämpfe zu bestehen; man streitet mit Worten und Waffen, und Geist und Arm erstarken im Kampfe. Aber auch der Kampf ist hier ein veredelter, idealer; denn der Ehre strenges Gesetz schützt den Gegner vor Tücke und Arglist, sorgt dafür, das Licht und Schatten gleich sei für Beide. Wie sorglos lebt sich's hier, wie fröhlich. Alte Lieder ertönen zu alten Bräuchen, auf welche die Bilder und Schattenrisse aller derer herabsehen, die einst hier gesessen auf diesen einfachen Bänken und die nun, über das ganze Reich zerstreut, in der großen Welt verwenden, was sie hier in der kleinen gelernt haben. Und sie Alle denken mit Liebe an diesen Ort; auch wenn längst schon der Schnee des Alters ihr Haupt bedeckt, erzählen sie dem heranwachsenden Enkel von den fröhlichen Universitätsjahren. Und sie thun recht daran, denn sie haben ja hier nicht nur gelernt, sich mit Menschen zu freuen, ein Mensch zu sein, sondern hier war es ja, wo die Wissenschaft ihnen zum ersten Male erschien, eine ernste, doch freundlich blickende Jungfrau, mit der sie traute Wechselrede führten, sich auf die einstige, innige Gemeinschaft freuend. Sie ist ihnen dann in späterer Zeit eine treue Gefährtin geworden für's Leben; sie hat sie getröstet und aufrecht erhalten in Trübsal, sie beruhigt, wenn die Leidenschaft in ihnen mächtig ward und nicht geduldet, daß sie sich gefielen im öden, unfruchtbaren Verneinen. Kein Wunder, daß sie so gern der Zeit gedenken, in der die erste Bekanntschaft sich knüpfte.«
»Sie sind ein Dichter, mein Herr,« unterbrach ihn Heinz; »aber eben darum sehen Sie Alles rosenroth. Den meisten Menschen ist die Wissenschaft nicht ein geliebtes Weib, sondern, um mit Schiller zu reden, eine milchende Kuh, die sie mit Butter versorgt.«
»Nicht den meisten,« rief der alte Herr heftig. »Nicht den meisten. Sagen Sie einigen. Lassen Sie sich nicht durch den Schein täuschen. Es ist der großen Mehrzahl der Menschen, auch der gebildeten Menschen, nicht gegeben, ihre Tage in bequemer Muße zu verbringen, ward uns doch der Fluch der Arbeit. Aber sehen Sie näher zu und Sie werden finden, daß in weitaus den meisten gebildeten Menschen, mögen sie äußerlich noch so sehr von der Sorge um das tägliche Brod niedergedrückt, noch so sehr mit Actenstaub bedeckt sein, ein idealer Sinn lebt, um dem sie der reichste und mächtigste Mann, der nie der Wissenschaft in's Auge geblickt hat, schmerzlich beneiden könnte. Was ist's denn, was allen diesen Geistlichen, Lehrern, Richtern und Beamten, deren Gehalte oft so karg sind, daß sie kaum hinreichen, einer Familie auch nur einigermaßen ein Leben zu ermöglichen, wie es die Sitte von ihnen verlangt, daß allen diesen Leuten die Freudigkeit, den Stolz des Berufes giebt, als die ideale Liebe zur Wissenschaft? Nehmen Sie dieses Gefühl aus der Brust dieser Männer und sie würden zu elenden Lastthieren oder zu wüsten Schwindlern werden.«
»Haben Sie auch in Fischersbach studirt?« fragte Heinz.
»Ja, ich habe dort die schönsten Jahre meines Lebens verlebt. Lacht mir doch noch jetzt das Herz im Leibe, wenn ich der schwarz-roth-goldenen Farben ansichtig werde.«
»Sie waren Burschenschafter?«
»Ja. Ich habe dafür schwer büßen müssen; ich habe deshalb die besten Jahre meines Lebens in enger Gefängnißzelle verlebt, und doch, wenn ich noch einmal mein Leben beginnen sollte, ich träte gleich wieder in die Burschenschaft, ließe mich gleich wieder einsperren. Es ist auch etwas werth, um seiner Ueberzeugung willen gelitten zu haben.«
»Aber, war denn nicht Alles, was die Burschenschaft wollte, thöricht? Können Sie es denn billigen, daß Studenten die hohe Politik in die Hand nehmen?«
»Nein, gewiß nicht. Vieles war unreif, ja kindisch in unserem Wollen und Thun, aber nichts war schlecht, nichts unedel. Es ging ein großer, idealer Zug durch unser Aller Herzen, wir athmeten immerhin reine, deutsche Luft, deutsche Kaiserluft. Trotzdem haben Sie Recht, es war ganz in der Ordnung, daß man uns einsteckte; nur müssen Sie mir das Recht lassen, mich darüber zu freuen, daß wir Veranlassung gaben, uns einstecken zu lassen.«
Heinz lachte. »Sie sehen die Sache jedenfalls sehr objectiv an.«
»Wie sollte ich nicht; ich bin darüber 30 Jahre älter geworden. Ich kann jetzt selbst nicht ohne Lachen daran denken, wie unklar doch oft unser ganzes Gebühren war. Der helle Mondschein draußen erinnert mich an eine gar seltsame Nacht, in der wir einmal gar wunderliche Dinge trieben.«
»Sind die noch Geheimniß?« fragte Heinz.
»Nein. Wenn es Sie interessirt, will ich Ihnen davon erzählen, wenn ich auch glaube, daß Sie, als Sohn einer andern Zeit, uns schwerlich verstehen werden. – Einige Tage vor jener Nacht, von der ich sprechen will, kam, ich war gerade zweiter Senior, der erste zu mir und fragte mich, nachdem er die Thür verschlossen und zur Sicherheit noch ein Handtuch vor das Schlüsselloch gehängt hatte, mit flüsternder Stimme, ob ich nicht auch der Meinung wäre, daß es Zeit sei, zur Hebung und Befestigung des Patriotismus, zumal in der Brust der jüngeren Commilitonen, wieder einmal ein geheimes Bundesfest mit feierlichen Symbolen zu begehen. Ich war durchaus seiner Meinung, denn es schien mir, als ob unter den Füchsen und Brandern sich mehrfach ein frivoles, leichtsinniges Wesen kundgebe, und ich versprach mir von dem Vorschlage meines Freundes nicht wenig. Auch übte alles Geheimnißvolle auf mich, wie zu unserer Zeit auf die meisten jungen Leute, den größten Reiz aus. Nachdem wir Beide einig geworden waren, zogen wir noch einige der älteren Commilitonen zu und es wurde beschlossen, uns in der Walpurgisnacht auf einem gewissen Berge zu versammeln und daselbst zur Mitternachtsstunde die ganze Burschenschaft wieder einmal feierlich schwören zu lassen, daß sie den Tyrannen ewig feind, dem Vaterlande aber ewig treu und ergeben bleiben wolle. So wurden denn einen Tag vorher alle Burschen, nachdem sie mit einem furchtbaren Eide Verschwiegenheit gelobt hatten (denn wir schworen für unser Leben gern), davon benachrichtigt, daß sie in der nächsten Nacht auf dem und dem Berge zu erscheinen hätten. Die Losung war: ›Brutus.‹ Sie können sich denken, mit welchem Herzklopfen wir den ohnehin steilen Berg hinanstiegen. Brutus, Brutus, tönte es nun von allen Seiten, bis wir Alle zusammen waren und nun um einen großen Stein einen Kreis bildeten. Nun legten wir wiederum einen feierlichen Eid ab, zu dessen Zeugen wir in erster Reihe Hermann den Cherusker, dann aber auch die Geister des Voglers und der großen Hohenstaufen beriefen, und darauf trat der erste Senior auf den Stein und hielt, wie man sich heute zu Tage ausdrücken würde, die Festrede. Er sagte uns, daß es nur an uns läge, wenn das deutsche Reich mit aller seiner kaiserlichen Herrlichkeit noch immer auf sich warten lasse, denn wir hätten uns noch keineswegs in hinreichender Weise vor der Verwelschung, in die Gottes Zorn uns habe verfallen lassen, befreit. Vor Allem sollten wir Einkehr in uns selbst halten, sollten uns fragen, ob wir denn auch wirklich so fromm und rein, so keusch und stark, so edel und züchtig seien, wie es den deutschen Jünglingen gezieme. Ob wir denn auch, jeder Einzelne von uns, es verdient hätten, daß unser Aller Herzenswunsch in Erfüllung gehe, daß wir die Stunde erlebten, da der Aar die Raben verscheuche und der Rothbart erwache. Sehen Sie, das war doch hübsch, daß er so sprach?«
»Ja, gewiß; aber warum das Alles in der Nacht und unter dem Siegel der Verschwiegenheit?«
»Das werden Sie gleich erfahren. Als der Senior seine Rede geschlossen hatte, kam die Reihe an mich. Ich nun faßte meinerseits die äußeren Schwierigkeiten, die der Wiederaufrichtung von Kaiser und Reich entgegenstanden, in's Auge, und fand diese vornehmlich in den Tyrannen. Sie bezeichnete ich als unsere schlimmsten Feinde, bedrohte sie mit unserem größten Zorn und überhäufte sie mit Schmähungen. Zu guter Letzt forderte ich die freien deutschen Jünglinge auf, ihren Tyrannenhaß in symbolischer Weise an den Tag zu legen. Es wurde nun ein Pudel, den wir am Tage zuvor von einem fortziehenden Corpsburschen gekauft hatten, mit verbundenem Kopfe in unseren Kreis geführt, für das Symbol eines Tyrannen erklärt und auf den Stein gesetzt. Dann hieb ihm einer der Burschen, ein riesiger Oldenburger, mit einem Schlage den Kopf ab und nun tauchten wir Alle unsere Schläger in das Blut und schworen, indem wir uns gegenseitig umarmten, in Freiheitsliebe und Tyrannenhaß allezeit und ewig dieselben zu bleiben. Sehen Sie, dabei dachten wir uns durchaus nichts Schlimmes und waren wirklich von den edelsten und besten Gefühlen bewegt. Der Tyrann, als dessen Sinnbild der arme Pudel gefallen, war die ganz abstracte Tyrannei, und es hinderte uns nichts, für unsere respectiven Landesherren die größte Hochachtung und Liebe zu hegen. Ja, ich erinnere mich, daß auf dem Rückwege unser erster Senior, der doch die Anregung zu dem ganzen Unternehmen gegeben hatte, uns den ganzen Weg über von der Vortrefflichkeit und Herablassung des Fürsten von Schaumburg-Lippe, seines Landesherrn, und von den Reizen seiner Tochter, der Prinzessin Marie, unterhielt.«
»Aber aus diesen Kreisen gingen doch Sand und die Frankfurter Attentäter hervor,« warf Heinz ein.
»Das allerdings,« erwiderte der alte Herr; »aber seien Sie überzeugt, daß Sands rasche That in allen burschenschaftlichen Kreisen den größten Unwillen und lebhaftes Erschrecken erregte und auch die Frankfurter Affaire war keineswegs aus den Köpfen der Jugend hervorgegangen, sondern von jenen Leuten angeregt worden, die sehr wohl wußten, daß man keine Spione bezahlt, wenn es Nichts auszuspioniren giebt. Abgesehen von diesen Verirrungen, die immerhin nur selten vorkamen, hat die Burschenschaft doch ihre großen Verdienste, denn aus ihr gingen alljährlich Schaaren von jungen Männern hervor, die an Geist und Körper rein und voll glühender Vaterlandsliebe waren und die, welcher Partei sie sich nachher auch anschließen mochten, stets den Idealen ihrer Jugend treu blieben.«
»Schön,« sagte Heinz, »die Berechtigung der Burschenschaft für jene Zeit zugegeben – was will sie jetzt?«
»Nun, sie will auch jetzt im Wesentlichen dasselbe: sittenreine, edle, vaterlandsliebende Männer will sie erziehen, ein Ziel, das mir wohl des Erstrebens werth zu sein scheint.«
»Ja, aber wozu bedarf es denn dazu einer Verbindung? Kann das nicht Jeder für sich selbst leichter und besser erreichen?«
»Ich könnte Ihnen darauf erwidern, daß es ja immer deutsche Art gewesen ist, daß sich die Berufsgenossen zusammenschlossen zur Zunft, zum Bunde, zum Vereine; aber ich will auf den Gegenstand unseres Gesprächs ein Bild anwenden, das man gewöhnlich als Beweis für die Nothwendigkeit kirchlicher Vereinigung anzuführen pflegt, das aber gar wohl hierher paßt. Ein Pflanzer fragte einmal eine fromme Negerin, wozu sie denn des Kirchenbesuches bedürfe, da doch Gott überall und Jeder eben so gut und ohne alle Unbequemlichkeit sein Gebet in der Einsamkeit verrichten könne. Als Antwort auf seine Frage nahm die Negerin, die sich gerade vor dem Feuer befand, mit der Zange eine im hellsten Roth glühende Kohle aus dem Feuer und legte sie neben sich auf den Boden. In wenigen Augenblicken wurde sie grau und erlosch. Nun, mein Herr, wollen Sie sich der Gefahr aussetzen, daß es Ihnen ergehe wie dieser einzelnen Kohle? Wollen Sie nicht lieber in Gemeinschaft mit Ihren Commilitonen erglühen für Ehre, Reinheit und Vaterland?«
»Pah,« erwiderte Heinz, »die Kohle mag der Gemeinschaft wohl bedürfen, ich gebe es zu, denn sie hat kein eigenes Feuer; aber der Diamant bedarf keiner Gefährten, denn er glänzt in eigenem Lichte.«
»Der Diamant? Ja, aber wehe der Kohle, die sich für einen Diamant hält. Und dann noch eins – der Diamant leuchtet zwar, aber er erwärmt weder Andere, noch sich selbst. – Aber da sind wir ja schon in Fischersbach.«
Der Wagen rumpelte über das schlechte Pflaster, Lichter erglänzten, dann hielt der Kutscher vor dem Gasthofe. Der alte Herr kletterte mühsam aus dem Wagen, dann reichte er Heinz zum Abschiede die Hand, schüttelte sie kräftig und sagte:
»Nun, seien Sie nun Kohle oder Diamant, wenn Sie Lust dazu haben, soll es mich herzlich freuen, Sie bei mir zu sehen. Ich bin der Pfarrer Werde in Lindenruh. Grüß' Sie Gott!«
Mit diesen Worten verschwand der Alte im Schatten der Häuser.