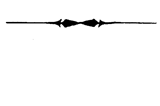|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Eines Tages, es war im December, kam Heinz gegen Abend nach Lindenruh. Der wundervolle Wintertag hatte bereits der Nacht Platz gemacht, aber der blendend weiße Schnee, der den Boden und die Dächer bedeckte und die knorrigen Aeste der Bäume zart verschleierte, erhellte die hereinbrechende Dunkelheit. Der bald volle Mond mußte in kurzer Zeit über der Bergwand hervortreten. Auf der Treppe des Pfarrhauses fand Heinz Anna, die ihn so spät nicht mehr erwartet hatte und im Begriffe war auszugehen. Sie wollte umkehren, aber er bat sie, sich nicht stören zu lassen und erbot sich, sie zu begleiten. So nahm sie denn seinen Arm und sie gingen die Dorfstraße entlang.
»Warst Du heute den ganzen Tag über zu Hause?« fragte Anna.
»Natürlich,« war die Antwort; »wo sollte ich wohl gewesen sein?«
Heinz seufzte und seine Worte klangen gepreßt.
»Du hättest nicht allen Verkehr abbrechen sollen, Heinz; Du hättest den Umgang mit einigen Professorenfamilien beibehalten sollen,« meinte Anna.
»Thorheit,« erwiderte Heinz. »Das hätte nur Zeit gekostet und für mich ist jede Stunde von unersetzlichem Werthe.«
Heinz seufzte wieder, Anna drückte zärtlich seinen Arm.
»Du mußt Dich mehr schonen,« sagte sie; »Du traust Dir zu viel zu, es fehlt Dir an Zerstreuung.«
»Pah! Ich bin nicht so schwach, wie Du glaubst. Aber selbst angenommen, ich hätte das Bedürfniß nach Zerstreuung, wie sollte ich sie mir in Fischersbach schaffen? Soll ich mit den Herren Professoren stundenlang darüber verhandeln, ob die Oesterreicher siegen werden oder die Franzosen, und mit ihren Weibern und Töchtern Stadtklatsch treiben? Ist das Zerstreuung?«
Sie gingen schweigend weiter. Der Schnee knirschte unter ihren Füßen, von Zeit zu Zeit fielen handgroße Flocken von den Aesten der Bäume herab. Wäre der Mond schon hier unten sichtbar gewesen, so hätte Heinz vielleicht die Thränen in Anna's Augen bemerkt, so aber fuhr er nach einer Weile fort:
»Das Leben in solch einem Nest ist unerträglich.«
»Du mußt nach Berlin gehen, Heinz,« meinte Anna. »Du wirst dort mehr Anregung finden. Hier in dem kleinen Orte verkümmerst Du.«
Ihre Stimme klang ganz ruhig, als sie das sagte.
»Meinst Du, Anna? Meinst Du das wirklich?«
»Ja, Heinz. Eine rechte Ausbildung kann man auf einer einzigen und noch dazu einer kleinen Universität doch schwerlich erhalten.«
»Ja, da hast Du allerdings Recht!«
»Nicht wahr, Heinz? Und siehst Du, bei der Gelegenheit lernst Du ein neues Stück von Deutschland kennen. Du wirst dort neue, interessante Bekanntschaften machen, wirst von allen Seiten neue Anregung empfangen.«
»Und Du, Anna?«
»Nun, ich werde hier bleiben, aber im Geiste werde ich Dich allezeit begleiten. Du wirst mir fleißig schreiben und ich werde Dich gern dort wissen, wo es Dir gefällt. Du mußt bei Deinen Entschlüssen überhaupt nicht an mich denken; was Dir lieb ist, ist mir recht.«
Der Mond war aufgegangen und erleuchtete das Thal. Heinz ging so rasch, daß Anna ihm kaum folgen konnte.
»Wohin gehen wir?« fragte er plötzlich. »Wohin gehen wir?« wiederholte er, als Anna nicht gleich antwortete. Es schien ihm daran zu liegen, einen Gedanken los zu werden.
»Zur Frau des grünen Konrad,« erwiderte Anna. »Die arme Frau hat sich beim Schnitzen mit dem Messer die Hand verletzt. Ach, Heinz, was herrscht dort für Elend!«
»Der Mann ist noch immer nicht wieder eingefangen?«
»Nein, die Gendarmen sind ihm oft dicht auf der Ferse gewesen, aber bisher ist es ihm immer noch gelungen, sich ihrer Verfolgung zu entziehen.«
»Es ist wunderbar, daß er hier in der Gegend bleibt. Man sollte meinen, er hätte längst nach Amerika entkommen können.«
Das Dorf war hier zu Ende und der Weg begann steil anzusteigen. Die Hütte des grünen Konrad lag wohl eine Viertelstunde vom Dorfe, fast unmittelbar am Walde. Drinnen schien Alles dunkel zu sein, man sah von außen kein Licht.
Als Heinz an's Fenster klopfte, wurde die Thür geöffnet.
»Ach, Sie sind es, gnädige Frau!« hörte man rufen, dann flammte ein Streichhölzchen auf und eine junge Frau zündete ein Licht an. Die Frau war ursprünglich hübsch gewesen, aber Noth und Sorge hatten ihre Züge abgezehrt, nur ihr blondes Haar war reich und voll geblieben. Das Zimmer war kalt, fast ohne Hausrath. In einer Ecke stand eine jämmerliche Bettstelle und auf dem Strohsacke darin lagen, kaum bedeckt, vier Kinder, eines kleiner als das andere. Die andere Ecke nahm eine Hobelbank ein und vor dem Fenster stand ein roh gezimmerter, sehr niedriger Tisch, auf dem ein paar Messer und allerlei angefangenes Schnitzwerk lagen. Am Tische standen ein paar plumpe Stühle.
Anna zog ihre Handschuhe aus, legte die Pelzmütze ab und zwang durch freundliches Zureden die sich sträubende Frau, auf einem der Stühle Platz zu nehmen. Dann wickelte sie den Verband, der die linke Hand derselben umhüllte, sorgfältig los und betrachtete die Wunde aufmerksam.
»Ihr könnt zufrieden sein, Margarethe,« sagte sie, »es ist seit gestern wieder besser geworden.«
Sie wusch nun die Wunde sorgfältig aus, legte einen neuen Verband an und sagte dann:
»Warum habt Ihr nicht geheizt, Margareth?«
Die Frau wurde scharlachroth.
»Ich wollte – ich konnte – ich habe,« stotterte sie.
»Ihr thut Unrecht,« sagte Anna sanft. »Ihr wißt sehr wohl, daß ich das Geld nicht für ihn bestimmte, sondern für Euch. Denkt an Eure Kinder, Margareth.«
»Ach, die Kinder sind satt zu Bett gegangen, gnädige Frau.«
»Ich meine es anders, Margareth. Ich meine, Ihr solltet um Eurer Kinder willen an Euch selbst denken. Seht, wie Ihr abgehärmt seid und abgezehrt! Wie lange könnt Ihr es so treiben und was soll aus Jenen (Anna wies auf die schlafenden Kinder hin) werden, wenn Ihr nicht mehr seid?«
Die Frau brach in Thränen aus. »Ach Gott! Ach Gott!« jammerte sie.
»Warum geht er nicht weiter fort?« fragte Anna unwillkürlich ganz leise. »Wenn er hier in den Bergen bleibt, wird er ihnen früher oder später doch in die Hände fallen.«
»Das will er ja auch,« schluchzte Margarethe.
»Nun, und was sagt er?«
»Ach, ich darf ja nicht zu ihm! Als ich hörte, er sei auf und davon, da habe ich mein Letztes nach Fischersbach zum Juden gebracht, denn ich dachte mir, jetzt braucht er vor allen Dingen Geld, und Sie konnte ich dazu nicht darum bitten, das wußte ich wohl. Der Jude gab mir sieben Gulden, mit denen und einem Laibe Brod ging ich hinauf zur Herzogstanne in der Pfaffenschlucht, denn ich dachte mir, daß er sich dort verborgen halte. Wie er mich kommen sieht, wird er kreidebleich und legt die Büchse auf mich an. ›Ach Gott,‹ denke ich, ›jetzt schießt er Dich todt, läuft davon und weiß nicht, daß ich sieben Gulden für ihn habe!‹ Ich greife also in die Tasche und halte das Geld in die Höhe, daß er es sieht und nachher nimmt. Wie er das erblickt, setzt er die Büchse ab und winkt mir, ich solle kommen. Wie ich bei ihm bin, herrscht er mich an. ›Was willst Du hier, was läufst Du mir nach?‹ ›Ich bringe Dir sieben Gulden,‹ sag' ich, ›und einen Laib Brod. Mehr habe ich nicht.‹ Da spricht er kein Wort und dreht sich um. Ich mein', er will's nicht nehmen, fass' ihn also an die Hand und sag: ›Nimm's nur, ich helf' mir schon durch.‹ Da faßt er mich an die Kehle. Herr Gott, wie schrecklich sah er aus, gnädige Frau! ›Wenn Du noch einmal hier heraufkommst,‹ sagt er, ›so schlage ich Dir den Schädel ein! Verstanden? So, und nun mach', daß Du fortkommst!‹ Ich lief davon. Ich hatte eine Seelenangst, daß er mir nicht nachläuft, denn ich dachte nur immer an das Geld, das ich auf das Moos geworfen hatte, und fürchtete, er würde es mir wieder aufdringen, aber er hat's behalten. Seitdem getraue ich mir nicht mehr hinaufzugehen, wenn er da ist, und wenn ich ihm was bringen kann, schleiche ich mich Nachts hinauf, wenn er im Walde pirscht und lege es ihm neben die Herzogstanne.«
»Und Du bist in der gestrigen Nacht trotz Deiner kranken Hand auch wieder oben gewesen?«
»Verzeihen Sie mir, gnädige Frau; aber sollte ich essen, während er hungert? Die Kinder aber sind alle ganz ordentlich satt geworden.«
Heinz betrachtete die Frau voll Verwunderung.
»Seid Ihr lange verheirathet,« fragte er.
»Seit sechs Jahren.«
»Und er war immer ein so wilder Gesell!«
»Wild war er immer; aber daß er einmal so leben müßte, wie der Luchs im Walde, das hätte ich nimmer gedacht.«
»Wie war's, Margarethe,« fragte Anna, »wann fing er an, wieder zu wildern?«
»Ach, gnädige Frau, das hat nicht lange gewährt. Wie er mich heimgeführt hat, da hat er hoch und theuer gelobt, er wolle nie wieder mit der Büchse in den Wald, und Anfangs hat er es auch gelassen. Den ganzen Tag über hat er fleißig geschnitzt, oder den Dompfaffen gepfiffen, und wenn er einmal im Walde war, so war's nach einem Bräutigam, das ist ein Fink mit einem besonders schönen Schlage. Die Zeit über ist er gut und freundlich gewesen und ich hab' keinen Schlag bekommen. Nachher hat er angefangen sich zu langweilen und hat Händel mit mir gesucht. Ich dachte: ›Um zu streiten, müssen Zwei sein, und bleib' ich davon, so wird nichts aus dem Streite.‹ Wie er mich also schmäht, hab' ich ihm kein schlechtes Wort dagegen gegeben. Wie ich mit dem Heini da im achten Monate schwanger war, da ist er zum ersten Male mit einem Rausche heimwärts gekommen, und wie ich ihn bitt', daß er doch um Gotteswillen nicht soll in's Wirthshaus gehen, da stößt er mich vor die Brust, daß ich hinfalle. Nachher hat's ihm leid gethan. Er hat mich auf den Schooß genommen, mir die Wangen gestreichelt und mir gute Worte gegeben. ›Ich will's nicht wieder thun,‹ sagte er und fragte noch ganz ordentlich, ob ich nicht Schmerzen habe. Nun, mir thaten natürlich alle Glieder weh und ich dachte, mein Stündlein sei gekommen, aber ich ließ ihm nichts merken. Nachher ging er nicht wieder in's Wirthshaus, aber so recht gearbeitet hat er auch nicht. Nur die Dompfaffen hat er noch rechtschaffen gelehrt. Ich sehe, wie es ihn umtreibt und frag' ihn: ›Was giebt's, Kuni?‹ ›Nichts giebts,‹ antwortet er, ›das ist eben zum Verzweifeln!‹ Und nach einer Weile: ›Höre, ich muß Abends wieder in den Wald.‹ Wie ich das höre, falle ich vor ihm nieder auf die Kniee. ›Um Gotteswillen,‹ sag' ich, ›thue das nicht.‹ Da lacht er. ›Du sollst einen Rehbraten haben,‹ sagt er und fängt an mit mir zu scharmuzieren. ›Ich will keinen haben,‹ sag' ich. ›Wie soll mir der Rehbraten schmecken, wenn Du ein Nichtsnutz wirst.‹ ›Es ist nicht wegen des Rehbratens,‹ erwidert er mir, ›sondern wegen der Stubenhockerei. Die Schnitzerei ist eine Sach' für Weiber, aber nicht für einen Mann, und was fang' ich mit Dir an? Kann man mit Dir einen Discours führen? Nicht einmal zanken kann man sich mit Dir.‹ ›Daß Gott erbarm',‹ sag' ich, ›wie soll ich mich mit Dir zanken?‹ ›Eben,‹ sagt er. Den Abend ist er fortgegangen und erst am andern Morgen heimgekehrt. Seitdem ist er jede Nacht fortgewesen, bis die Geschichte passirte.«
Anna stand auf. »Arme Frau,« sagte sie, »Gott helfe Euch Euer Kreuz tragen.«
Sie nahm dann das Weib bei Seite und flüsterte leise mit ihr. Heinz beugte sich unterdessen über die Kinder und steckte ein halbes Dutzend Gulden, Alles, was er bei sich hatte, unter ihre Decke. Dann gingen Anna und Heinz.
»Welch' ein wunderbares Weib!« rief Heinz, als sie im Freien waren.
»Ja, die Margareth ist brav,« erwiderte Anna gelassen. Sie schien in dem Verfahren der Frau nichts Besonderes zu sehen.
»Ich darf ihr kein Geld mehr geben,« fuhr sie fort, »sie bringt Alles zu ihm hinauf. Ich will Dir nachher aufschreiben, was Du mir für sie kaufen mußt.«
Als sie, zu Hause angelangt, dem Pfarrer erzählten, wo sie gewesen waren, sagte dieser:
»Der Konrad treibt es immer toller. In der Nacht von vorgestern auf gestern hat er dem Herrn von Eglosstein in Eichenreuth aufgelauert und ihm die Uhr und hundert Gulden geraubt. Sie sollten Abends immer hier bleiben und erst am Morgen zur Stadt gehen, Eichenstamm.«
»Mir kann er nichts rauben,« lachte Heinz; »es sei denn, daß er nach Cigarren verlangt.«
»Denken Sie an Ihre Uhr.«
»Ach so! Freilich, das wäre fatal. Aber nun, er ließe vielleicht mit sich reden.«
Anna hatte ängstlich hingehört. »Bleibe hier,« bat sie.
»Das ist lustig,« rief Heinz. »Du bittest mich, seinetwegen hier zu bleiben und warst doch, als ich kam, im Begriffe, mutterseelenallein in seine Hütte zu gehen.«
»Das ist etwas Anderes, Heinz. Mir wird er nichts thun und Dir würde er auch nichts thun, wenn er wüßte, daß Du zu mir gehörst.«
»Nun, das kann ich ihm ja sagen,« meinte Heinz.
Das leuchtete Anna ein; aber als er um Mitternacht davonging, schärfte sie ihm nochmals ein, bei einem etwaigen Abenteuer sogleich ihren Namen zu nennen.
»Sage nur gleich: Ich komme von Frau Anna.«
Heinz versprach das und ging.
Der Mond stand, vom Thale aus gesehen, bereits hinter dem Berge, aber oben im Walde fiel sein Licht noch durch die entlaubten Aeste, deren Schatten auf der Schneedecke ein dunkles, unheimliches Gewirr bildeten. Es war ganz still im Walde, man hörte nur wie hin und wieder die Schneemassen von den Bäumen herabfielen. Als Heinz sich dem Bache näherte, flog plötzlich ein großer Vogel aus einem der Bäume auf und in weiter Ferne stieß ein Thier einen kläglichen Schrei aus. Heinz fühlte, wie ihm das Blut im Herzen stockte. »Das kommt von dem verwünschten Alleinsein,« dachte er ärgerlich und schüttelte sich. »Ich werde nervös.« Er ging rüstig weiter. Als er über eine Lichtung schritt, wurde ihm plötzlich ein lautes: »Halt!« zugerufen und sein scharfes Auge erkannte, daß drüben am Waldrande ein Mann auf ihn anschlug.
Er blieb stehen.
»Bleibt bewegungslos stehen,« rief der Andere. »Thut Ihr einen Schritt vorwärts, so schieße ich.«
»Ihr seht ja, daß ich mich nicht bewege; was soll's?«
»Habt Ihr Geld bei Euch?« hieß es weiter.
»Keinen Pfennig.«
»Wo habt Ihr's gelassen?«
»Bei den Kindern des grünen Konrad.«
»Bei – wem?«
»Bei den Kindern des grünen Konrad.«
Der Mann ließ die Büchse sinken. »Wer seid Ihr?« fragte er.
»Ich heiße Eichenstamm und bin der Bräutigam von Frau Anna.«
Der grüne Konrad kam auf Heinz zu.
»Ich vertraue Euch,« sagte er.
Heinz ergriff seine Hand. »Armer Mann,« rief er, »was hättet Ihr auch von mir zu befürchten!«
»Seid Ihr wirklich bei meinen Kindern gewesen oder sagtet Ihr das nur?« fragte Konrad.
»Nein, ich war wirklich bei ihnen, und zwar erst vor wenigen Stunden.«
»Ach Herr!«
Sein Ausruf klang so schmerzlich, daß Heinz voll Mitleid wieder nach seiner Hand griff.
»Herr! Saht Ihr meine Kleinen? Saht Ihr mein Weib?«
»Ja, Konrad. Ihr thut Unrecht, Mann, daß Ihr Euer Weib so hart behandelt. Sie denkt an nichts, als an Euch.«
»Herr, haltet mich nicht für schlechter als ich bin. Wenn ich nicht dulde, daß sie zu mir in den Wald kommt, so geschieht's um ihretwillen.«
»Wie, um ihretwillen?«
»Ja wohl, Herr. Soll ich dulden, daß sie meinetwegen auch noch eingesperrt wird und die Kinder in's Armenhaus kommen? Ich bin wie eine Wildkatze; wer mich sieht und hat ein Gewehr, der schießt mich nieder. Soll ich meine Frau auch noch so weit bringen? Jetzt, wo sie ruhig zu Hause ist, können sie ihr nichts anhaben; aber wenn sie fortfährt heraufzukommen, so werden die Grünröcke sie einmal beschleichen und dann muß sie in's Zuchthaus.«
»Aber warum sagt Ihr ihr das nicht?«
»Herr, Ihr kennt meine Frau nicht. Wenn ich es duldete, sie käme zu mir herauf und ginge nicht einen Schritt von mir.«
Die Beiden waren langsam über die Lichtung gegangen. Drüben, im Dickichte, lag ein umgestürzter Baum. Auf den setzten sie sich. Der Mond war nicht mehr sichtbar, nur das Schneelicht erhellte spärlich das blattlose Gestrüpp um sie her.
»Warum bleibt Ihr hier, Mann?« fragte Heinz. »Warum sucht Ihr nicht das Weite? Wie lange könnt Ihr es hier noch treiben, wo Jedermann Euer Gesicht kennt?«
Der grüne Konrad blickte finster vor sich hin. »Ich will fort,« sagte er. »Ihr habt Recht, hier kann ich nicht bleiben. Dazu brauche ich Geld und darum raube ich. Ich will hinüber nach Hamburg und über's Meer.«
»Geht hinüber, Konrad, geht hinüber,« erwiderte Heinz. »Dort könnt Ihr noch einmal ein rechtschaffener Mann werden und Eure Schuld büßen.«
»Ihr meint den Förster, Herr?«
»Ja, Konrad.«
»Da hab' ich keine Schuld, Herr. So wahr Gott lebt, da hab' ich keine Schuld! Er hatte zuerst den Kolben an der Backe; ging mein Schuß eine Sekunde später los, so war ich der Todte.«
»Aber er war in seinem Rechte; er war der Förster, Ihr der Wilddieb.«
Der grüne Konrad lachte grimmig. »Ja, ja, so sagt Ihr Herren, denen die Jagd gehört und der Förster dazu, und Ihr verlangt, wir sollen Euch glauben. Alles habt Ihr unter Euch vertheilt, Alles gehört Euch, die Felder und die Wiesen, die Häuser und das Vieh, und habt uns Armen Alles genommen. Jetzt wollt Ihr uns gar noch die Bäume auf dem Berge, das Wild im Walde, den Fisch im Bache nehmen. Das soll Euch auch noch gehören, was bleibt dann uns?«
»Konrad,« sagte Heinz, »das mag hart sein, daß es so ist und Ihr nichts habt als das Zusehen; aber es ist einmal so von Rechts wegen und Keiner kann es ändern.«
»Meint Ihr? Glaubt Ihr, daß der Herrgott es auch so will? Würde er dann einem Armen die Jagdlust so tief in's Herz pflanzen von Kindesbeinen an? Würde er das? Mich hat's gepackt von frühester Jugend an. Als ich ein Knabe war, der kaum des Vaters Büchse aufheben könnt', hat's mich in den Wald getrieben. Wenn ich einen Rehbock sah, ging es mir kalt durch die Glieder. Nachher hab' ich's selber eingesehen, daß es mein Unglück ist, nicht von wegen des Rechts, sondern von wegen der Gendarmen, und wie ich die Margareth gefreit, da hab' ich einen Eid gethan, daß ich nicht mehr in den Busch will. Hernach aber hab' ich's doch gethan.«
»Kam Euch denn nicht der Gedanke, daß Ihr Euer Weib unglücklich machen mußtet?«
»Der Gedanke, daß ich mich verdarb, ist mir schon gekommen, Herr, und ich hab' die Margareth dazumal lieb gehabt, wie ich sie jetzt wieder lieb', seit ich seh', daß sie zu mir hält wie verhaftet, aber in den Busch bin ich doch gegangen. Seht, Herr! Die sitzende Lebensweise hab' ich partoutement nicht gemocht, und dann wär's vielleicht noch gegangen, wenn die Margareth anders gewesen wäre als sie ist. Seht, sie war immer ein sauberes Weibsbild, aber sie ist wie eine Taube gewesen. Ich war so wild wie ein leimiger Frischgefangener. Fink im dunklen Kasten. Wenn es auf der Kirmeß eine Rauferei gab, hab' ich nimmer gefehlt. Da sollt' ich nun still sitzen und Kukuks schnitzen den ganzen Tag. Wäre nun mein Weib eine resolute Person gewesen und ausfahrisch und hätte aufbegehrt, da wär's vielleicht noch gegangen, aber die hat nur immer still geschwiegen. Da hab' ich sie erst gescholten, daß sie wild werden soll, und hintennach hab' ich sie geschlagen, aber sie war wie ein Lamm. Da hab' ich eine Sehnsucht bekommen nach dem Walde und hab' keinen Menschen sehen mögen und hab' nur gedacht, wie ich loskomm'. Wenn ich nur im Walde wäre und allein und frei. Jetzt hab' ich, was ich gewollt, daß Gott erbarm'! Ich bin allein wie der Luchs und frei wie der Vogel. Herr, das ist schrecklich. Ich weiß nicht, was Ihr seid, aber Ihr lebt unter den Menschen, Ihr sprecht mit ihnen, sie sprechen mit Euch, keinen habt Ihr zu fürchten; wie sollt Ihr wissen, wie es Unsereinem ist? Herr, Alles kann der Mensch ertragen, aber allein zu sein, kann er nicht ertragen.«
In weiter Ferne krächzte ein Rabe. Der Geächtete sprang auf und horchte aufmerksam hin. Nach einiger Zeit krächzte ein zweiter.
»Lebt wohl, Herr,« rief der grüne Konrad und griff zur Büchse, »das sind die Gendarmen!«
»Nicht doch.«
»Gewiß!«
Er drückte Heinz eilig die Hand und sprang flüchtig über die Lichtung. Heinz verfolgte langsam den Weg zur Stadt.
Als er eine Strecke weit gegangen war, schien es ihm, als ob dunkle Gestalten neben ihm herhuschten. Bald darauf wurde ihm wieder ein »Halt!« zugerufen. Es waren Gendarmen. Er mußte sagen, wer er sei, woher er komme, wohin er gehe, ob er Niemand begegnet sei. Er. verneinte die Frage, man ließ ihn ziehen.
Als Heinz in der Stadt ankam, erschien ihm sein Zimmer kalt und frostig.
»Allein und frei!« murmelte er. »Ich habe mir das auch gewünscht; jetzt bin ich fast so allein und frei wie jener Wilddieb.«
Am andern Morgen hörte er von König, daß in derselben Nacht der grüne Konrad von den Gendarmen erschossen worden sei.