
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es ist ein öder Weg durch die Felder Virginiens westwärts bis an die Grenze des Staates Kentucky, dem Lande, wo das Sklaventhum Südamerika's auf dem Culminationspunkt stand und zur höchsten Blüthe ausgebildet war. Nach einem langen Wege durch die vom Kriege zerstampften Gegenden von Shenandoah, welche fast den Anblick endloser Steppen bildeten, gelangt man endlich, die Pässe des Alleghany-Gebirges durchschneidend, in Landstriche, welche der Krieg weniger mitgenommen, und wo die Thätigkeit·der Landbauer noch nicht gänzlich zerstört ist. Stufenweise nimmt die Kultur zu, bis sie jenseits des Sandy-Flusses ihren Höhepunkt erreicht. Dort breiten sich die üppigen Fluren Kentucky's aus, dort findet das Auge die wohlthuende Abwechselung aller Farben, welche die Natur hervorbringt: hier die Indigopflanzung mit ihren gelben Blüthen auf den hohen Stielen, dort die Tabacksfelder mit ihren hochrothen Blüthen, weiter unten die schilfigen, saftig grünen Blätter des Zuckerrohrs, dort bedeckt den Hügel der endlose Teppich einer Baumwollenpflanzung – überall Fruchtbarkeit und Reichthum.
Aber trotz all dieser Schönheiten, trotz dieser Vorzüge vermag der Wanderer nicht zu jenem Entzücken zu gelangen, welches diese paradiesischen Gegenden hervorrufen müßten; denn auf dem ganzen Wege durch die üppigen Fluren, überall empfängt ihn das viehische Geheul der Neger, das Fluchen und das Schwirren der Peitschen unmenschlicher Sklavenvögte, und stets drängt sich ihm der Gedanke auf: »Wieviel blutiger Schweiß, wieviel Martern und Seufzer haben dazu gehört, den unwirthlichen Urwald in diese blühenden Felder zu verwandeln?«
Mitten in dieser paradiesischen Gegend, am Saume eines herrlichen Cedernwaldes, auf einer sanften Anhöhe, die sich vom Ufer des Little Sandy erhebt, da liegt das Wohnbaus des Mannes, der über alle diese Herrlichkeiten, so weit das Auge reicht, zu gebieten hat. Weithin glänzen die hohen Fenster, und die das Sonnenlicht reflektirenden Zinkplatten des Daches blenden fast das Ange. In tiefes Grün versteckt liegen daneben am Fuße des Hügels die Negerhütten.
Das ist Georgesville, eine der vier großen Plantagen, deren beneidenswerther Besitzer Mr. George Cleary ist.
Es ist ein herrlicher Sommernachmittag. Es lächelt der Himmel, und läßt den Donner vergessen, mit dem er sonst in dieser Jahreszeit jeden Moment droht; es lächeln die Auen und lassen nicht ahnen, daß sie mit den Thränen und dem Blute der elendesten Geschöpfe des Erdbodens gedüngt sind; es lächelt der Fluß, der plätschernd sein Wasser dem Norden zuführt, und verräth nicht, wie viel Wehklagen gequälter Menschen an seinen Ufern er vernommen, wieviel Schmach er aus dem Süden mit sich führt. ...
Dies Lächeln der Natur schien eine Ironie in dem Lande, wo viele tausende von Seufzern täglich gen Himmel steigen, und viele tausende gemarterter Sklaven vergebens um Erlösung schreien. Davon empfand jedoch jene junge, schöne Kreolin nichts, die dort soeben aus dem dunklen Grün des Cedernwaldes trat; denn auch sie lächelte, und ihr Auge ruhte mit Befriedigung, wenn auch mit einer Beimischung von Aversion auf den hunderten pflugziehender Neger, die auf dem Moorlande in der Nähe des Waldes arbeiteten und deren Herrin sie war; Dann ging sie leichten Schrittes die Ulmenallee entlang, welche die Anhöhe an der dem Flusse entgegengesetzten Seite hinabführt.
Etwa eine Viertelstunde entfernt lag eine kleine Kolonie, bestehend aus einem ziemlich geräumigen Wohnhause, einigen Wirthschaftsgebäuden und einem Schuppen, der den Sklaven zum Aufenthalt diente. Es war dies die Besitzung des Predigers Bahne, welcher mit der Seelsorge für die Bewohner von Cleary's Besitzungen betraut war. Mr. Cleary, der wohl wußte, einen wie guten Einfluß die christliche Seelsorge auf die Disciplin der Neger übte, hatte deshalb zu diesem Zwecke den Pfarrer in jene Besitzung eingesetzt, und ihm ein bedeutendes Areal Landes zur Verfügung gestellt, um aus demselben sein Einkommen zu gewinnen; was Mr. Payne mit Hülfe von etwa fünfzig Sklaven, die er hielt, bewerkstelligte.
Der Pfarrer war eine wohlbeleibte Persönlichkeit, nahe den Sechzigern. Seine breite glatte Stirn glänzte bis zu dem kahlen Scheitel hinauf von Wohlwollen, und die kleinen, von den dicken rothen Wangen fast ganz versteckten Augen blinzelten so väterlich freundlich, oder drehten sich so fromm ergeben gen Himmel, und sein breiter zu einem ewig wohlwollenden Lächeln gezogener Mund sprach so salbungsvoll und seine anfgepauschten Hände gastikulirten so würdevoll, daß man nicht zweifeln konnte, hier einen Musterprediger in den Sclavendistrikten vor sich zu sehen.
Mr. Payne saß in einer Laube vor seinem Hause an einem Tische. Ihm gegenüber lauschte ein liebliches Mädchen von 9 bis 10 Jahren den Lehren, die seinen wulstigglänzenden Lippen entströmten. Neben ihm am Eingange der Laube stand ein Knabe von etwa 14 Jahren, dessen hellbrauner Teint und ein wenig aufgeworfene Lippen ihn als Mutatten kennzeichneten.
Sein lebhaftes, intelligentes Auge war unverwandt auf den Pfarrer gerichtet; man konnte den Verdruß und Unwillen,· den er empfand, deutlich auf seinem ausdrucksvollen Antlitz lesen, aber wieder lag so viel stille Ergebung, so viel Treue und liebevolle Hingebung in seinem Blick, wenn er denselben auf das Mädchen richtete, daß man leicht abnehmen konnte, daß diesem gegenüber seine Empfindungen andere sein mußten, als die er gegen den wohlwollenden Herrn hegte.
»Es war nicht christlich von Ihnen, Miß Fanny,« setzte der Seelsorger sein Gespräch mit dem aufmerksam lauschenden Kinde fort, »daß Sie für den Nigger baten, den der Aufseher einsperren ließ. Sehen Sie, Miß, es heißt in der heiligen Schrift,« fügte er hinzu, das fleischige Kinn dicht an die weiße Cravatte ziehend und langsam den dicken Zeigefinger seiner Rechten erhebend: »Ihr sollt Euch nicht mischen unter die Heiden und Unreinen!«
»Aber der alte Jerome ist ja kein Heide, sondern ist auch ein Christ, wie ich,« entgegnete das Mädchen unbefangen.
»Das wohl, Miß Fanny,« docirte der Pfarrer, »aber er ist eins Schwarzer, ein Geschöpf, das mehr Thier ist als Mensch, und das vom lieben Gott geschaffen ist, um uns zu dienen, denn es heißt in der heiligen Schrift: »Ihr vom Stamme Ham sollt unterthan und Knechte sein dem Stamme Japhet ewiglich!« – Darum müssen auch die Schwarzen von den Weißen in christlicher Demuth und Ergebung dulden, was über sie verhängt wird. Nun geschah es, daß Jerome als träge und nachlässig befunden wurde; und der Aufseher erhob seine Rechte, auf daß er ihn züchtige, wie es geschrieben steht: »Wehe dem faulen Knecht, die Geißel des Herrn wird ihn züchtigen!« – War es da christlich, ja war es schicklich für eine so vornehme Miß, zu bitten, daß die Hand des Aussehers sich nicht erhebe gegen den trägen und nachlässigen Knecht?« –
Mr. Payne hatte sich durch diese salbungsvolle Rede ein wenig in Extase geredet, und in diesem Zustande pflegte sein Gesicht ein gelbliches Colorit anzunehmen, das namentlich der blanken, umfangreichen Stirn das Ansehen gab, als hätte sie einen öligen Ueberzug erhalten, ein Umstand, der sein patriarchalisches Ansehen und seine priesterliche Würde noch bedeutend hob.
Miß Fanny indessen ließ sich dadurch doch nicht imponiren, sondern erwiderte furchtlos:
»Es war aber doch grausam; denn der Mann war nur von seiner Arbeit gegangen, um seiner alten kranken Mutter einen Trunk Wasser zu reichen.
Mr. Payne neigte sein rundes Haupt auf eine Seite, betrachtete die kleine Widersprechende mit einem namenlos wohlwollenden Blick und öffnete eben seine Lippen, um ihr eine sehr schlagende Stelle der heiligen Schrift zu citiren, da wurde seine Aufmerksamkeit plötzlich auf einen andern Gegenstand gelenkt.
Am Eingang der Laube erschien die Gestalt der Kreolin, welche wir aus dem Cedernwald treten und die Ulmenallee hinabgehen sahen. Sie mochte etwa 26 oder 27 Jahre zählen. Ihre Gestalt war üppig, wie die aller Kreolen, ihr blaues Auge lebhaft und feurig, aber ohne jenen Zug von Schwermuth, den man so häufig an Kreolen beobachtet. Ihre Bewegungen waren ungezwungen, vielleicht etwas zu ungezwungen, und ihrem Anzug und ihrem Benehmen war ein wenig Koketterie leicht anzumuten Sie war für ihre Jahre blühend, und ihre Züge hatten eine gewisse jugendliche Lebendigkeit sich bewahrt.
Mr. Payne erhob sich so schnell von seinem Sitz, als es die Korpulenz seiner Figur und die Würde seines Amtes zuließ.
»Oh, Mrs. Cleary, welch eine große Gnade ist meinem Hause widerfahren ...« sagte er mit einer tiefen Verbeugung und das Lächeln des Wohlwollens geschickt in das der Demuth verwandelnd.
Mrs. Cleary unterbrach ihn:
»Es ist ein schöner Nachmittag, und da nahm ich mir vor, meine Fanny aus der Lection abzuholen,« sagte sie leichthin. – »Wie ich sehe, ist die Lection noch nicht beendet,« fügte sie hinzu. – »Lassen Sie sich nicht stören, Mr. Payne, ich werde derweile ein wenig die Allee hinab spazieren!«
»Oh, keineswegs würde ich mir diesen Verstoß gegen die schöne Pflicht, Ihnen zu dienen, zu Schulden kommen lassen,« versetzte der Pfarrer mit großem Eifer. »Nein, gnädige Frau, die Lection ist beendet, ich gab dem Fräulein Tochter nur noch einige Lehren christlicher Moral. Wäre aber die Lection auch nicht beendet, so würde ich keine Sekunde anstehen, sie zu schließen, um Ihnen das Warten zu ersparen.«
»Oh, ich habe keine Eile,« antwortete sie, die Unterwürfigkeit des Pfarrers wie eine Sache hinnehmend, die sich von selbst versteht; und um diese Erklärung gleich durch eine That zu dokumentiren, nahm sie in der Laube Platz. »Ich werde ein wenig ausruhen. Setzen Sie sich doch, Sir.«
»Sie sind sehr gütig, Mrs. Cleary – mit Ihrer Erlaubniß.«
Er nahm der Dame gegenüber Platz, seine Hände pauschten sich über seinem runden Wamst, und seine kleine Augen ruhten mit unaussprechlicher Sanftmuth auf ihr.
Sie schien das Alles nicht zu bemerken, denn ihre langen Wimpern senkten sich und ihr Blick haftete auf dem Rasen zu ihren Füßen, während sie in Gedanken mit dem Fächer auf den Tisch klopfte.
»Sie sind erschöpft, Ma'am,« hob endlich der Pfarrer an, der sie eine Weile forschend betrachtet hatte. »Der lange Weg – die Hitze ...«
»Nichts davon,« unterbrach ihn die schöne Kreolin abwehrend, die schöngeformte, kleine Hand und den zarten, vollen Arm vorstreckend. – »Nicht erschöpft, Sir; es ist etwas anderes. – Fanny,« wandte sie sich an die Kleine, die sich zärtlich an sie schmiegte, »Du kannst hinausgehen und Dich im Garten von Noddy ein wenig umherfahren lassen. – Vorwärts, Noddy, was stehst Du und gaffst? spanne Dich vor den Wagen und fahre Deine Herrin, aber nimm Dich in Acht, daß Du nicht über einen Stein fährst und Miß Fanny erschreckst.«
Die letzte Bemerkung galt dem Mulattenknaben, der noch immer an den Pfosten lehnte und kein Auge von dem Kinde wandte. Seine Augen leuchteten vor Freude, als er hörte, daß das Mädchen sich von ihm spazieren fahren lassen sollte, und mit einem beinahe triumphirenden Blick sah er den Pfarrer an, als wollte er sagen: »Siehst Du, wir Farbigen sind doch besser als Du sagst, denn mir, mir vertraut man dies Kleinod von einem Mädchen an, ich darf es begleitete und beschützen ...«
Fanny sprang zur Laube hinaus, ergriff mit kindlicher Harmlosigkeit des Knaben Hand und zog ihn hüpfend mit sich fort.
»Komm, komm, lieber Noddy, laß uns fahren, Du kannst so hübsch schnell laufen, ach, es ist herrlich, hier herumzufahren ...«
»Miß Fanny!« ward in diesem Augenblick eine Stimme laut in der Nähe der Laube, so klanglos und hölzern, als käme sie aus einem zerbrochenen Topfe – »Schickt es sich für eine junge Dame Ihres Standes, einem Nigger an die Hand zu fassen?«
Der Vorwurf kam von der Bonne des Kindes, einer Dame in bereits gesetzten Jahren mit sehr steifem Rücken, sehr abstraktem Busen, sehr knöchernen Fingern, sehr gelber Hautfarbe und Gesichtszügen, so unbeweglich, als wäre ihr Gesicht aus einem sehr zähen Material fabricirt.
»Ah, Mrs. Cleary!« fügte die trockene Dame hinzu, als sie sich der Laube genähert hatte, und machte eine Verbeugung nach den besten Regeln der Kunst.
»Sie haben recht, wertheste Miß Snobbs,« bemerkte der Pfarrer, als er gewahrte, daß die Herrin wieder gänzlich mit ihren Gedanken beschäftigt war, – »man kann dem Kinde nicht genug einschärfen, daß diese schwarzen Halbmenschen auf einer unendlich niedrigeren Stufe stehen als sie. – Sollte ich darin nicht auch die Ansicht der gnädigen Frau getroffen haben ...« fügte er hinzu mit dem gewinnendsten Lächeln, das ihm nur zu Gebote stand.
Mrs. Cleary antwortete gar nicht auf diese Frage, als ob sie mit ihren Gedanken einen ganz andern Weg verfolgt hätte, fuhr sie plötzlich auf:
»Miß Snobbs haben Sie Acht, daß Fanny nicht Schaden hat.«
Miß Snobbs verstand den Wink und entfernte sich.
Als sie mit Mr. Payne allein war, sah sie diesen mit ihren großen blauen Augen eine Weile forschend an, sie schien sprechen zu wollen, allein nachdem sie eine Weile gezaudert, gab sie den Vorsatz auf und blickte wieder vor sich nieder.
Mr. Payne sah unbeschreiblich wohlwollend aus. Er schien unsicher, ob er das Schweigen brechen solle oder nicht, sein kleines, stechendes Auge indessen las in der Seele der schönen Frau, die ihm vis-à-vis saß. – Nach einer Weile begann er mit heuchlerischem Lächeln:
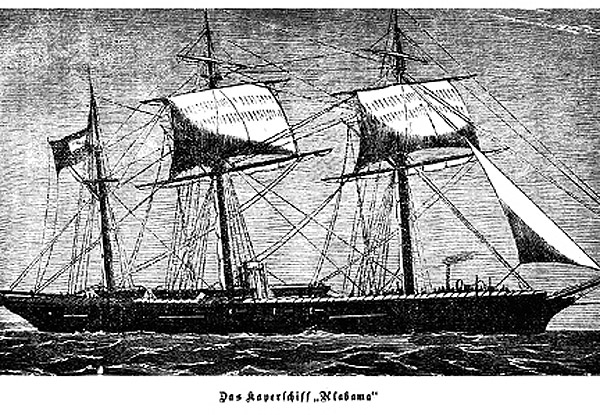
»Wenn die gnädige Frau nicht erschöpft sind, so sind Sie ohne Zweifel verstimmt oder gar betrübt. Es steht aber geschrieben: Selig seid Ihr mit Trübsal Beladenen, denn Ihr sollt getröstet werden.«
»Da haben Sie's getroffen,« sagte die Dame lebhaft emporfahrend. »Ich bin verstimmt, betrübt.«
»Ohne Zweifel hat es Sie alterirt, daß der Bube ...« er deutete auf Noddy, der eben mit seiner jungen Herrin im Galopp vorbeisauste.
»Nicht der Bube,« unterbrach sie ihn, »was kümmert er mich.«
»Freilich, freilich,« versetzte der Pfarrer, seine fetten Augenlieder so zusammenkneifend, daß man das pfiffige Blinzeln derselben nicht bemerken konnte. – »Sie kümmern sich weniger um den Buben, als Ihr Herr Gemahl, der ihn ganz zu seinem Liebling macht. Verdient es auch – denn er hat Kopf. Seit er von Mr. Cleary die Erlaubniß erhalten, dem Unterricht zuzuhören, hat der Junge Fortschritte gemacht, wie ich sie nie bei einem Schüler bemerkt. Sehr edel von Mr. Cleary, wahrlich sehr edel, einem, Nigger eine gewisse Bildung angedeihen zu lassen!«
Mrs. Cleary hatte ihm mit Aufmerksamkeit zugehört, ihre Stirn hatte sich allmählig verfinstert, und aus den braunen Augen blitzten Flammen des Zornes.
Mr. Payne schien das gar nicht zu bemerken und in demselben Tone des herzlichsten Wohlwollens fuhr er fort:
»Der Bube besitzt auch eine Anhänglichkeit an seinen Herrn – natürlich bloße Dankbarkeit, daß er von ihm aus dem Koth der Niggerhütten gezogen und wie ein eigenes Kind bevorzugt wird – aber es ist eine Anhänglichkeit, die nicht inniger sein könnte, wenn ihn natürliche Bande des Blutes an seinen Herrn fesselten.«
Der Funke, den er in das Herz der jungen Frau geworfen, hatte gezündet. Sie richtete sich hoch auf und sah ihn mit durchbohrenden Blicken an:
»Wollen Sie sagen, Sir, daß Noddy sein Kind wäre?«
»O, behüte mich der allgütige Himmel vor solchem Frevel!« schwor Mr. Payne, die Hände an die Brust drückend und die Augen nach der Decke der Laube emporrichtend. »O, daß ich so unglücklich sein mußte, durch meine harmlose Bemerkung solchen Argwohn in ihrem Herzen zu wecken ...«
»Beruhigen Sie sich,« unterbrach ihn die Kreolin. »Ich weiß, daß mein Mann mir untreu ist, ich weiß, daß er mit seinen Freunden im Ritterhause zu Richmond Orgien feiert, wie sie in Ninive und Sodom nicht ärger gewesen sein können, ich glaube auch, daß Noddy sein Kind ist – was folgt daraus?«
»O, Ma'am, nähren Sie nicht diesen Wurm in Ihrem Herzen, denn es steht geschrieben im Buche Hiob ...«
»Verschonen Sie mich mit dem, was im Buche Hiob geschrieben steht – sprechen wir davon, was hier geschrieben steht« – sie drückte die Hand auf ihr Herz, – »und hier steht geschrieben, daß ich meinen Mann nicht liebe.«
Mr. Payne fuhr mit gut nachgeahmtem Entsetzen zurück. Dann nahm er aber wieder die Miene des innigsten Wohlwollens an, und seiner Stirne die äußerste Potenz von Mitgefühl verleihend, während er zugleich verstohlen die Angeredete scharf beobachtete, sagte er:
»Ach, ein Leben ohne Liebe, das muß für ein so gefühlvolles Herz, wie das Ihrige, Mrs. Cleary, eine traurige Einöde sein – und ein Frevel ist's von dem, der solches verschuldet, der nicht anerkennt, welche Gnade Gott ihm verliehen, als er ihm Ihre Liebe zuwendete. – Ihr Herz gleicht jetzt der Wüste, in welcher der Versucher sich dem Herrn nahte, wie geschrieben steht – und das menschliche Herz ist so schwach ...«
Mrs. Cleary ließ ihn nicht weiter reden, sie hatte aus seine frommen Ergüsse gar nicht geachtet, und sagte plötzlich abbrechend:
»Wer war der junge Mann, mit dem Sie gestern nach Georgesville kamen?«
Ein diabolisches Lächeln flog über die Züge des frommen Mannes. Also seine Ahnung hatte ihn nicht betrogen.
»Der junge Mann war der berühmte Schauspieler Wilkes Booth, der Ihren Herrn Gemahl zu sprechen wünschte, welchen er in Richmond kennen lernte,« antwortete er zuvorkommend.
»Ein Verwandter von Ihnen?«
»Nein, Ma'am. Er kam nur, um mich nach dem Aufenthalt meines Sohnes Robert zu fragen, den er aussuchen will, um ihn für ein Unternehmen zu engagiren.«
»Was ist das für ein Unternehmen?«
»Ja – das ist eigentlich ein Geheimniß. – Doch, gnädige Frau, ich darf Ihnen keine Frage unbeantwortet lassen. – Der kühne junge Mann hat es übernommen, auf eigene Hand die Conföderation von der Tyrannei des Nordens zu befreien.«
Mrs. Cleary hörte ihm mit athemloser Aufmerksamkeit zu. Nach einer Pause sagte sie:
»Ich sah ihn gestern von Weitem und eine Ahnung sagte mir, daß er kein gewöhnlicher Mann sei. Ich bin neugierig, ihn kennen zu lernen – oder ist er schon abgereist?« fügte sie hinzu einen Blick auf Mr. Payne werfend, als wollte sie die Antwort von seiner öligen Stirn lesen.
»Noch nicht,« antwortete der Gefragte. – »Doch da kommt er eben selbst. – Darf ich mir erlauben, Ihnen meinen jungen Freund, Mr. Wilkes Booth, vorzustellen? ... Mrs. Cleary, Sir.«
Die Dame erwiederte die grazieuse Verbeugung des jungen Mannes mit herablassender Freundlichkeit. Ein Wink ihrer schönen Hand lud ihn zum Sitzen ein.
Ihr großes, ausdrucksvolles Auge ruhte mit Wohlgefallen auf den bleichen, edlen Zügen des Jünglings. Sie merkte, daß Ihre Pulse heftiger schlugen und ihr Busen stürmischer wogte, je länger sie ihn betrachtete.
Booth seinerseits fühlte die feurigen Blicke der schönen Kreolin bis tief in sein Inneres dringen, aber stets tactvoll und sicher in seinem Benehmen, ließ er keine Spur von Befangenheit merken, sondern mit fester Stimme und ruhigem Ernst beantwortete er die Fragen der Dame, welche sich auf seine Person, den Zweck seiner Reise, die Bekanntschaft mit ihrem Gemahl und anderes dergleichen bezogen.
Die feine Bildung und der edle Anstand des Jünglings imponirten der Dame sicherlich ebenso wie seine körperlichen Vorzüge. Obwohl er die Fragen, die seine politische Mission betrafen, mit bescheidener Zurückhaltung beantwortete, so konnte sie doch nicht umhin, von seinem Enthusiasmus, seiner kühnen Entschlossenheit und seiner Willensstärke überzeugt zu sein. Sie empfand etwas für ihn, was sie nie für einen Mann empfunden hatte – Bewunderung.
»Wohin führt Sie zunächst Ihr Weg?« setzte sie das Gespräch fort.
»Direct nach Washington.«
»Wann werden Sie abreisen?«
»Ich wäre schon heute abgereist, wäre es mir gestern gelungen, Mr. Cleary anzutreffen. Da ich höre, daß derselbe in spätestens zwei bis drei Tagen erwartet wird, so habe ich meine Abreise so lange hinausgeschoben.«
»Ein Aufschub, der Ihnen ohne Zweifel sehr unangenehm ist,« bemerkte Mrs. Cleary mit einem erwartungsvollen Blick.
»Unangenehm war,« versetzte Booth verbindlich, Jetzt ist er's nicht mehr, da er mir das Glück verschafft hat, von Ihnen, Ma'am, zu lernen, daß es einen Platz in der Brust des Mannes giebt, den der Patriotismus allein nicht auszufüllen vermag.«
Mrs. Cleary nahm das Geständniß mit sichtlicher Befriedigung hin. Sie wußte jetzt, daß auch sie einen Eindruck auf ihn gemacht hatte.
Mr. Payne hatte sich bei der Unterredung völlig indifferent gehalten und hatte anscheinend seine ganze Aufmerksamkeit darauf verwandt, zuzuschauen, wie in den Kieswegen des Gartens Noddy seine junge Herrin umherfuhr, in der That aber war seiner scharfen Beobachtung kein Wort des Gespräches entgangen, das auf die Empfindungen des einen oder des andern Theils schließen ließ. Den gegenwärtigen Zeitpunkt hielt er für passend, die Dame zu bitten, ihn zu beurlauben, damit er nach den Kindern sehen könne, da die Banne unmöglich im Stande sei, dem Wagen so schnell zu folgen.
Die Erlaubniß wurde ihm sehr gnädig ertheilt.
Noddy, als Zugpferd in den Wagen gespannt, hatte indessen in der schwülen, durch kein Lüftchen gekühlten Abendluft seine Kräfte bis zur Erschöpfung aufgewandt, und immer noch forderte das wilde, fröhliche Kind neue Anstrengungen von ihm.
»Weiter, Noddy, weiter!« rief Fanny.
Allein es war vergebens, der Knabe sank in die Knie.
»Nun, so fahre doch,« rief die Banne ihm zu, die mit dem Pfarrer im Gespräch auf einer Bank in der Nähe saß.
»Nur ein wenig lassen Sie mich ausruhen, Ma'am,« bat der Knabe. »Ich bin so erschöpft.«
»Erschöpft?« rief die Banne mit Entrüstung. »Ein Nigger und erschöpft! – Wer fragt denn nach der Ermüdung eines solchen Wesens!«
»Sie haben unstreitig recht,« wandte sich Mr. Payne an die vertrocknete Dame. »Aber ich bin überzeugt, daß er im Stande ist für das Kind zu sterben, und daß er laufen würde, wenn er könnte. Seine Hingebung für das Kind ist eine unbegrenzte, ebenso ist seine schnelle Auffassungsgabe erstaunlich; beides natürlich rein instinktmäßig, wie könnte es bei diesen Thiermenschen auch anders sein, gerade wie man die Hingebung und das Anpassungsvermögen bei gewissen Hunderacen findet. In der That ist es mir, wenn ich den schwarzen Buben unterrichte, nicht anders als sei er ein Hund von großer Gelehrigkeit.«
Ein paar bittere Thränen drängten sich in Noddy's Augen, dem kein Wart von dem entgangen war, was Mr. Payne gesprochen. Daß der Sklavenvogt ihn für nichts Besseres als ein Thier hielt, das hatte er verschmerzt, daß aber auch sein Lehrer, und nach dazu ein Diener der christlichen Kirche, dasselbe sagte, und seine theure Fanny lehrte, ihn für nichts Besseres zu halten, das schmerzte ihn tief.
»Nun die Hunde sind ja gute Thiere,« murmelte er vor sich hin. »Und bin ich nichts Besseres als ein Hund, so will ich doch Fanny der treueste und ergebenste Hund sein, der je zu finden.«
Länger ließ sich die Ungeduld des Kindes nicht mehr zügeln.
»Lauf doch wieder, lieber Noddy,« bat sie. »Jetzt hast Du Dich wohl lange genug erholt.«
Da sah er mit wehmüthiger Freundlichkeit sich um nach dem in seiner Ungeduld so lieblichen Kinde.
»Ja, Fanny, ich will laufen,« sagte er. – »Ich bin ja nur geboren, um über Dich zu wachen – für Dich zu sterben! – Dein treuer Hund zu sein!«
Er lief und immer kürzer und röchelnder wurde sein Athem. Die Wolle seines Kopfes triefte von Schweiß – da ergoß sich ein Blutstrom sprudelnd ihm aus Mund und Nase – und keuchend sank er zur Erde nieder.
Fanny wiederholte noch einmal: »Lauf doch, Noddy,« da aber sah sie ihn in seinem Blute, und mit einem Satz sprang sie aus dem Wagen.
»Er ist todt! – mein Noddy ist todt!« schrie sie und stürzte sich auf den bewußtlosen Knaben.
Als der Pastor und die Bonne auf das Geschrei herbeieilten, war Noddy bereits wieder zu sich gekommen und blickte Fanny mit unbeschreiblich liebevollem Gesicht an, das Mädchen kniete neben ihm und ihre Kleider waren von seinem Blute fast bedeckt.
»Miß Fanny!« rief die Bonne in vorwurfsvollem Tone, »Schickt sich das? – Stehen Sie auf!«
»Ach, er blutet, weil ich ihn so trieb zu laufen!« jammerte das Kind. »Er blutet um meinetwillen!«
»Oh, darüber machen Sie sich keine Sorge,« belehrte sie der Geistliche. »Was ist es denn weiter? vergessen Sie nicht, es ist ja nur ein Nigger. Stehen Sie auf, Miß Fanny, lassen Sie sich von Ihrer Bonne hineinführen und durch meine Haushälterin Ihre Kleider vom Blute reinigen.
Fanny gehorchte schweigend, ohne noch einen Blick auf den Knaben zu werfen, der sich mit heißen Thränen das Blut von den Wangen wusch.
»Schäme Dich,« wandte sich der Geistliche an ihn. »Schäme Dich, wegen des kleinen Falles zu weinen; Du verdientest die härteste Züchtigung, daß Du die zarten Nerven Deiner jungen Gebieterin auf diese Weise alterirst. – Gleich fort, Niggerbube, wasche Dir das Gesicht und nimm Dich in Acht, wieder Thränen sehen zu lassen!«
Er hatte diese milde Zurechtweisung, die mit dem ganzen Wohlwollen seines christlichen Berufes gegeben wurde, kaum vollendet, als er bemerkte, daß Mrs. Cleary ihr Gespräch mit Booth zu beenden im Begriff stand und sich erhob, und er hielt es für seine Pflicht, seinen Urlaub nicht weiter auszudehnen, sondern sich nunmehr wieder an der Conversation zu betheiligen.
Die Hände auf dem Wanst übereinander gelegt, den bombenförmigen Kopf ein wenig zur Seite geneigt, näherte er sich langsamen Schrittes der Laube mit einem Wohlwollen in seinen Zügen, das wahrhaft herzgewinnend war.
Noch ehe Mrs. Cleary ihn bemerkte, hörte er sie die Worte sagen:
»Wenn mein Gemahl noch nicht bis dahin zurückkehrt, so sehen wir uns morgen wieder. Sollte indessen dies das letzte Wort sein, so nehmen Sie die Versicherung, Mr. Booth, daß meine Wünsche und Gedanken Sie auf Ihren gefahrvollen Wegen begleiten werden, und daß ich nie aufhören werde, den Himmel anzuflehen, daß er ihrer hohen Mission Gelingen und Ihren Thaten seinen Segen zu Theil werde lasse!«
»Amen!« fügte mit großer Feierlichkeit der Geistliche hinzu.
»Miß Cleary,« rief Booth, »Ihre Worte sind die schönste Weihe für mich. Sie haben mich eben, da ich den Fuß auf die gefahrvolle Bahn zu setzen im Begriff stehe, gelehrt, daß es noch etwas schöneres giebt, als für das Vaterland zu sterben, und einen höheren Lohn als das Bewußtsein, eine große That vollbracht zu haben.
Mrs. Cleary reichte ihm ihre Hand, diese Hand, so schön als hätte sie ein Skopas oder Polyclet gemeißelt. Booth drückte dieselbe mit Begeisterung an seine Lippen.
»Mr. Payne,« sagte sie im Gehen, »wenn mein Gemahl bis morgen nicht zurückgekehrt ist, werde ich morgen Nachmittag meine Tochter wieder abholen.«
Noch einen Blick, den die Kreolin zurückwarf, traf das schwärmerische Auge des Jünglings, ehe sie in der Ulmenallee verschwand.
Noddy zog den Wagen, in welchem Fanny saß, vorauf. Mrs. Cleary folgte in weiter Entfernung langsam, gedankenvoll nach.
Als sie in die Nähe des Waldes kamen, vor welchem die Neger arbeiteten, sah sie unter einem Ulmenbaum eine Negerin sitzen, die ihrem Säugling den Ueberfluß der Nahrung ihrer Brust reichte. Ein fünfjähriger schwarzer Bube, dessen Alter an der seiner Brust eingebrannten Jahreszahl erkennbar war, lag neben der Mutter auf dem Grase und verscheuchte mit einem Rohrbüschel seinem Schwesterchen die Muskitos.
Mit einer Miene des Widerwillens blieb die Dame in einiger Entfernung stehen und betrachtete das Weib.
»Sollte wirklich,« dachte sie, »Noddy das Kind meines Mannes sein, das Kind eines solchen Scheusals wie diese Niggerin? – Sollte es möglich sein, daß mein Mann ... Ich kann es kaum glauben – und doch muß es wahr sein, es muß!«
In diesem Augenblick fuhr plötzlich der Vogt auf die Nährende zu und schwang seine Peitsche über ihr. Die erschrockene Sclavin entzog schnell dem Kinde ihre Brust, und als es dieselbe nicht fahren lassen wollte, schrie und sich mit den schwarzen Händchen festhielt, sagte sie mit schmerzlicher Stimme:
»Still, still, mein Kind, Du mußt hungern, sonst werde ich gepeitscht.«
Und schnell, noch ehe die Peitsche des Vogts auf sie niedergefallen war, erhob sie sich, das Kind der Aufsicht des fünfjährigen Knaben überlassend.
Mrs. Cleary stand in der Nähe der Kinder, und ihr Blick schweifte über die Schaar der Negerinnen. War wohl eine darunter, die sie im Verdacht haben konnte? –
Da fühlte sie ihren Fuß berührt. Erschrocken blickte sie hin und sah den kleinen schwarzen Buben, den wahrscheinlich die blitzenden Steine ihrer Schuhschnallen angezogen hatten. Ein Gefühl des Ekels überlief sie, und mehr dies Gefühl, als Grausamkeit und Hartherzigkeit war Schuld, als sie sich zu einer empörenden That verleiten ließ – von ihrem Fußtritt hinweggeschleudert, lag schreiend und blutend der Wärter des kleinen Säuglings am Boden.
Das Kind brach in ein lautes Geschrei aus. In demselben Augenblick aber riß sich Rogue, der Gatte Janita's – so hieß die Negerin – vom Joche los und schneller, als der Sklavenvogt ihm folgen konnte, stand er vor der Herrin. Mit drohendem Gebrüll hob er sein blutendes Kind auf und warf es in fürchterlichem Ingrimm zu Mrs. Cleary's Füßen nieder. Fluchend erhob er seine Fäuste – seine wilden Mienen entstellten ihn, doch ehe er sich noch weitere Vergehen gegen seine Herrin zu Schulden kommen lassen konnte, waren die Vögte herbeigeeilt und trieben ihn mit Peitschenhieben, die sein Fleisch zerrissen, ins Joch zurück.