
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Bei Nacht und Nebel! so lautet die gemessene Order.«
»Welche Grille!« rief der Gefangene unmutig.
»Hat es Ihnen nicht Ihr ganzes Schicksal gepredigt, daß man den Grillen der Erdengötter nicht entgehen kann?« rief der Graf ungeduldig. »Glauben Sie denn, unsereiner sei besser dran als Sie? Wenn Sie mit dem Fürstentum der Gegenwart überworfen sind, so haben Sie ja nun die Zukunft in Ihrer bildenden Hand.«
Er war bei diesen Worten ernst geworden. Unser Freund sah ihn an und trat ans Fenster. Noch lag der Brief seines Mädchens auf dem Tische. Er raffte die Papiere zusammen und steckte sie zu sich. »Ist denn das nicht die Hauptsache?« dachte er, »soll ich um elende Rechenpfennige auf mein bestes Gold verzichten?«
Der Graf war ihm gefolgt und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Reißen Sie mich aus der Unruhe! Geben Sie nach! Ich halte auch etwas auf Ehre, und ich versichere Sie, daß ich mich an Ihrer Stelle keinen Augenblick bedenken würde. Nicht wahr, ich schicke heute abend meinen Wagen? Mit Anbruch der Nacht verlassen Sie die Festung und gehen ungehindert zum Tor hinaus. Im Dorf Asperg treffen Sie den Wagen und können, wenn Sie wollen, sich nach der Solitüde führen lassen, um die große Illumination mit anzuschauen. Kein Hahn wird nach Ihnen krähen. Sie dürfen öffentlich in Stuttgart erscheinen. Sie dürfen ungescheut zu Dalberg gehen. Morgen besuchen Sie ihn. Dann besorgen Sie die übrigen Affären, die zarteste nicht zu vergessen, über Hals und Kopf; denn ich kann Ihnen keinen Tag mehr zugeben. Auch werden Sie dringend erwartet. Und nun zum Kommandanten, daß wir Abrede mit ihm nehmen! Ich bin sehr pressiert.«
»Ich sollte ihn ohnehin etwas fragen, aber – er hat mich ins Zimmer gesprochen.«
»Tut nichts! Kommen Sie! Mein Talisman öffnet alle Schlösser. – Was gibt's denn da? bringen sie einen Toten oder Sterbenden?«
»Aus dem Arrestlokal, scheint es,« rief Heinrich, von einer Ahnung ergriffen. »Sie tragen ihn ins Lazarett.«
Am Fenster stehend, sahen sie, wie einige Soldaten unten eine mit einem Soldatenmantel bedeckte Bahre über den Platz trugen. Eben wollten die beiden Zuschauer das Fenster verlassen, als sie den General mit einigen seiner Offiziere von der entgegengesetzten Seite über den Platz kommen sahen. Er begegnete dem stillen Zuge, die Träger hielten, er hob den Mantel etwas auf, und »Gelt, Kerl, da liegst du jetzt?« hörte man seine tönende Stimme rufen.
Da regte es sich unter dem Mantel, eine Jammergestalt richtete sich halb empor, unserem Freunde nur allzu wohl bekannt, und mit den durchdringenden Tönen einer Brust, die ihre letzten Kräfte erschöpft, rief Christian: »Ja, da lieg' ich! und wer mich so weit gebracht hat, das bist du, Menschenschinder, falscher Spieler, schlechter Kerl!«

Der General, außer sich, erhob den Stock, aber die Offiziere fielen ihm in den Arm, und einer rief: »Exzellenz, es ist ein Sterbender«
»Nur zu!« fuhr der Soldat fort, »jetzt fürchte ich deinen Stock nicht mehr. Brauch' ihn zum letzten Male und erlöse mich von den Schmerzen, die du mir bereitet hast. Aber hören mußt du vorher, was du für ein schlechter Mensch bist. Weißt du nicht mehr, wie du die Würfel mißbraucht und neunzehn geworfen und einen armen Teufel betrogen hast? Kennst du den armen Teufel nicht mehr, der dir in Böhmen davonlief? Jetzt geh' ich dir voran, dahin, wo man Ungrad nicht Grad sein läßt, und lade dich ein, bald nachzukommen. Wart, Heuchler, ob dir deine frommen Flausen dort was helfen werden. Sieh', auf diesen Augenblick hab' ich mich gefreut in jeder qualvollen Minute, die ich dir verdankte. Jetzt hab' ich meine Rache und kann ruhig sterben. Jetzt bist du nicht mehr mein Vorgesetzter, aus ist's mit der Subordination, ich lache dir ins Gesicht –«
Eine rohe Beschimpfung schloß diese sprudelnden Reden des Hasses. Der General, der mit weitgeöffneten Augen und blaurotem Gesichte dagestanden war, wandte sich schnell, aber nach wenigen Schritten tat er einen lauten Schrei und stürzte zu Boden. Alles drängte sich um ihn. Der Platz füllte sich in wenigen Augenblicken mit Menschen, das Gemurmel: »Er ist tot!« durchdrang die Festung.
»Das ändert alles!« rief der Graf. »Packen Sie zusammen, schnell! Ergreifen wir den Augenblick, eh' eine andere Hand das Platzkommando übernimmt und uns Schwierigkeiten macht.« Er rief seinem Bedienten und befahl ihm, die Sachen in den Wagen zu tragen. Heinrich sah und hörte nicht. Der Graf nahm ihn am Arm und führte ihn hinab.
Unten drängte er sich mit ihm durch die bestürzte murmelnde Menge. Der Kommandant lag leblos in den Armen seiner Offiziere; der Arzt kniete neben ihm und versuchte ihm eine Ader zu schlagen. Vergebens, das Blut floß nicht mehr; der Dämon, den er so oft im Zorn heraufbeschworen, hatte ihn ereilt.
Ein paar Schritte von dieser Gruppe standen die Träger mit ihrem Kameraden. Auf einen Wink desselben setzten sie sich in Bewegung und trugen ihn zu der Leiche. Alles wich aus, die Bahre kam dicht neben Heinrich zu halten. Christian erhob sich, auf eine Hand gestützt, mit wunderbarer Kraft; sein Auge sprühte, sein Antlitz war gerötet, er sah aus wie ein Genesener. Mit dem Stolz eines Siegers, der seinen Feind erlegt hat, blickte er auf die Leiche nieder. »Gelt! da liegst du nun auch?« rief er, und mit dem letzten Worte sank er zurück und starb, einen Blick der Befriedigung und des Dankes auf seinen Beschützer werfend.
Der Graf nahm diesen unter dem Arm und führte ihn hinweg. »Jetzt gilt's, zu imponieren,« sagte er. Doch war dies kaum nötig, denn der Posten unter dem Tore war von der allgemeinen Bestürzung mitergriffen. »Immediate Order von Seiner herzoglichen Durchlaucht!« rief der Graf mit barscher Stimme, als der Wachkommandant denn doch die beiden Passanten mit zweifelhaften Blicken musterte. Der Diener war vorausgeflogen und hatte den Siegel aufgestoßen. Der Wagen hielt an der Brücke. Der Graf schob seinen Befreiten hinein, und sie fuhren so rasch als möglich den steilen Weg durch die Außenwerke hinab.
»Ich müßte nicht in der Akademie gewesen sein,« sagte der junge Graf, »wenn ich mich nicht auf solche Pagenstreiche verstünde. Das geht nun eigentlich schnurstracks gegen meine Instruktion, aber ich will schon dafür sorgen, daß es zurecht gelegt wird. Es ist eine wahre Wonne für einen verheirateten Mann, wenn er einen solchen Coup ausführen darf.«
Ein Zug des Ernstes flog wieder über sein feines, blühendes Gesicht. Er ermunterte sich jedoch gleich wieder und rief: »Aber, mein lieber Entführter, warum lassen Sie den Kopf so hängen? was ist Ihnen?«
»Ich habe eine Schicksalsepisode erlebt, die ich nicht so bald aus dem Kopfe bringen werde,« versetzte Heinrich und erzählte ihm zu seiner Rechtfertigung die Geschichte des Schmieds und seiner Söhne.
Der Graf hörte mit großer Teilnahme zu. »Ich beklage solche Verwicklungen,« sagte er nach einem langen Stillschweigen, »und kann mir's wohl denken, daß, wenn oben operiert wird, die Fäden unten oft ganz anders auslaufen. Glauben Sie mir, wenn die Großen wüßten, welche langgedehnten Tragödien oft hinter ihren raschen Federstrichen einherziehen, sie würden sich manchmal besinnen. – Aber weg jetzt mit solchen peinlichen Gedanken. Sehen Sie vorwärts! Eine heitere Zukunft liegt vor Ihnen!«
»Ich muß meinem Gewissen noch mehr Genüge leisten, eh' ich ihrer genießen kann. Da bin ich nun von dem guten Schubart fortgestürzt, ohne nur Abschied nehmen zu können. Es liegt mir schwer auf dem Herzen; ich muß mich dieser leichten Entwicklung meines Schicksals neben dem seinigen schämen. Sie denken menschlich, teurer Graf, und, was oft noch weit mehr ist, Sie haben Einfluß. Können Sie nichts für ihn tun?«
»Wenn ich Ihnen in diesem Augenblick etwas versprechen wollte,« erwiderte der Graf, »so wären es leere Worte. Drum lassen Sie mich schweigen. Ich habe heut eine sehr unangenehme Szene seinetwegen gehabt; ich mußte Serenissimo die Fürstengruft vorlesen. Denken Sie sich die Deklamation!«
»Die Fürstengruft?« rief Heinrich äußerst erstaunt, »wie ist das nur möglich? Es sind keine drei Tage her, daß ich sie entstehen sah.«
»Drum muß man nicht mit Feuer spielen!« – rief der Graf ärgerlich – »und das Sprichwort sagt: Wenn die Kugel aus dem Rohr ist, so ist sie des Teufels. Das Ding soll bereits gedruckt sein, es wird überall rumoren.«
»Und wie benahm sich der Herzog, wenn ich fragen darf?«
»Er hörte es zu Ende, ohne eine Miene zu verziehen, dann sagte er ganz ruhig: Er hat Talente wie ein Engel, aber zur Freiheit ist er noch nicht reif.«
»Ja, das begreif' ich!«
»Das ist der rechte Weg, wenn man von der Festung kommen will! Nein, liebster Freund, an solchem Pulver mag ich mir die Hände nicht verbrennen. Enfin, lassen Sie die Toten und die Verwundeten und die Gefangenen dahinten! Wenn man alles aufladen will, so bleibt man am Ende selber stecken und hat's weder sich noch anderen zu Danke gemacht. Es ist ein schöner Fehler von Ihnen, den Sie aber beizeiten ablegen müssen, daß Sie sich immer ansehen, als ob die ganze Welt Wechsel auf Sie abzugeben hätte. A propos, Ihre Brieftasche ist mir auch für Sie eingehändigt worden. Beinah hätt' ich das vergessen. Sie werden finden, daß nichts daraus weggekommen ist.« – Er steckte sie ihm lächelnd in die Brust und sagte: »Vorwärts! vivat spes, pereat mundus! Jetzt fahren wir gleich zu Dalberg, dem ich Sie vorstellen werde. Dann machen Sie die Festlichkeiten noch ein wenig mit, und –«
»Halt!« rief Heinrich, »ich bin in der äußersten Verlegenheit! Ich habe jenem Toten stillschweigend mein Wort gegeben, nichts Eigenmächtiges zu meiner Befreiung vorzunehmen.«
»Absolvo te!« rief der Graf lachend. »Ich bin ein Kavalier und weiß auch, was ein Ehrenwort ist. War denn Herr von Rieger Ihr Herr über Leben und Tod? Nein, er war nur Festungskommandant, der Sie heut auf Befehl des Herzogs losgelassen hätte. Ich versichere Sie, er hätte Sie gar nicht mehr behalten, er hätte Sie hinausschaffen lassen durch vier Mann mit samt Ihrem zarten Gewissen.«
Heinrich mußte lachen. »Es ist wahr,« sagte er, »auch hat er mir gestern Zimmerarrest angekündigt, und dadurch war ich meines Wortes quitt.«
»Nun, sehen Sie, Mann des Skrupels!«
In weniger als zwei Stunden trabten die scharf ausgreifenden Rosse mit ihnen in Stuttgart ein. Heinrich sah sich etwas befangen um, er war hier fremd geworden. Aber sein lebhafter Begleiter ließ ihm keine Zeit zum Nachdenken. »Sehen Sie,« rief er, während sie die Ludwigsburgerstraße hereinfuhren, »was das rennt und läuft! Eine wahre Völkerwanderung! Wir werden mit Mühe über den großen Graben kommen, obgleich die Nebenstraßen einen guten Teil des Menschenstromes absorbieren. Dort wälzt sich's die Seegasse herauf in die Landschaftsgasse,« sagte er im Weiterfahren, »und hier speit die untere Stadt durch die Schulgasse wie durch einen engen Flaschenhals ihren Inhalt aus. Es ist, als ob die Straßen toll geworden wären und auch mitwollten. Das zieht alles nach der Solitüde.«
Sie steuerten langsam im Strome des Menschengedränges fort, bogen endlich vom großen Graben in den kleinen ein und fuhren am Petersburger Hofe vor, wo Dalberg wohnte. Eben als der Wagen in den Hof rasselte, kam jemand eilig aus dem Gasthaus herausgeschossen. Heinrich sah ihn an, es war Schiller. Dieser blickte ebenfalls auf, da er dem Wagen ausweichen mußte; ein Ausruf der Verwunderung, dann wollte er herzueilen, besann sich aber anders, grüßte lebhaft mit der Hand und schoß vorbei. »Der pressiert wohl auch auf die Solitüde,« dachte Heinrich.
Der Empfang bei Dalberg war, wie eine solche Einführung voraussehen ließ, der wünschenswerteste. Es wurde von nichts als von den Festlichkeiten gesprochen, während unserem Freunde der Boden unter den Füßen brannte. Nach kurzer Zeit empfahl sich der Graf und sagte seinem tumultuarisch Gefreiten mit einer herzlichen Umarmung Lebewohl. Der Mannheimer Gönner unterrichtete ihn, der nun allein zurückblieb, mit sichtbarer Eilfertigkeit über die neue Atmosphäre, in die er einzutreten hatten und als das Gespräch zu stocken begann, empfahl sich Heinrich.
»Kennen Sie den jungen Regimentsmedicus Schiller?« fragte Herr von Dalberg, als er schon unter der Türe war.
»Sehr gut!« rief Heinrich freudig, »ich weiß, er hofft auf Ew. Exzellenz.«
»Der junge Mann scheint sich hier nicht heimisch zu fühlen,« sagte der Freiherr, »ich bedaure das und wünschte, etwas für ihn tun zu können. Er erregt Hoffnungen; seine Räuber sind, gewisse Kruditäten abgerechnet, eine recht brave Arbeit. Freilich, es läßt sich nicht voraussehen, wie sich ein Talent dieser Art entwickeln wird. Seine Persönlichkeit kommt mir etwas exzentrisch vor.«
»Ew. Exzellenz geben Hoffnung?« fragte Heinrich, der nichts anderes hören wollte.
Der Freiherr zuckte die Achseln: »Das steht im weiten Felde.«
»Mit dem hat man auch den Mund zu voll genommen!« sagte unser Freund ingrimmig, als er sich auf der Straße sah. »Unsere Literatur ist doch noch viel zu kindlich hinter jedem Sonnenschimmer her. Aber jetzt meiner Sonne nach!«
Er eilte zu dem Hause des Expeditionsrats. »Hättest du dir je geträumt,« sagte er, während er den Klopfer in der Hand hielt, »daß du so hier wieder einmal eintreten würdest?« – Er klopfte. Ein Bedienter öffnete und gab ihm den Bescheid, die Herrschaft sei vor einer halben Stunde nach der Solitüde abgefahren.
Unmutig ging er weg. »Was jetzt tun?« rief er, und im selben Augenblicke fuhr Dalberg an ihm vorüber. »Nun, wenn denn alles auf einen Magnet losstürzt, so will ich mit dem Strome schwimmen; ich muß ja Amalien droben treffen.
Er eilte nach seiner Wohnung, wo er vorher das Nötige abmachen wollte. Da er auf diesem Wege die Menschenmasse, die in Bewegung war, teils nach der Länge, teils quer durchschneiden mußte, so kam er ziemlich langsam vorwärts, und diese Verschiedenheit von Kräften und Wirkungen machte ihn sehr ungeduldig.
Auch hier wäre er beinahe vergebens gegangen. Alles war nach der Solitüde; nur eine alte Frau, die gleich ihm zur Miete hier wohnte, hatte sich glücklicherweise anheischig gemacht, das Haus zu hüten. Nach langem Suchen vermochte sie ihm seine Schlüssel einzuhändigen, und ohne ihren neugierigen Fragen Rede zu stehen, betrat er seine Junggesellenwohnung mit einem seltsamen Gefühl. Hier lag und stand noch alles in der alten Ordnung oder Unordnung durcheinander; auch hatte sich ziemlich viel Staub angesetzt. Nach einem flüchtigen Blick eilte er an den Schreibtisch, zählte das Mietgeld ab und bat in ein paar Zeilen, die er, da die Tinte vertrocknet war, mit Bleistift schreiben mußte, um Übersendung seiner Siebensachen nach Illingen.
Dorthin wollte er noch diese Nacht von der Solitüde aus abgehen, auch wenn er Amalien droben nicht zu sprechen bekäme. Er malte es sich schon aufs reizendste aus, wie er mit Tagesanbruch im Garten sitzen würde; dann kam natürlich Lottchen herunter und machte große Augen über den Besuch, den sie noch im tiefsten Verließ träumte. Nun sprangen seine Gedanken auf den Schmied über, der durch die letzten Ereignisse seinem Herzen so nah getreten war. »Soll ich's ihm sagen oder nicht? Er hat ihn verschmerzt; wozu die Wunde wieder aufreißen? Aber wie ich ihn kenne, wird es seinem stolzen Herzen ein Trost sein, zu hören, wie sein Sohn den Verderber seines Lebens mit hinabgezogen hat.« – Er war endlich entschlossen, die Mitteilung von den Umständen und dem Augenblick abhängen zu lassen.
Als er sich umkleidete, kam ihm erst seine Brieftasche zu Gesicht, die ihm der Graf so schnell zugesteckt hatte. Er öffnete sie, und zwei Papiere fielen ihm entgegen, die einzigen, die nicht am gehörigen Platze lagen. Das eine war ein Wechsel auf Frankfurt, der etwas mehr als seine ganze rückständige Besoldung betrug. »Das ist doch sonst seine Art nicht!« sagte er sehr verwundert, »aber jetzt ist keine Zeit, Einwendungen zu machen. Was soll ich dieses Geld nicht willkommen heißen? es ist auch eines von den Motiven, die mich fortbringen sollen.«
Er öffnete das andere Papier: es war Schillers Fürstengedicht. Gleich im Aufschlagen sah er, daß die Stelle, die wir schon einmal herausgehoben, mit einem Notabene in derben Bleistiftstrichen bezeichnet war. Er kannte nur eine Hand, die den Bleistift so kräftig zu führen pflegte, und wünschte seine Augen widerlegen zu können. »Das trifft schön mit der Fürstengruft zusammen!« rief er. »Wie? ist das vielleicht ein Kommentar zu der Beschuldigung, daß ich mit fremden Klauen kratze? Wie dem sei, ich muß es Schiller sagen. Aber er wird fort sein, er eilte ja so sehr. Gleichviel, ich versuche es. Ach was kann, was soll ich ihm sagen? Gefahr hier, und dort keine Aussicht!«
Er übergab der Hausgenossin das Geld und die geschriebenen Aufträge, und wiederum arbeitete er sich unaufhaltsam durch die flutende Menschenmasse. Schiller war nicht zu Hause. Er wagte nicht, einen Zettel an die Türe zu stecken, da er seine Nachricht deutlicher, als gut war, hätte abfassen müssen, und so ging er ratlos hinweg.
Nun blieb ihm noch eine Bestellung übrig, die er, unbedient wie er war, in Person besorgen mußte. Er wollte sich einen Kutscher suchen, um auf die Solitüde und nach Illingen zu fahren. Er hatte sich fast atemlos gerannt und befand, daß auch die Freiheit für den ersten Augenblick ihre Bürde habe.
Das Kutschergäßchen legte ihm zwar weniger Hindernisse in den Weg als die größeren von dem Menschenstrome durchfluteten Straßen, aber auch dort machte er lauter vergebliche Gänge. »Alles auf die Solitüde abgefahren!« Er hätte sich's vorstellen können, daß dieser Tag eine Ernte für die Wagenlenker sei. Nein! dort in einem Einschnitte stand ein Wagen vor einem Häuschen, der mußte doch noch zu haben sein. Auf der Treppe waltete die Frau des Kutschers, die den Fragenden in Abwesenheit ihres Gemahls sehr unwirsch empfing. »Mein Andrees«, sagte sie, »hat zwei Herren nach Pforzheim zu führen versprochen; das müssen mir wunderliche Passagiere sein, die da in der Nacht Pforzheim zuhaudern, während alles zum Feste geht!« – »Die kommen ja über Illingen!« dachte er, »ich hätte gute Lust, mich ihnen aufzudringen, denn wir leben auf einem wahren Kriegsfuß heute. Wenn ich nur nicht vorher die unbegreifliche Amalie sprechen sollte.« – Die Frau schnitt ihm jede Hoffnung auf eine Fahrgelegenheit nach der Solitüde ab. In der Nachbarschaft, sagte sie, sei kein Wagen mehr zu haben, und sie gebe ihm ihr Wort darauf, daß er in der ganzen Stadt vergebens nach einem suchen würde.
»Und wenn ich zusammenbreche,« sagte er im Weitergehen vor sich hin, »Solitüde und Illingen, den ganzen Weg mach' ich zu Fuße. Morgen früh muß ich drunten sein.«
Während er abschneidend durch einen der vielen Winkel jener engen Stadtgegend ging, widerfuhr ihm etwas Wunderliches. Er war einen Augenblick still gestanden, um Atem zu schöpfen. Da hörte er in einem Durchgang nebenan zwei ebenso heftig gehende Menschen aufeinander stoßen, von denen der eine flüsterte: »Nun, ist's richtig mit der Wache?«
»Alles richtig!« erwiderte der andere im gleichen Flüsterton, »Gabelenz hat die Wache. Sei ganz ruhig, ich bin auf dem Posten und will infam werden, wenn ich dir ein Haar krümmen lasse. Höre, das pathetische Zeug ist nicht meine Sache, und wir sind in der Akademie zu verschwenderisch damit gewesen, aber jetzt will ich dir's sagen; du bist ein ganzer Kerl, du bist ein großer Mensch.«
Er hörte einen Kuß schallen. Die Stimmen hatten ihm etwas Bekanntes; auch die Erwähnung der Akademie gab ihm ein gewisses Recht, sich ihnen beizugesellen, und so ging er auf die Stelle zu, wo das ungewöhnliche Gespräch geführt wurde. Er strauchelte aber heftig über ein Kehrichtfaß; dieses rollte ihm in den Weg, und bis er das Hindernis mit dem Fuß beseitigt und den Platz erreicht hatte, sah er niemand mehr. In der Ferne hörte er eilige Fußtritte, und als er diesen nachsetzte, gewahrte er einen Menschen, der eben um die Ecke bog. Das zylinderförmige Bein, das militärische Tuch, was er eben noch erblicken konnte, erweckte ihm eine Vermutung. Er nahm alle Kraft zusammen, aber als er in die Straße kam, war die Erscheinung weg, als wäre sie in den Boden gesunken. Er hätte darauf schwören mögen, daß es Schiller gewesen sei. – Noch einmal ging er in dessen Wohnung; die Türe war wiederum geschlossen. Nun endlich machte er sich auf den Weg, den letzten Pilgerzügen folgend. In seiner Ermüdung von dem ungewohnten kennen hatte er ein Gefühl, als ob die allgemeine Bewegung ihm einen Teil von ihrer Kraft in die Glieder legte.

– – – Zwiefach ist
Des Ruhmes Art. Der eine wächst heran
Fast vor der Zeit, und welkt auch bald hinweg
Als hoffnungsvoller Jüngling; doch der andere,
Der nachgeborene, ist unscheinbar erst,
Und langsam wird er reif, bis ihn zuletzt
Die Götter mit dem Lorbeer selbst bekränzen.
Ludwig Bauer, Der heimliche Maluff.
Stuttgart, die stille Residenz, war nie stiller gewesen. Mehrere Stunden, nachdem die Menschenwellen allmählich sich verlaufen hatten, fuhr ein Wagen durch die dunkleren Quartiere der ausgestorbenen Stadt. Der Kutscher, vorsichtig um sich blickend, lenkte nach dem Tore, durch welches einst die Banner der württembergischen Grafen gegen die Reichsstadt Eßlingen ausgezogen waren. Heute schilderte ein Soldat vom herzoglichen Infanterieregimente Gabelenz daselbst, der sich, verdrießlich, die Herrlichkeiten auf der Solitüde nicht sehen zu können, auf seinem Posten dehnte. Aus dem Offizierszimmer blinkte Licht, das beim herannahenden Rollen des Wagens schnell erlosch; das Fenster öffnete sich leise, aber niemand war darin zu sehen.
Der Soldat trat vor, um die Reisenden anzuhalten. »Halt! Wer da? Unteroffizier heraus!« klang es mürrisch.
»Gut Freund!« sagte eine weiche etwas zitternde Stimme aus dem Wagen, und ein banges Stillschweigen folgte.
»Wer sind die Herren?« war die Anrede des Korporals.
»Doktor Ritter und Doktor Wolf, nach Eßlingen reisend,« antwortete dieselbe Stimme, und eine jugendliche Gestalt beugte sich aus dem Wagen.

»Wer sind die Herren?« war die Anrede des Korporals.
»Passiert!«
Der Korporal ging wieder ins Wachhäuschen zurück, der Soldat nahm sein Gewehr auf die Schulter und wandte sich, um auf und ab zu gehen; der Kutscher hieb auf die Pferde, und rasch fuhr der Wagen weiter. Da erschien jemand an dem offenen Fenster; eine Hand winkte den Reisenden ein Lebewohl nach, die andere fuhr über ein tränenschimmerndes Auge, und eine herzliche Stimme flüsterte: »Dir alles Glück! Du verdienst es!«
Der Wagen fuhr hinter der Akademie hinab, wandte sich unterhalb des den Eleven zum Bebauen angewiesenen Gartens links, bewegte sich eine Strecke auf dem alten Rennwege gegen Cannstatt hinunter und machte dann am unteren Rande des Herrschaftsgartens noch einmal eine scharfe Wendung zur Linken. Jetzt zogen die Pferde kräftig an, der Wagen rollte auf festerem Boden, und: »Hab' ich's brav gemacht?« rief der Kutscher herein, »wir sind auf der Ludwigsburger Chaussée!«
»Trefflich!« war die Antwort. »Das soll Euch zu statten kommen. Wär' ich zum Ludwigsburger Tor hinausgefahren, so hätte meine Dulcinea morgen schon Wind gehabt, wohin ich gehe.«
Der Wagen fuhr den Berg hinan. Der Galgen des berüchtigten Finanzministers, den die Stände nach dem jähen Tode des vorigen Herzogs gehenkt hatten, sah schauerlich, eine dunkle Schreckgestalt, in der ungewissen Beleuchtung herüber.
»Sehen Sie da?« fuhr der, welcher bisher allein das Wort geführt hatte, zu seinem schweigenden Genossen fort, »aber
Die Nürnberger henken keinen,
Sie hätten ihn denn zuvor.«
Er lachte mit kindlicher Fröhlichkeit. »Wissen möchte ich übrigens doch,« setzte er hinzu, »wenn die ehemaligen Plusmacher des Herzogs hier vorbeifuhren, ob es ihnen nicht kühl den Nacken hinauf gelaufen ist bei dem abschreckenden Exempel?«
Doktor Ritter gab durch ein kurzes Lachen seine Zustimmung zu erkennen, blieb aber in sich gekehrt, bis der Wagen, auf der Höhe angekommen, sich in einen lustigen Trab setzte und sein Gefährte wieder anhob: »Gottlob! jetzt wären sie glücklich um die Ecke geschlüpft, der Ritter und der Wolf. Wär' ich ein Dichter, so machte ich eine Fabel draus. Aber sei's um ein paar Stunden, so sind Sie wieder mein lieber Schiller, und auch ich werfe meinen Wolfspelz ab, bin wieder das alte gute Schaf und Ihr bis in den Tod getreuer Streicher.«
Der Dichter atmete hoch auf und reichte ihm dann bewegt die Hand.
»Sehen Sie,« sagte Streicher, »da lassen wir die Ludwigsburger Straße rechts hinziehen und fahren geradeaus. Jetzt haben wir wohl nichts mehr zu fürchten. Die ganze Welt ist in leeren Festlichkeiten trunken und hat nicht Zeit, sich nach einem Verkannten umzusehen, der tausendmal reicher und besser ist als sie. – Ha, ha! Und meine Dulcinea, die erfährt gewiß nichts davon, die kommt uns gewiß nicht nach. Was doch eine Dosis Schlechtigkeit einen Menschen herausstaffieren kann! Haben Sie nicht gesehen, wie der Kutscher ordentlich Respekt vor mir bekommen hat, seit ich ihm zu verstehen gab, daß ich ein Mädchen sitzen lasse?«
»Wenn er Ihren Charakter so gut kennte wie ich, so würde er dieses Vorgaben höchst verdächtig gefunden haben.«
»Nein, wahrhaftig,« sagte der ehrliche Musikus, »ich kann getrost meinen neuen Lebensweg dahinrollen. Adieu Stuttgart, ich habe die Reue nicht hinter mir.«
»Hinter uns Elend und Sorge, und vor uns die Hoffnung,« jubelte der Dichter. »Hoffnung ist der Schlüssel, womit man sich die Welt aufschließt. Vertrauen und Wagen ist die Religion des Genius! Ich will dem Tyrannen, der mein Licht hinter den Schirm stellen und zu einem untertänig dämmernden Nachtlichtchen machen möchte, ich will ihm zeigen, daß ich von gleich hartem Holze bin, wie er.«
»Lieber wäre mir's doch,« sagte sein Pylades bedächtig, »wenn Sie eine ausdrückliche Zusage von Dalberg erhalten hätten.«
»Das ging nicht an, mein Guter! Die Zeit war nicht passend, ihm mein Vorhaben mitzuteilen. Er hätte Bedenklichkeiten vorgebracht, hätte mir versprochen, sich beim Herzog zu verwenden, und so wäre Woche um Woche verpaßt und am Ende nichts daraus geworden. Jetzt stehen die Sachen einfach; ich bin fort, und man wird mich nicht zurückholen, in Stuttgart danken mir's die Nachrückenden und die Versorgenden, in Mannheim sind die Bedenklichkeiten zum Schweigen gebracht, die Brücken hinter mir abgebrochen, und Ritter Heribert wird am Ende selbst zufrieden sein, daß ich ihn durch diesen raschen Schritt gezwungen habe.«
»Zwingen ist so eine Sache,« versetzte der hartnäckige Streicher, »die Leute lassen sich nicht immer zwingen. Man hat Beispiele, daß sie einen – stecken ließen. Übrigens sag' ich das nicht gegen Sie. Der Dichter der Räuber wird in Mannheim und überall mit offenen Armen empfangen, der Fiesco mit dem günstigsten Vorurteil aufgenommen werden. Lieber wäre mir's freilich, wenn Sie ganz sicher wären; aber ich habe den besten Mut. Über das Schicksal der Ihrigen sind Sie ganz unbesorgt?«
»Ganz! Der Herzog ist in diesem Punkte kein gemeiner Mensch, und wenn er je gewalttätig gegen meinen Vater verfahren wollte, so bin ich ja in der Nähe und kann mich sogleich stellen.«
Ein langes Stillschweigen folgte auf diese Worte, jeder dachte seiner Zukunft nach.
»Aus der Heimat zu gehen!« rief endlich der Dichter schmerzlich aus. »Sie hat mich stiefmütterlich behandelt, ich habe ihr in der lezten Zeit gegrollt, und nun! Noch bin ich nicht fort und schon wandelt mich's bitter wie ein Heimweh an. Es ist ein trauriges Gefühl, in seinem Vaterlande nicht bleiben zu können.«
»Die Welt ist kalt und träg!« seufzte sein treuer Gefährte. »O, es wird ein Tag kommen, wo sie sich schämen werden, ihren Edelstein so weggeworfen zu haben!«
»Lieber!« sagte der Dichter mit milder Stimme, »ein Mann und seine Zeit bilden sich aneinander. Mir wäre es zwar wohltuend gewesen, wenn sie mir von ihrem Überfluß einen Brocken gegönnt hätten, wenn ein Mann von Ansehen vor dem Herzog meine Sache geführt, wenn man mir auf erregte Hoffnungen hin einiges Vertrauen bewiesen hätte; ja, es hätte mich stolz gemacht, meine Bildung meinem Vaterlande verdanken zu dürfen. Aber ansprechen konnte ich das alles nicht, denn ich bin ja kein Fertiger, ich habe ja kaum angefangen. In solchen Fällen ist mit Klagen und Schelten nichts getan; man muß eben streben, daß man es zu etwas bringt. Vielleicht ist es eben der Genius der Heimat, der mich jetzt hinaustreibt, damit ich ihr nachher etwas mehr sein kann. Und es ist doch etwas Großes, für seine Zeit und sein Volk zu leben. In reineren Stunden fühlt man da kein Opfer, verlangt man keine Belohnung, die Arbeit ist ihr eigener Preis.«
»Wenn´s nur in Mannheim gut geht.« sagte die ehrliche Seele seines Begleiters dazwischen, »aber es kann ja nicht anders. Die werden Augen machen über die Herrlichkeiten des neuen Dramas! – Sind Sie nicht müde? Sie haben die vergangenen Nächte beständig am Fiesco gearbeitet, wollten Sie nicht ein wenig ruhen?«
»Nein,« erwiderte Schiller, »es ist eine Spannung in mir, die mir nicht zu schlafen erlaubt. – Ja,« fuhr er nach einer Pause, ganz in seinen Gegenstand versunken, fort, »es hat herrliche Männer hervorgebracht, dieses Land! Wenn ich an die Hohenstaufen denke! Und an Kepler, der im Licht der Sterne seinen Hunger stillte!«
»Ich bin auch ein Schwabe,« sagte der Musikus, »aber es tut mir weh, wenn ich daran denke, daß von den Hohenstaufen keiner in der Heimat begraben liegt, als der milde König, der durch Meuchelmord fiel, daß der Letzte des Geschlechts verlassen unter fremdem Henkerschwert verblutete und daß der edle Kepler eben auch in der Fremde verkommen ist. Wie viele hat es hervorgebracht, die in der Heimat geblieben sind?«
»Wackere, treffliche Männer«, versetzte der Dichter, »sind im Lande geblieben und haben es hoch zu Ehren erhoben. Lassen Sie uns nicht ungerecht sein und jedes einzelne Schicksal dem Vaterlande zur Last legen. Mancher hat sich selbst verbannt, und manche Schuld fällt den Umständen zu. Wahr ist es, die Schwaben sind neuerdings in vielen Stücken zurück. Der gute Gellert gilt bei ihnen noch für einen sehr verwegenen Poeten. Aber glauben Sie mir, sie werden das Versäumte bald mit großen Schritten nachholen. Es ist so viel Herz, so viel Witz in unserem Stamme, daß er nicht auf die Länge dahinterbleiben kann.«
»Wenn einmal eine Zeit kommt,« sagte Streicher, »wo man in Stuttgart nicht mehr über den Räubern die Hände zusammenschlägt! Ich kann mir´s kaum denken.«
»Wenn aber eine Zeit käme, wo ich selbst dieses Produkt mit scheuen Augen ansehen würden?« rief der Dichter lachend. »Es ist doch die Frucht eines harten Bodens, und so weh' es mir tut, von ihm zu scheiden, meine Muse sehnt sich nach einer glücklicheren Heimat. Getrost, Freund! Es leuchten günstigere Gestirne zu unserer Flucht! Wo Herz und Geist eine Stätte finden, da ist das Vaterland, und ich bleibe ja doch in meinem großen, schönen, reichen Vaterlande, das von jeher das erste Land der Welt gewesen ist, ich bleibe ja in Deutschland! Es wird doch noch einen Winkel haben für seinen Sohn.«
»Ah!« rief sein Gefährte mit kindlicher Freude. Der Kutscher hielt. Streicher deutete links hinauf. Ein märchenhaftes Wunder leuchtete vom Gipfel des Berges herab, ein Feenpalast mit vielen tausend Lichtern, in welchen er aus der Entfernung wie in einer weißen Flamme brannte. Es war die beleuchtete Solitüde, zu welcher hier die Waldstraße von Ludwigsburg hinaufführte, den Wald mit einer fast meilenlangen geraden Lücke durchschneidend, die an ihrem oberen Ende wie in einem Rahmen die Aussicht auf das Lustschloß bot.
Die Freunde lehnten sich zum Wagen hinaus und sahen mit beklommenem Herzen bald in das nächtliche Wundergebilde, bald in die unvergänglichere Herrlichkeit des blauen Himmels, der sich darüber wölbte.
»Nun bekommen wir ja doch auch noch etwas vom Festin zu sehen, und viel schöner als in der Nähe!« rief der treuherzige Musikus, der hierdurch unwillkürlich verriet, daß ihm die Entsagung etwas gekostet hatte. »Sehen Sie doch nur,« fuhr er fort, »es ist taghell! Man kann jedes einzelne Gebäude unterscheiden. Wunderschön!«
Der Dichter starrte schweigend in das Lichtmeer, aus welchem ihn die bekannten, vertrauten Gegenstände wie fremd und fabelhaft ansahen; eine tiefe Wehmut überschlich sein Herz bei dem schönen Märchen, das nach kurzem Glanz in Nacht zurücksinken sollte. Da fiel sein Blick auf die Elternwohnung, die verklärt nach ihrem Flüchtling heruntersah. Er zeigte sie dem Freunde, sein Herz hob sich hoch: »O meine Mutter!« rief er schmerzlich und warf sich in den Wagen zurück. Der Kutscher trieb die Pferde wieder an, und die Fata Morgana war verschwunden.
Stumm und schwermütig setzten die Flüchtlinge ihre Reise fort. Zwei engverwandte Lebenswege hatten sich hier noch einmal berührt, ein überirdisches Licht hatte ihrem letzten Gruße geleuchtet, und nun sollten sie auf lang, vielleicht auf immer auseinander gehen. Anders war es jetzt dem Dichter zu Mute: hinter ihm in leuchtendem Glanze lag die Heimat, vor ihm die Zukunft und die Fremde in ungewisser Dämmerung. Ein banger Schmerz durchschnitt den hohen Flug seines Strebens, ihn übernahm das Weh und die Schwachheit der Erde. Ach, keiner reißt sich ungestraft von dem Busen der Heimat los: die Arme, die sie ihm nachstreckt, hemmen seinen Schritt, ihre mütterlichen Seufzer, die ihm nachtönen, lähmen seinen Mut.
Der junge Musikus ehrte die Gefühle seines bewunderten Freundes und beobachtete ein zartes Stillschweigen. So ging es eine lange Strecke fort, und nur der einförmige Knall der Peitsche belebte zuweilen die stumme Fahrt.
Die Fahrt ging über einen Bergrücken steil ins Tal hinab, die Enz rauschte neben den Flüchtlingen hin. Sie kamen nach Enzweihingen, wo sie Halt machen mußten. Schiller, der auch am Wirtstische nicht unbeschäftigt sitzen konnte, zog einige Blätter ungedruckter Gedichte Schubarts, seines heimlichen Vorbildes, aus der Tasche und las dem empfänglichen Freunde mit leidenschaftlichem Feuer die Fürstengruft vor. Er war jetzt wieder angespannter, zur Mitteilung und zum Gespräche gestimmt. »Es ist doch ein gräßlicher Gedanke,« rief er endlich, »um einen eingesperrten, mißhandelten Dichter! Gibt es einen tolleren Widerspruch, als den Herold der Freiheit und der Menschenrechte im Kerker zu wissen? Hätten wir ihn doch mitnehmen können! Zu guter Zeit hab' ich noch die Türe gefunden; sein Los hätte auch mir geblüht. Eilen wir denn! Noch immer zittert der Boden unter mir.« – Er deutete bei diesen Worten nach der Wand, von welcher ein wohlgetroffenes Bild des Herzogs sehr ernst und bedeutsam auf ihn blickte.
Ein starker Kaffee hatte die müden Lebensgeister der Reisenden erquickt; schon lag etwas von Morgenfrische in der Luft, und der Himmel schien blässer zu werden, als sie wieder in den Wagen stiegen.
Sie fuhren in Vaihingen ein. »Sehen Sie!« rief Schiller lebhaft, »hier wurde der Sonnenwirt gefangen.« – Nun war er wieder im Zug und knüpfte an alles seine tiefsinnigen Bemerkungen an. »Wer in solcher Reisestimmung durchs Leben hinwandern könnte,« rief er endlich aus, »der wäre zu beneiden! Da leben wir ganz im gegenwärtigen Moment und genießen fröhlich, was sein Genius, so karg oder freigebig er sein mag, uns vergönnen will. Abgeschüttelt ist, was uns quälte, und was kommen wird, ist außer Frage gestellt. Man taumelt in einer süßen Freiheit fort, bis man sich endlich wieder an einen bestimmten Aufenthalt fesselt, wo uns das menschliche Verhängnis nur gar zu bald einholt und seine alten Rechte geltend macht.«
»Sehen Sie doch,« rief Streicher, »was ist das für eine Erscheinung?«
Sie waren eben durch ein Dorf gefahren und sahen am Ende desselben in der nicht weit von der Straße abliegenden Kirche die Fenster erleuchtet.
»Was mag das bedeuten?« sagte der Dichter. »Ist hier ein Kloster, wo man zur Hora geht? Wie heißt die Ortschaft?«
»Es ist ein gut protestantisches Dorf und heißt Illingen.«
»Illingen?« rief der Dichter. »Wenn es Tag wäre und wir uns einen Augenblick verweilen könnten, hier möchte ich einen Besuch machen; hier wohnt jemand, der mich interessiert. Sie müssen wissen, daß unser ernsthafter Freund Roller hier eine ehemalige Geliebte hat.«
»Roller?« sagte der junge Mann sehr erstaunt. » Der hat ein Mädchen aufgegeben?«
»Es ist eine sonderbare Geschichte. Er erzählte mir einmal in einer vertraulichen Stunde davon, aber er ging schnell drüber weg, es schien ihm peinlich zu sein.«
»Das glaube ich!« rief der Musikus bitter. »Nein, das hätt' ich nicht hinter ihm gesucht. Ich will doch auch dem ehrlichsten Gesichte nicht mehr trauen.«
»Über Liebesgeschichten,« versetzte der Dichter, »ist schwer zu urteilen, weil man nie den ganzen und genauen Verlauf erfährt.«
»Bei alle dem,« sagte Streicher, »ist es abscheulich, ein Mädchen sitzen zu lassen.«
»Mein bester Freund,« entgegnete der Dichter, »wir wissen ja nicht, ob er schuldig oder unschuldig ist. Wie, wenn diese verlassene Dido die Vorwürfe träfen, die Sie vorhin meiner armen Heimat aufgebürdet haben? Wenn sie ihn nicht genug festgehalten hätte, und das vielleicht gerade in einem Augenblicke, wo die Aufgabe des Handelns dem schwächeren Teile zugefallen war? Sein Schicksal hat inzwischen eine Wendung erfahren, er ist frei; ich sah ihn heute, da er aber nicht allein war, so mußte ich in meinem Reisestrudel an ihm vorbeischwimmen. Mögen ihm die Sterne hold sein! Wenn ich recht in seiner Seele gelesen habe, so hängt er noch immer an dem Mädchen, und das ist eine Bürgschaft, daß auch ihr noch die Kraft des Herzens wachsen wird, und im Wiederfinden wird jede bittere Erinnerung untergehen. Lassen Sie mich hoffen, daß es auch zwischen mir und meiner verlassenen Geliebten, der Heimat, einst dahin kommen wird.«
Mit diesen Worten der Versöhnung ging er der Landesgrenze entgegen. Der Wagen donnerte am alten Kloster Maulbronn vorüber, das noch im leichten Morgenschlafe lag, durchfuhr das württembergische Grenzstädtchen, das den Zauberer Faust geboren haben soll, und näherte sich der Heimat Melanchthons, die dem rheinischen Nachbarlande angehört.
Mit jedem Schritt der Pferde vermindert sich der Raum. Der Genius des Mutterlandes streckt immer ferner, hilfloser die Arme nach dem Lieblingssohne aus. Er kann ihn nicht mehr erreichen. Ein Zug der Rosse, ein letzter Seufzer – und Schwaben hat seinen Dichter verloren. Nun ist er im Ausland und eilt über die traurigen Markschelden, welche das Innerste von Deutschland zerreißen. Aber getrost! Er ist ausersehen, das schroffste Gemäuer dieser Bollwerke mit seinem Gedankenstrome niederzuwerfen. – Er geht, und eine lindernde Mutterträne folgt ihm in Kummer und Entbehrung nach.
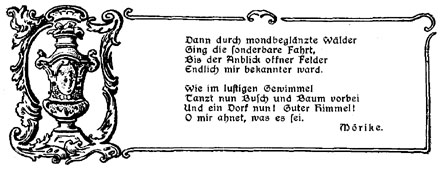
Dann durch mondbeglänzte Wälder
Ging die sonderbare Fahrt,
Bis der Anblick offner Felder
Endlich mir bekannter ward.
Wie im lustigen Gewimmel
Tanzt nun Busch und Baum vorbei
Und ein Dorf nun! Guter Himmel!
O mir ahnet, was es sei.
Mörike.
Heinrich hatte nach langem Rennen und Suchen erst spät den Weg nach der Solitüde antreten können. Als er, müde von seinen Gängen in der Stadt und der starken Bewegung seit längerer Zeit nicht gewohnt, gegen Abend endlich ankam, war der größte und glänzendste Teil der Jagd schon vorüber; die Hirsche waren in den See gejagt worden, wo sie noch immer von den im Lusthause aufgestellten Herrschaffen zusammengeschossen wurden. Er hatte keine Lust, dieses grausame Vergnügen mit anzusehen; auch stand die Menge so dicht gedrängt um die freigegebene Seite des Sees, daß ihm jeder Blick auf das Schauspiel versperrt war; und so hörte er nur aus der Ferne die mühelosen Schüsse, womit die edlen Tiere niedergeknallt wurden. Wie einer, der von einer Wünschelrute unwiderstehlich vorwärts gezogen wird, drückte er sich durch die schaubegierigen Menschenhaufen, und da er immer nur auf die Gesichter sah, so nahm er manchen Fuß, manchen Ellbogen empfindlich mit, erhielt auch manchen derben Stoß, teils von der Rache, teils von der Neugier, deren Ziel ebenso rücksichtslos das seinige kreuzte. Rastlos verfolgte er diese seltsame Jagd, die keinem auffiel, da aller Augen nach einer Seite hin gerichtet waren, und selbst die hintersten den vorne Stehenden unverwandt auf den Rücken sahen, als wollten sie ihnen durch den Leib hindurch nach dem See blicken.
Er wurde immer ungeduldiger. Während er so in vergeblichem Suchen auf der Waldfreiung umherging, fiel ihm ein braunes Gesicht in die Augen, das, als er fast schon vorüber war, seine Aufmerksamkeit erregte. Sieh, er war es wirklich, es war Tony. Ein Schauer ging ihm durch die Seele, als er an jenen schwersten Traum seines Lebens zurückdenken mußte. Er zögerte und wußte kaum, ob er nicht lieber unerkannt an dem jungen Zigeuner vorbeistreifen sollte; aber in diesem Antlitz lag ein unendlich tiefer Schmerz, der ihn nicht vorübergehen ließ. Er wollte ihn anreden, da gewahrte er, daß seine Augen auch nicht den Blicken der Menge folgten; sie hingen fest an einem anderen Ziele, und ihr Ausdruck sprach es aus, daß sie in einen verlorenen Himmel schauten. Heinrich ahnte den Gegenstand, an dem sie hafteten, und zaudernd folgte er mit den seinigen nach dem Lusthause. Dort stand sie im Schein der Abendsonne, nahe genug, um deutlich von seinem Standort aus gesehen zu werden, anteillos zwischen den Schüssen, die neben ihr hervorknallten. Sie schien starr in den See zu schauen, aber keine Regung, daß sie dort ein Schauspiel wahrnehme, spiegelte sich in ihren Blicken. Dies waren vielleicht die drei einzigen Menschen unter den hier versammelten Tausenden, deren Augen nicht nach dem gemeinsamen Ziel der Neugier gerichtet waren. Heinrich sah, wie der junge Graf zu seiner Gemahlin trat; er schien zärtliche Worte zu ihr zu reden, sie antwortete durch eine leichte Bewegung des Hauptes, ohne sich umzuwenden.
Ein Zucken hatte bei diesem Anblick die leblose Bildsäule neben ihm in Bewegung gesetzt; er sah sich nach dem Zigeuner um. Dieser stand wieder ruhig da, die Arme auf den Rücken gelegt; die eine Hand ruhte ausgestreckt offen auf der anderen. Heinrich trat leise hinzu und legte die seinige darein. Der Zigeuner wandte sich, und sein Gesicht wurde noch dunkler, als er den alten Bekannten erblickte.
»Hier seh' ich dich, Tony?« rief Heinrich, »hat es keine Gefahr für dich?«
»Nein,« erwiderte der Zigeuner, »ich bin mit den Meinigen begnadigt. – Wegen des Verrats!« setzte er bitter hinzu.
»Nun, das darfst du nicht bereuen; du hast manches Verbrechen verhindert.«
»Herr, Verrat ist eben Verrat!« sagte der junge Zigeuner.
Heinrich suchte den verhaßten Erinnerungen zu entgehen und fragte ihn, was er jetzt anzufangen gedenke.
»Weiß ich's denn selbst?« sagte Tony, »fragt den Baum, dem die Wurzel abgehauen ist, was er anfangen wolle? – Ich denke immer, ich will den Flüssen nachziehen, bis sie zu den großen Schiffen kommen; die werden mich doch als Matrosen annehmen, denn meine Glieder sind sehr leicht. Ich möchte aufs Meer, weil es unergründlich ist. Nach Amerika möchte ich, weil es so ein grenzenloses Land ist, mit tiefen, dunklen Waldungen. Ich möchte weit, weit fort, und immer wandern ohne Aufenthalt, und ohne einen Menschen zu sehen oder ein Haus.«
Heinrich drückte ihm die Hand, und das ungewöhnliche Freundespaar stand lange schweigend beieinander. »Höre, Tony,« sagte Heinrich nach einer Weile, »willst du nicht mit mir gehen? Ich bin angestellt in einem anderen Lande und will für dich sorgen.«
Der Zigeuner schüttelte leise den Kopf und drückte ihm die Hand fester.
Es wurde allmählich dunkel, und die Schüsse fielen sparsamer. Heinrich dachte wieder an die Absicht, die ihn hiehergeführt. »Tony,« sagte er, »willst du mir noch einen Gefallen tun?«
Der Zigeuner lächelte freundlich durch die weißen Zähne und neigte den Kopf.
»Ich forsche hier nach einer Frau, mit der ich notwendig reden muß,« fuhr Heinrich fort und beschrieb ihm Amalien. »Ihr Kinder der Sonne habt scharfe Augen; wenn du sie siehst, und ich weiß gewiß, daß sie hier ist, so sag' ihr, ich suche sie schon den ganzen Abend. Wenn's nicht anders geht, so kannst du's ihr vor aller Welt sagen. Du triffst mich später am Schlosse, ich will mich inzwischen dort nach ihr umsehen.«
Der arme Tony versprach sein Bestes, und Heinrich eilte durch die Alleen nach dem Schlosse. Er traf auch dort schon eine Menge Menschen, welche sich an der Jagd sattgesehen hatten und nun den Anstalten zu den bevorstehenden Herrlichkeiten des Feuerwerks und der Illumination zusahen. Suchend ging er von einer Gruppe zur anderen und gelangte endlich an der katholischen Kirche vorüber zu Hauptmann Schillers Wohnung. Dort fiel es ihm bei, sich nach dem Freunde zu erkundigen und ihm die unerwünschte, aber notwendige Eröffnung zu machen. Er trat ein und fand nur die Hausfrau, die ihm berichtete, daß die ganze Familie zu den Festlichkeiten gegangen sei. Sie war von einem Gebetbuch aufgestanden, ihre geistvollen Augen sahen matt und gerötet aus, und eine tiefe Niedergeschlagenheit sprach aus ihrer Haltung. Heinrich wagte, da er sich fast fremd nennen mußte, nicht, nach der Ursache derselben zu fragen, und erkundigte sich, ob der Doktor nicht auch oben sei.
»Fritz ist nicht hier,« sagte die Mutter, »er hat kein Interesse an diesem brillanten Wesen.«
»Auch ich bin aus ganz anderen Gründen da,« versetzte Heinrich. »Jedenfalls wird es ihn freuen, daß ich bei Ihnen war; wenn ich nach Stuttgart zurückgehe, so hoffe ich ihn morgen früh zu sprachen.«
»Wie Gott will!« sagte sie mit einem tiefen Seufzer und entließ ihn so wehmütig und mütterlich grüßend, daß der junge Mann in einer frommen Führung aus dem Hause ging.
Seine Schritte führten ihn in eine der Alleen, wo er einsam und erschöpft nach einem Ruheplätzchen suchte. Da glänzte es golden durch die Gebüsche zur Linken, und betroffen erkannte er die Reiterstatue, vor welcher er einst mit so wunderbaren Aussichten gestanden hatte. »Ja, ich erkenne dich wieder, den ersten Zeugen meiner Täuschungen!« rief er, dem Bilde den Rücken wendend, »du hast mich gelehrt, daß nicht alles Gold ist, was glänzt. Auch du bist nur übergoldet. Du hast mich von der echten Liebe, von dem wahren Glück hinweggeschwatzt. Mit leichter Seele sag' ich dir jetzt Lebewohl!«
Er wurde in seinem Selbstgespräche durch das Menschengewühl gestört, das jetzt in dichtem Strome von dem See dahergeflutet kam, um das Feuerwerk zu sehen. Er zog sich an den Rand der Allee zurück und ließ Welle um Welle an sich vorüberziehen, den Blick schärfend, womit er in der anbrechenden Dunkelheit die Gesichter musterte, um die sehnlich Gesuchte herauszufinden.
Auf einmal fühlte er sich an der Hand ergriffen. »Sie hier?« rief eine bekannte weibliche Stimme im Ton des höchsten Erstaunens.
Er sah sich um. Es war Amalie. Wenig fehlte, so wäre er ihr vor der ganzen Menschenmenge um den Hals gefallen. Mit geflügelten Worten sagte er ihr, wie er sie zu Hause verfehlt und hier oben gesucht habe, und wie er den Verstand des Zufalls segne, der sie ihn hier so unversehens finden lasse. »Sie müssen gleich mit mir nach Illingen!« rief er.
»Helfen Sie mir nur erst meinen Mann suchen,« erwiderte sie. »Wir haben einander im Gedränge verloren. Wie froh bin ich, Sie in diesem Menschenschwall zum Beschützer zu haben!«
Er wollte sich weiter erklären, da sah er seinen ehemaligen Intendanten im Gespräch mit dem Stallmeister der Akademie hart an sich vorüberkommen. Im gleichen Augenblick hatte ihn auch Herr von Seeger erkannt, ließ aber seinen Gruß unerwidert, indem er mit einem langen fremden Blick auf ihm verweilte, und ging dann zögernd weiter, sich immer wieder nach ihm umsehend, wie um ihn nicht aus den Augen zu lassen.
»Da steh' ich noch auf dem schwarzen Register,« dachte Heinrich lächelnd. »Herr von Seeger hat mir mit den Augen sein Tremblez zugerufen, und wird nicht säumen, Serenissimo die Anwesenheit des Verworfenen zu melden.«
Amalie blickte ihn fragend an, auch ihr war das Benehmen des Intendanten aufgefallen. Heinrich wollte ihr soeben Bescheid geben, als er die ganze Akademie auf sich zuströmen sah. Die jungen Leute kamen nach der gewohnten Ordnung abteilungsweise, jede Abteilung von ihren Offizieren und Aufsehern begleitet, die Allee heranmarschiert, um sich gleichfalls von der beendigten Jagd zum Feuerwerke zu begeben. »Kommen Sie,« sagte er, »ich möchte jetzt nicht mit Bekannten zusammentreffen.«
Er bot ihr den Arm und führte sie in die Seitenallee, wo er, weniger belästigt, obwohl es auch hier an eilenden Menschen nicht fehlte, den Weg nach dem Schlosse mit ihr fortsetzte.
»Was ist das?« sagte Amalie, besorgt über die Schulter sehend. »Herr von Seeger winkt beständig seinen dienstbaren Geistern. Sehen Sie, da kommt einer herbeigeflogen. Er spricht mit ihm und zeigt dabei mit den Augen nach Ihnen.«