
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
So weit hatte Heinrich sich mit einer ruhigen Beobachtung begnügt, bei dieser Aufforderung aber begann er an sich zu denken und sich nach einem Kuvert umzusehen. Der Herzog hatte doch wohl nicht die Absicht, ihn unter die Eleven zu setzen und mit diesen speisen zu lassen? Aber auch hier war kein leerer Platz zu erblicken. Endlich geriet er auf die Vermutung, der Herzog werde sein Diner nachher ebenfalls in der Akademie halten und ihn dazu ziehen, ein Gedanke, welcher seinem Stolze tröstlicher klang als seinem Magen.
Er suchte seine Augen wieder zu beschäftigen und musterte die einzelnen Gesichter der speisenden Jugend, wozu er, da ihn seine Umgebung in die Mitte des Saales gezogen hatte, hinlängliche Gelegenheit fand. Ein lautes Gelächter an den Tischen der Jüngsten machte ihn aufmerksam; die Ursache davon blieb nicht lang verborgen, sie lief von Tisch zu Tisch, und so hörte er bald darauf in seiner Nähe erzählen, der Herzog habe den Kleinen Apfelküchlein vorsetzen lassen, welche sie schnell angebissen, aber noch schneller wieder weggeworfen, weil dieselben mit Werg und Roßhaar gefüllt gewesen seien. Alles blickte lachend dorthin; es war lustig anzusehen, wie sie arbeiteten, den Unrat wieder aus dem Munde herauszuspinnen. Eben trug man ihnen neue Schüsseln vom echten Gericht auf, welche zum Ersatze dienten; sie machten keine Miene, sie abzuweisen, und hieben tapfer ein. Franziska näherte sich ihnen und sprach ihnen zu; der Herzog stieg mit dem Markgrafen, immer einen Schritt voraus, im Saale auf und ab und führte ein lebhaftes Gespräch, von dem die Zuschauer, wenn die Fürsten an ihnen vorüberkamen, jedesmal einige Worte erhaschten. »Das muß ich sagen,« hörten sie den Markgrafen einmal sprechen, »Eurer Durchlaucht Projekte sind sehr gut gelungen« – »Bis auf eins, Herr Nachbar!« versetzte der Herzog schnell, »Euer Liebden wissen ja, was uns beiden mißlingt!« – Der Markgraf wurde feuerrot, und die Zuschauer sahen einander mit verbissenem Lachen an; denn jedermann wußte, was Karl damit sagen wollte. Der Markgraf von Baden hatte nämlich früher einmal die mißmutigen Worte, die natürlich nicht verschwiegen blieben, ausgestoßen: »Ich gebe mir alle Mühe, mein Land emporzubringen, und der Herzog von Württemberg läßt sich's sauer werden, das seinige zu ruinieren, aber keinem von uns beiden gelingt's!« – Eine Äußerung, die er bei Karls gutem Gedächtnis notwendig wieder einmal zu verdauen bekommen mußte.
Der Herzog verwickelte ihn darauf in ein Gespräch mit Franziska, ließ ihn bei ihr stehen und ging allein mit Späherblicken im Saale hin und her. Heinrich glaubte, er werde ihn jetzt anreden, und setzte sich, als der Herzog plötzlich auf ihn zuschoß, in Positur; es galt aber nicht ihm, sondern einem Tische, wo das scharfe Auge des Stifters irgend eine Unordnung bemerkt haben mußte. »Warum eßt ihr nicht, meine Söhne?« fragte er.
»Eure Durchlaucht, das Wildbret hat nicht den besten Geruch,« erwiderte einer der Zöglinge mit ruhigem und bescheidenem Ton.
»Laßt mich's versuchen,« befahl der Herzog und kostete die Speise in eigener höchster Person. »Fi Teufel!« rief er, »das ist ein scheußliches Fleisch! Wo steckt der Küchenmeister?«
Der Unselige war bald zur Stelle und wurde mit einem zornig spöttischen Ton angefahren: »Hör Er, ich sag' Ihm! kann Er kein besser Fleisch auftischen? Wozu hat Er denn Seine Besoldung? Wozu hat Er den großen Abtrag von der Tafel?« – Er faßte den Mann, der einen neuen Rock anhatte, schärfer ins Auge und fuhr fort, indem er ihm auf das Kleid deutete: »Das ist doch lauter Hasenbalg! Alles vom Abtrag! Will Er das Beste schon vorher verschachern? Sieht Er, damit Er sich's merkt und Ihm nichts mehr derart passiert, so bringt Er augenblicklich ander Fleisch, und heut abend trägt Er für diesen ganzen Tisch Göckel auf, einen à Person, versteht Er? Auf Seine Kosten. So, jetzt kann Er gehen.«
Der Küchenmeister entfernte sich niedergeschlagen, der Herzog aber wandte sich zu den jungen Leuten, denen er eine so glänzende Genugtuung verschafft hatte: »Warum habt ihr denn nicht geklagt?« fragte er, »ich war ja zugegen, und ihr werdet mich kennen.«
»Wir wollten vor den fremden Herrschaften kein Aufheben machen,« antwortete einer, den Heinrich an seinem roten Haar und seiner näselnden Stimme sogleich für den Clavigo von gestern abend erkannte.
»Brav, meine Kinder!« versetzte der Herzog sehr freundlich, »das macht euch alle Ehre; laßt euch denn heut abend die Göckel recht wohl schmecken!«
Er ging wieder auf und ab; Heinrich folgte ihm mit den Blicken und beobachtete seinen raschen stolzen Gang. Hierauf fiel sein Auge auf ein anderes Schauspiel; in seiner Nähe, seitwärts von einer der Tafeln, stand ein Zögling, der keinen Anteil an der Mahlzeit nahm, mit niedergeschlagenen Augen; ein zusammengefaltetes Papier ragte ihm aus der Uniform. Die Zuschauer, wenn sie an ihm vorüberkamen, betrachteten ihn halb mitleidig, halb neugierig, auch der Markgraf hatte vorhin im Auf- und Abgehen einen verwunderten Blick auf ihn geworfen. Unser Freund brauchte sich nicht lang zu besinnen, um zu erraten, daß dies irgend eine Strafe bedeuten sollte; um darüber aufgeklärt zu werden, sah er sich unter den Zuschauern nach einem um, den er befragen könnte. Nicht weit von ihm stand ein junger Mensch mit beinahe weißen Haaren und einem runden Gesicht, aus dem eine unbeschreibliche Kindlichkeit sprach; er starrte wie verloren nach einem der Tische hin. Heinrich redete ihn an, er fuhr etwas zusammen und gab ihm auf seine Frage mit schüchternem Tone Bescheid: »Ja, es ist allerdings eine Strafe, der junge Mann hat ein Billett erhalten und muß nun karieren.«
»Was ist denn das, ein Billett?«
»Wenn einer etwas pekziert hat,« wurde ihm entgegnet, »so schreibt einer der Vorgesetzten das Vergehen auf ein Blatt Papier, das ihm zwischen die Weste gesteckt wird, um es bei Gelegenheit dem Herzog zu überreichen und von diesem die weitere Strafe zu erwarten.«
»Das ist ein lustiger Brauch,« sagte Heinrich, »das kommt mir vor wie auf den alten Bildern die Figuren mit einem Zettel im Mund, wodurch sie den Beschauern anzeigen, wer sie sind und was sie wollen.«
Sein Nachbar lachte zutraulich und versetzte dann: »Es ist aber doch hart für den armen Schelm, gerade heute, vor einem so hohen Besuch, an den Pranger gestellt zu werden.«
Er schrak heftig zusammen, denn eben traf ihn das Falkenauge des Herzogs, der in diesem Augenblicke vorüberschritt. Dieser schien etwas von seinen Worten vernommen zu haben, denn er ging stracks auf den Missetäter zu und fragte: »Womit hat Er diese Ehre verdient?«
In militärischer Haltung, aber mit Angstblicken, zog der Angeredete sein Billett aus dem Busen und überreichte es. Karl schlug es auseinander und las laut: »Hat zu dem Eleven von Wolzogen gesagt:
'n Kavalier, so dumm und stolz,
Schnitz' ich aus jedem Scheite Holz!«
Eine tiefe Stille entstand in dem Saal; die Magnatentafel, für welche dieser Auftritt eine Lebensfrage war, blickte aufmerksam herüber und erwartete gespannt den Richterspruch.
»Hat Er schon mehr Billette bekommen?« fragte der Herzog.
»Es ist das erste, Ihro Durchlaucht,« erwiderte der Delinquent aufatmend.
»Nun, so laß mal sehen!« rief der Herzog und winkte einen Aufwärter herbei, der nach wenigen Augenblicken mit einem mächtigen Holzscheit aus der Küche zurückkam. »Wenn Er ein solcher Künstler ist, wie Er sich berühmt,« fuhr der Herzog fort, »so leist Er jetzt, was Er geprahlt hat, und schnitz Er mir einen Kavalier; dann soll Ihm die Strafe erlassen sein.«
Der Herzog hatte dies mit einer angenommenen Strenge gesagt, gegen welche kein Widerspruch galt; dem Jüngling wurde ein großes Transchiermesser überreicht, und er mußte wohl oder übel Hand ans Werk legen. Der Speisesaal erbebte unter dem Gelächter, das an allen Tischen entstand; der Markgraf, der nähergekommen war und die Prozedur mit angehört hatte, hielt sich den stattlichen Bauch, Franziska aber trat freundlich herzu und sprach: »Arbeite getrost, mein Sohn; Seine Durchlaucht werden zufrieden sein, wenn's nur ähnlich ausfällt.«

»Ihr' Durchlaucht, der Eleve Schiller hat da eine Anmerkung gemacht.«
Alles blickte unter wiederholtem Gelächter auf die vergeblichen Bemühungen des neuen Pygmalion. Als es endlich still wurde, hörte Heinrich eine näselnde Stimme halblaut sagen: »Ich müßte doch lachen, wenn er einen herausbrächte.« – Nun ging das Gelächter mit verdoppelter Stärke los und lief nach und nach, sowie die Ursache bekannt wurde, an allen Tischen fort; die Kavaliere wandten sich unwillkürlich mit einiger Ängstlichkeit nach dem Bildschnitzer herum. Heinrichs Auge suchte den kecken Sprecher, und siehe, es war wiederum Clavigo! Er saß ganz ruhig da, ein leichtes Lächeln spielte um seinen Mund, und die Augen glitten mit einem schlauen Blinzeln über die Lacher hin.
Der Herzog, der sich eben in einem entfernteren Teil des Saales befand, war mit drei Schritten zur Stelle und fuhr auf einen vorübergehenden Aufseher los, einen dicken Kegel, dessen faltenreiches und borniertes Gesicht unserem Helden schon vorhin aufgefallen war. »Nies!« rief er. »Ich sag', Nies, was gibt's hier?«
»Ihr' Durchlaucht,« antwortete dieser, »der Eleve Schiller hat da eine Anmerkung gemacht.«
»Was für eine Anmerkung?« fragte der Herzog rasch.
»Er hat gesagt,« versetzte Nies mit der größten Trockenheit, »er müßte doch lachen, wenn er einen herausbrächte.«
Der Herzog verzog den Mund ein wenig und erhob den Finger gegen seinen Zögling. »Schiller, nicht naseweis!« rief er. Dann fuhr er gegen den Aufseher herum und sagte mit einem Blick auf den Markgrafen: »Einen wie Er, nicht wahr? Wer heißt euch denn heute diese Prangerszene aufführen?«
»Ihr' Durchlaucht!« sagte Nies, hoch und heilig beteuernd, »Ihr' Durchlaucht halten zu Gnaden, der Herr Intendant haben es so befohlen.«
»Ach was!« stieß der Fürst heraus, – »hol Er den Intendanten.«
Ein hagerer Offizier mit einem Orden eilte herbei. »Wozu der Eklat, Herr von Seeger?« redete ihn der Herzog verdrießlich an.
»Eure Durchlaucht,« versetzte der Intendant, »man hat mir nichts von dem hohen Besuch gemeldet;« und der Herzog, da ihm das Ziel seines Unmuts immer weiter entfloh, ließ diesen fahren und ging mit dem Intendanten eine Weile auf und ab, indem er ihm Aufträge erteilte und einige flüchtig mit dem Bleistift geschriebene Notizen übergab; denn die Akademie war gewissermaßen zugleich sein geheimes Kabinett.
Nach einer Weile ließ der Herzog den Intendanten stehen und kam zu dem Akademisten zurück, der noch immer eifrig mit seiner Schnitzelei beschäftigt war und nur von Zeit zu Zeit aufblickte, ob ihm seine Strafarbeit noch nicht erlassen sei. – »Wie geht's?« rief er ihm zu, »ich glaube, darin ist Er dem größten Poeten ähnlich, daß Seine Prosa nicht hält, was Seine Verse versprochen haben. Ei, sieh doch!« fuhr er fort, indem er die Arbeit näher betrachtete, »einen leidlichen Kopf hat der Schelm bereits zuwege gebracht, den man mit einigem Puder, einem Zopf und einem Ordensband um den Hals ziemlich à la cavalier zustutzen könnte.« – Er trat der Kavalierstafel näher und sagte: »Merken Sie sich's, meine Herren! so unartig der Einfall von ihm war und so wenig er auf denjenigen paßte, den er beleidigen wollte, so entnehmen Sie sich doch daraus die Lehre, daß ein hohler Kopf, bürgerlich oder adelig, nicht mehr wert ist als ein Stück Holz, daß Geburts- und Rangstolz jedem Vernünftigen lächerlich erscheinen muß, und daß nur das Verdienst den Menschen adelt.« – Bei diesen Worten ließ er einen scharfen Blick über die Tafel hinlaufen und wandte sich dann an einen jungen Mann von angenehmem und bescheidenem Aussehen, der die ganze Zeit über in der peinlichsten Verlegenheit unter seinen adeligen Tischgenossen gesessen hatte. »Ce n'est pas à vous que j'en veux, mon cher Wolzogen!« sagte er gütig zu ihm. Zugleich erließ er dem unfreiwilligen Künstler den Rest seiner Arbeit. »Laß Er Seine Kunst nach Brot gehen,« sagte er, indem er ihn zu Tische schickte.
Alles dies war rascher und kürzer vor sich gegangen, als sich erzählen läßt; der Herzog ging auf den Markgrafen zu und entschuldigte sich: »Euer Liebden verzeihen mir, daß ich Sie abandonniert habe; man nennt mich bekanntlich einen Schulmeister, und ich muß meine beste Zeit an diese ungezogene Jugend verlieren.«
»Es ist eine liebe und muntere Jugend,« versetzte der Markgraf freundlich, »und die Beschäftigung mit ihr muß Euer Liebden ein belohnendes Gefühl gewähren.«
»Ja, ja!« entgegnete Karl achselzuckend, »aber man hat auch viele Last davon.« – Der Ton, mit dem er dieses sagte, widersprach den Worten und bewies, wie sehr er sich in seinem Elemente fühlte. Er nahm seinen Gast bei der Hand und führte ihn einem Kredenztische zu, der indessen mit Erfrischungen besetzt worden war.
Durch den eben vorgefallenen Auftritt war Heinrichs Aufmerksamkeit dem unglücklichen Dilettanten von gestern zugewendet worden, und er begann zu ahnen, daß hinter dem schlechten Schauspieler wenigstens ein guter Kopf stecken könnte. Er rückte langsam aufwärts, bis er ihm fast gerade gegenüber zu stehen kam, und betrachtete seine Gestalt mit forschenden Blicken. Was ihm zuerst auffiel, war unter einem buschigen dunkelroten Haar die breite schöngewölbte Stirne, die man, wenn man auch nur im entferntesten an Lavater glaubte, für einen Thron von mächtigen Gedanken halten mußte. Sie hatte, sowie die dünne, weiße, sehr gebogene Nase, etwas Felsiges und glich einem Vorgebirge, unter welchem die Augen wie in einer sicheren Bucht verwahrt lagen; die halbgeschlossenen Augenlider hatten eine krankhafte Röte; die Augenbrauen, von derselben Farbe wie das Haupthaar, liefen in einem kühnen Bogen über den Rand der Stirne und bildeten an der Nasenwurzel eine Art von dem, was man Rätzel heißt. Hierdurch kam etwas Eigensinniges in den oberen Teil des Gesichts, der vielleicht abstoßend schroff erschienen wäre, wenn nicht der feine Mund, um den ein Zug von grenzenloser Güte spielte, und die dichten Sommersprossen, welche den blassen Wangen eine kindliche Naivität gaben, diesen Eindruck wieder gemildert hätten. Dazu kam noch ein langer, schwanenweißer Hals, den die Binde kaum zur Hälfte bedecken konnte, und durch den die ganze Gestalt einen rührenden Anhauch edler Jungfräulichkeit empfing. Aber der vorherrschende Charakter, zu dem die vorspringende gewölbte Brust beitrug, war Stolz und Selbständigkeit, auffallende Eigenschaften an einem Jüngling, der, obgleich er die meisten der neben ihm Sitzenden an Reife übertraf, doch höchstens neunzehn Jahre zu zählen schien. Der Gegenstand dieser Beobachtung war indessen aufrecht dagesessen und hatte, ohne zu speisen, wie sinnend vor sich hin gesehen; doch schien er dieselbe bemerkt und ruhig geduldet zu haben, denn auf einmal schlug er, als ob sie ihm jetzt lästig würde, zwei blitzende Augen auf und warf einen so scharfen Blick auf seinen Physiognomen, daß dieser unwillkürlich die seinigen ablenkte und sich aus Verlegenheit die Struktur des Saales zu mustern beschäftigte.
Während er diese Diversion machte, trat jener junge Fremde wieder zu ihm und redete ihn mit einer bescheidenen Vertraulichkeit an. »Sie sind gewiß zum ersten Male hier,« sagte er, »ich schließe dies aus dem Erstaunen, womit Sie diesen magnifiken Saal betrachten. Er ist hundertneunzig Schuh lang und achtunddreißig breit, gerade so groß wie der Rangiersaal, der eine Etage weiter unten liegt und aus dem die Eleven in Reih und Glied hierher marschieren. Sehen Sie einmal diese gekuppelten Wandsäulen im ionischen Stil, es sind zweiundachtzig an der Zahl; kann man eine schönere Arbeit sehen? Die Büsten, die Sie zwischen ihnen erblicken, sind die Bildnisse der größten Förderer der Künste und Wissenschaften –«
»Ist der Herzog auch darunter?« fragte Heinrich lächelnd.
»Der hat seine Statue besonders, sehen Sie dort unten in der Mitte; bei dieser wird das Gebet verrichtet; und außerdem hängt in jedem Lehr- und Schlafsaal sein Bild mit den Attributen der betreffenden Wissenschaft. – Und nun betrachten Sie die schöne Galerie, die von den Säulen getragen wird; die prächtige Uhr, die über ihr angebracht ist, zeigt uns an, daß das Essen bald zu Ende sein wird. Aber das Beste kommt zuletzt, das sind die herrlichen fünf Plafonds, die von Guibal gemalt sind; zwei junge talentvolle Maler, Heideloff und Hetsch, die der Herzog in der Akademie erzogen hat, haben daran mitgearbeitet. Neben diesem Saale,« fuhr der gefällige Erklärer fort, ohne unserem Freunde Zeit zu längerer Betrachtung zu lassen, »ist ein runder Tempel, welchen vierundzwanzig freistehende und vierundzwanzig gekuppelte Wandsäulen im korinthischen Stile schmücken; die drei Türen, die Sie dort sehen, führen dahin; hier hält gewöhnlich der Herzog seine Tafel, denn er speist, wie Sie vielleicht wissen, äußerst selten im Schlosse drüben.«
»Sagen Sie mir,« unterbrach ihn Heinrich, »wer sind denn die großen Herren, die dort zuoberst tafeln? Wenn sie nicht so jung aussähen und die Uniform der Akademie trügen, so müßte man sie für Staatsmänner ersten Ranges halten. Sind es etwa Prinzen, die hier studieren?«
»Nein, das sind die Chevaliers.«
»Von welchem Orden?«
»Vom akademischen. Wer in einer Prüfung vier Preise erhalten hat, wird in diesen Orden aufgenommen und mit der schweren goldenen Medaille dekoriert; wer es aber gar zu acht Preisen auf einmal gebracht hat, wird Grandchevalier mit dem Großkreuz um den Hals und dem Stern auf der Brust.«
»Erhalten auch bürgerliche Eleven diesen Orden?«
»Jawohl, mehr als adelige!«
»Und werden dadurch förmlich dem Adel gleichgestellt?«
»Noch höher! Sie sehen ja, daß der Chevalierstisch über dem Kavalierstisch rangiert. Freilich bei dem Austritt aus der Anstalt hat die Herrlichkeit ein Ende; doch bleibt sie immerhin von Einfluß auf die künftige Karriere.«
»Und den größten Einfluß muß sie auf die gesellschaftlichen Meinungen und Vorurteile ausüben!« sagte Heinrich lebhaft. »Zwar mag das Wettrennen nach den meisten Nummern seine Schattenseite haben, aber in den bestehenden Verhältnissen weiß ich doch kein wirksameres Mittel, den schauderhaften Kastengeist unserer Tage in den jungen Gemütern an der Wurzel zu erschüttern. Fürwahr, ich muß diese Einrichtung bewundern, die den Junker und selbst den Prinzen unter das Verdienst des Rotüriers erniedrigt!«
»Das ist denn doch nicht so ganz der Fall,« fiel sein Nachbar ein. »Wenn sich Prinzen in der Anstalt befinden, was selten ausbleibt, so werden Sie ganz zu obenan, über der Ordens- und der Adelstafel, einen besonderen Prinzentisch erblicken. Indessen haben die Chevaliers doch den Vorzug, daß sie zwischen Fürsten- und Edelmannssöhnen den mittleren Rang behaupten. Auch genießen sie gleich den beiden anderen Klassen die Ehre des Handkusses; denn die bürgerlichen Eleven, die es zu keiner solchen Auszeichnung gebracht haben, dürfen nur den durchlauchtigsten Rockflügel küssen.«
Heinrich lächelte still vor sich hin. »Seltsame Dämmerung des Jahrhunderts,« sagte er zu sich, »worin Großartiges und Kleinliches, Bildung und Herkommen, Aufklärung und Vorurteil miteinander streiten! – Sie scheinen hier sehr unterrichtet zu sein,« bemerkte er gegen seinen Nachbar.
»Ich komme häufig in die Akademie,« versetzte der junge Mann mit einiger Lebhaftigkeit, »eigentlich ist es die Musik, welche –«
»Nun, wie gefällt Ihm meine Akademie?« fragte der Herzog, der auf einmal zwischen ihnen stand. Der Redner entwich mit sichtbarem Schrecken, auch Heinrich fühlte sich durch die unerwartete Anrede ein wenig außer Fassung gebracht und mußte sich zusammennehmen, um etwas Schickliches zu antworten. Der Eindruck, den die Großartigkeit des Lokals, die überall herrschende Ordnung, das Persönliche, das, bei aller Majestät, in dem Verhältnis des Landesfürsten zu seinen freimütigen Schülern obwaltete, und endlich der Eindruck, den die hübsche halb militärische Kleidung der Zöglinge im Vergleich mit den groben, schwarzen Kutten der Klosterschüler auf ihn machte, ließ ihn die schmeichelhafte Rede, die ihm durch die Macht der Umstände in den Mund gelegt war, mit Überzeugung und jener nachdrücklichen Lebendigkeit vortragen, welcher auch ein mißtrauischer Menschenkenner Glauben schenkt.
»Es soll mich freuen, wenn meine Bemühungen den öffentlichen Beifall finden, erwiderte der Herzog mit herablassender Freundlichkeit.
Heinrich wollte etwas darauf sagen, der Herzog aber unterbrach ihn und fuhr fort: »Ich muß zu meiner Freude sagen, die Akademie schreitet vorwärts, sie erhält mit jedem Jahre neuen Zuwachs, und ich muß von Zeit zu Zeit auf Erweiterungen denken. – Ja, was ich sagen wollte, Er hat hauptsächlich Philosophie studiert? – nicht wahr?«
»Wie ich Eurer Durchlaucht schon früher sagen durfte,« erwiderte er, »so hat mich die Philosophie mit ihren Nebenzweigen mehr anzuziehen gewußt als –«
»Gut,« unterbrach ihn der Herzog, »es ist eine schöne Wissenschaft um die Philosophie, sie macht den Menschen zu dem, was er eigentlich sein soll, sie gibt ihm eine allgemeine durchgängige Bildung, so daß nachher alle einzelnen Wissenschaften und Kenntnisse sich in freiem Spiel bei ihm entwickeln können. Doch ist es nicht hinlänglich, sich der Philosophie allein zu widmen; sie ist mehr Vorbereitung, Propyläe; ich sage, sie macht den Menschen zu dem, was er sein soll, zu einem Menschen; allein es ist nicht genug, ein Mensch zu sein, sondern jeder hat seine eigene Bestimmung, der er nachkommen muß: zum Beispiel, ich muß regieren, und ihr anderen müßt eure Untertanenpflicht erfüllen; das sind Sachen, die vielfache Kenntnisse erfordern, über die man insbesondere nachdenken muß, namentlich das erstere; jeder muß einen Beruf haben – (wenn er mir nur endlich einen anwiese, dachte Heinrich) – jeder muß der Welt durch eine zweckmäßige Anwendung seiner Talente nützlich zu werden suchen, und hierfür reicht die Philosophie nicht aus.«
Heinrich nahm diese Lehre mit einer tiefen Verbeugung hin.
»Was sagt Er dazu, Schiller?« rief der Herzog über den Tisch hinüber.
Der Eleve richtete sich empor, drückte seine Augen zu dem Blinzeln zusammen, das wir bereits gesehen haben, und entgegnete: »Eure Durchlaucht erlauben mir, Dero hohen Worten gemäß, meine eigene Bestimmung im Auge zu behalten und als Mediziner zu antworten. Als solcher finde ich die Ansprüche, welche die Philosophie gegenwärtig macht, zu hoch; sie tut, als wenn die Erschaffung und Erhaltung der Welt allein ihre Sache wäre, und vergißt ganz, daß die Welt bestand, noch ehe es Philosophen gab, und daß sie auch ohne solche bestehen kann, freilich durch so gemeine Mittel, die ein anderer als ein Mediziner nicht zugeben wird, nämlich durch Hunger, Durst und Liebe.«
»Was weiß Er von der Liebe!« rief der Herzog spöttisch, konnte aber den wohlgefälligen Blick, den ihm sein witziger Zögling ablockte, nicht ganz verbergen.
Heinrich wollte sich rechtfertigen, aber der Herzog ließ ihn nicht zu Worte kommen. »Wie steht es denn gegenwärtig mit der Philosophie in Tübingen?« fragte er das dritte Mal seit jenem Jagdabenteuer. »Was macht denn unser alter Ploucquet?«
»Er beschäftigt sich noch immer mit der Leibnizischen Monadologie.«
»Das ist sehr vernünftig; man muß nicht immer selbst etwas erfinden wollen, sondern lieber einem bedeutenden Vorgänger folgen. Leibniz war ein großer Mann.«
Dieses mit imposanter Miene vorgetragene Axiom wußte Heinrich nur mit einer Verbeugung zu beantworten.
»Stellt der Ploucquet die Ewigkeit immer noch unter dem Bild eines Hundes und eines Hasen dar, die einander unaufhörlich nachlaufen?« fragte der Herzog weiter.
»Er bedient sich dieses Gleichnisses noch jährlich, seit er die Gnade gehabt, diesen Gegenstand vor Eurer Durchlaucht in der Aula zu traktieren.«
»Ja, es wurden damals mächtige Reden gehalten,« sagte der Herzog lachend. »Jetzt, hoff' ich, wird meine Carolina nächstens der Eberhardina die Stange halten können. Was ist denn gegenwärtig das Neueste in der Philosophie?«
»Man beginnt nach und nach,« erwiderte unser Held, »von der Ontologie zurückzukommen, namentlich seit Hume einen so großen Riß in die Metaphysik gemacht hat; das Neueste, was sich bemerklich macht, ist eine Wendung gegen die Psychologie, welche, wenn ich nicht sehr irre, einer Schrift des Abbé von Condillac zugeschrieben werden muß, obgleich die philosophische Stimmung in Deutschland sich schon seit einigen Jahren nach dieser Seite hinzuneigen schien.«
»Wir müssen machen, daß wir auch einmal wieder einen deutschen Philosophen bekommen,« versetzte Karl, »man muß nicht alles dem Ausland verdanken wollen.« – Er blieb einen Augenblick überlegend stehen und spielte mit seinem Stöckchen. – »Komm Er doch geschwind mit mir!« rief er plötzlich, ging schnell nach dem Chevalierstisch, neben welchem die Professoren versammelt standen, und näherte sich einem noch jungen, liebenswürdig aussehenden Manne. »Da will ich Ihn dem Professor Abel vorstellen,« sagte er. – »Abel, examinier Er mir doch den jungen Philosophen da, aber in aller Geschwindigkeit, und sag Er mir, ob Er ihn zum Gehilfen brauchen kann; Er weiß, wir müssen die Fakultät erweitern.«
Der Professor verbeugte sich, betrachtete den Vorgestellten mit freundlich forschenden Blicken und richtete einige Fragen an ihn, nach deren Beantwortung er dem Herzog seinen Bericht abstattete. »Also, richtig?« sagte dieser und fuhr auf Abels bejahende Verbeugung gegen Heinrich fort: »Komm Er heut abend präzis um sechs Uhr zu mir ins Schloß, dann soll Er Seine Bestallung als akademischer Lehrer empfangen.«
Bei diesen Worten sah sich der Herzog um; die Zöglinge hatten abgespeist und machten ungeduldige Bewegungen. Er gab einen Wink, unter donnerähnlichem Geräusche wurden die Stühle gerückt, und die Jugend marschierte nach Abhaltung des kommandierten Gebets hinaus, wie sie hereingekommen war. Die drei Türen zu dem Tempel öffneten sich und ließen eine gedeckte Tafel erblicken. Der Markgraf, der den Speisesaal verlassen hatte, erschien mit seiner Suite, der Herzog ging auf ihn zu, und Heinrich sah im Abgehen eben noch, wie sich die Pforten zu dem Mahl der oberen Götter für ihn verschlossen.
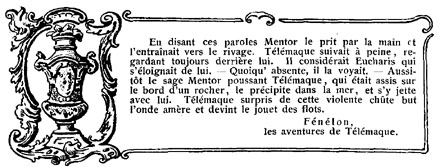
En disant ces paroles Mentor le prit par la main et
l'entraînait vers le rivage. Télémaque suivait à peine, regardant
toujours derrière lui. Il considérait Eucharis qui
s'éloignait de lui. – Quoiqu' absente, il la voyait. – Aussitôt
le sage Mentor poussant Télémaque, qui était assis sur
le bord d'un rocher, le précipite dans la mer, et s'y jette
avec lui. Télémaque surpris de cette violente chûte but
l'onde amère et devint le jouet des flots.
Fénélon,
les aventures de Télémaque.
Während unser Freund durch das Treppenhaus hinunterstieg, kreuzten sich verschiedene Gedanken in seinem Kopfe. Er war noch etwas betäubt durch die schnelle Entscheidung, die sein Schicksal erhalten hatte. Obgleich er wußte, daß der Herzog zu raschen Resolutionen geneigt sei, so war er doch von einem bescheidenen Staunen befangen. Dabei erfüllte ihn der Gedanke an den Verkehr mit so manchen aufgeweckten jungen Geistern, die wohl, wie der Darsteller des Clavigo, der Philosophie nur im Scherze den Krieg erklärten, die Hoffnung, etwas zu der Entwicklung dieser vielversprechenden Jugend beitragen zu können, mit einer lebhaften schönen Freude; er träumte sich als einen Prometheus, der den Feuerfunken in die aufkeimenden Seelen wirft und den entzündeten zu höherer Glut entfacht. Mitten unter diesen freundlichen Phantasien trat ihm das Bild seines Mädchens vor die Seele und erfüllte ihn mit unaussprechlicher Fröhlichkeit; er lachte hell auf über die häuslichen Freuden, die einem Philosophen blühen sollten, und malte sich's schon aus, wie er nach beendigtem, etwas trockenem Vortrag vom Katheder weg dem Weibe seiner Liebe in die Arme fliegen und sich an ihren Lippen erquicken werde. Die Abneigung des Pfarrers gegen die Residenz hoffte er durch vollwichtige Gründe zu beseitigen, umsomehr, als ihm jetzt kein Abfall mehr von der Wahl seines Berufes vorgeworfen werden konnte; er hatte ja nur, so meinte er, das Lehramt in einer höheren und seinen Neigungen mehr angemessenen Form ergriffen. Zuletzt aber behielt, wie es sich bei dem schnellen Durcheinanderwühlen der Gedanken oft ereignet, einer die Oberhand, der seltsam gegen die übrigen abstach. Heinrich war nämlich, eben als er sich zum Fortgehen aus dem Speisesaal anschickte, noch Augenzeuge eines Beispiels von der schnellen und prompten Justiz des Herzogs geworden. Die Zöglinge waren im Abmarschieren an dem Marmortischchen, wo der Markgraf, vielleicht an eine frühere Mittagsstunde gewöhnt, etwas zu sich genommen hatte, vorbeidefiliert; einer derselben schien von irgend einem seltenen Leckerbissen unwiderstehlich gereizt zu sein; es war eben jener Kleine, den der Herzog dem erlauchten Gaste als seinen Mutwilligsten vorgestellt hatte; er blickte behutsam um sich, ob er sich keiner Beobachtung eines Vorstehers aussetze, und als er die Gelegenheit günstig fand, eskamotierte er mit seltener Geschicklichkeit den Gegenstand seiner Begier in die Tasche. Heinrich hatte den Vorgang mitangesehen und still für sich gelächelt, aber das Auge eines anderen, das, wie die Vorsehung, überall gegenwärtig war, hatte den Raub ebenfalls bemerkt; der Herzog trat freundlich näher, als wollte er seine Schar noch einmal übersehen, und als der Taschenspieler an ihm vorüberzog, klatsch! hatte er eine Ohrfeige, von so guter Währung, als die untadelhaften Münzen, welche Karl prägen ließ. Diese eigenhändige, allerhöchste Ohrfeige nun war es, was unserem Helden nicht aus dem Sinn kommen wollte und alle näherliegenden Gedanken nach und nach verdrängte; immer sah er noch den Herzog vor sich stehen, wie er mit majestätischer Ruhe ausholte und das hartgebackene Konfekt dem nichts Arges ahnenden Sünder an den Kopf sausen ließ.
In dieser Träumerei unterbrach ihn ein Akademist, der aus einem Seitengang auf ihn zueilte; es war der junge Tiroler, den er von gestern abend her kannte; er schien sich aus seiner Schlachtreihe weggeschlichen zu haben, um eine Unterredung mit Heinrich zu suchen.
»Sie haben mit dem Herzog gesprochen,« – begann er.
»Sei'n Sie ruhig,« fiel ihm Heinrich lächelnd ins Wort, »es ist nichts von Ihnen vorgekommen, wiewohl ich Sie jetzt vor mir warnen muß; reden Sie behutsam mit mir, denn Seine Durchlaucht haben mich soeben zum akademischen Lehrer zu ernennen geruht.«
Der freiheitliebende Tiroler sah ihn fast mitleidig an und sagte in einem gedehnten Tone: »So? ich gratuliere.«
»Und wenn die Künstler,« fuhr Heinrich freundlich fort, »es nicht verschmähen, bei den Philosophen in die Schule zu gehen, so können wir recht gut miteinander zu stehen kommen.«
»Ja, wenn's g'wiß ist!« war die naive Antwort. »Wollen sehen, was die Zeit bringt,« sagte der junge Mensch nach einer Pause und empfahl sich schnell.
Heinrich eilte gleichfalls, die Akademie zu verlassen; er dachte nicht mehr daran, für seines Leibes Nahrung zu sorgen, sondern begab sich schleunigst zu seinen Verwandten, welchen er, ehe die Türe sich ganz hinter ihm geschlossen hatte, seine Neuigkeit entgegenrief. Dann sah er sich erst im Zimmer um und bemerkte zu seinem Verdruß, daß der Baron zugegen war. Dieser sprang auf und rief geräuschvoll: »Wie? unser Freund ist befördert worden! Ich gratuliere, Herr Professor, ich gratuliere! Hab' ich's nicht immer gesagt, daß der Herzog Ihren Verdiensten noch werde Gerechtigkeit widerfahren lassen? Sehen Sie, Sie haben Freunde bei Hof! Sie wollen sich nur nicht erraten lassen, diese Freunde.«
»Wäre unser Freund vielleicht Ihnen Dank schuldig geworden, Herr Baron?« fragte Amalie und sah ihn forschend an.
»Bitte, Madame, bitte!« rief er und lachte, »das sind Geheimnisse, die ich nicht ausplaudern dürfte, auch wenn ich sie wüßte.«
Heinrich biß die Zähne aufeinander; diese Art, sich halb und halb ein Verdienst zuzueignen, ohne doch einer geradezu ausgesprochenen Lüge schuldig zu werden, ärgerte ihn ganz unsäglich; statt aller Antwort erzählte er den Vorgang in der Akademie umständlich und schloß, er erkläre sich den Zusammenhang so, daß der Herzog sich über ihn zuvor bei seinen ehemaligen Lehrern erkundigt haben werde.
»Wo er nur Gutes erfahren konnte,« fiel der Baron verbindlich ein, »ja, natürlich! Der Herzog geht auf keinen Antrieb, ohne die Sache näher zu untersuchen. – Was ich sagen wollte – der Herr Professor werden jetzt bald Ihre schöne Braut heimführen, und ich schmeichle mir, sagen zu dürfen, daß sie als eine Zierde der hiesigen Gesellschaft glänzen wird.«
Heinrich sah seine Schwägerin mit einem peinlichen Blick an; er hätte das Gespräch von selbst gern auf diesen Punkt gelenkt, wenn der lästige Zeuge nicht zugegen gewesen wäre. Zum Glück kam der Expeditionsrat dazwischen und sagte: »Man muß nur vorher wissen, wie viel Besoldung mit dieser neuen Stelle verbunden ist, ehe man vom Heiraten sprechen kann.«
»Ist auch wahr, mein Freund!« rief der Baron mit einem Strom von Gelächter, »Sie geben doch immer den Ausschlag! Sie wissen das eine, was not ist!« – Er sah auf die Uhr und entfernte sich zu Heinrichs großer Beruhigung. Dieser kam jetzt ernstlich auf sein Vorhaben zu sprechen und führte aus, wie er das Haupthindernis, den Widerwillen des Vaters, zu bekämpfen gedenke. Amalie setzte ihm Zweifel auf Zweifel entgegen, behauptete, Lottchen tauge ihrer ganzen Erziehung nach durchaus nicht in die Stadt, stellte die Vermutung auf, der Herzog werde die Lehrerstelle nur gering dotieren, und malte ihm ein so widerwärtiges Bild von einer beschränkten, mit Mangel kämpfenden Haushaltung in der Stadt vor, daß er sie in der höchsten Verstimmung verließ.
Glücklicherweise jedoch fühlte er jetzt einen Hunger, der anderweitige Nahrungssorgen vorerst nicht aufkommen ließ. Bei Tische wichen mit der Nüchternheit alle Zweifel, und eine Flasche Wein versetzte ihn in die frohmütigste Laune. Er weidete sich lange an den scherzhaften und heiteren Einfällen, die ihm durch den Kopf gingen, und als er endlich nach der Uhr sah und fand, daß er noch einige Stunden bis zur Audienz vor sich hatte, so beschloß er, inzwischen den Professor Abel zu besuchen.
»Nun, ist alles in Richtigkeit?« rief dieser ihm entgegen und führte ihn in ein Zimmer, wo eine große Junggesellenunordnung herrschte.
»Noch nicht!« entgegnete Heinrich, und als ihn der Professor verwundert ansah, fuhr er fort: »Ich komme eigentlich nur, um Ihnen meinen Dank für das gelinde Examen zu sagen.«
»Ah so!« lachte Abel, »gar nicht Ursache! Wenn ich auch nicht dem Herzog seinen Willen an den Augen abgesehen hätte, so würde ich Ihnen schon deshalb meine Stimme gegeben haben, weil die paar wenigen Worte, die wir bei dieser Gelegenheit wechseln konnten, mir so sehr im Einverständnis mit meinen eigenen Ideen zu sein schienen, daß ich mich auf einen solchen Kollegen nur freuen konnte. Wiewohl, es ist vielleicht nicht politisch von mir, denn gerade deswegen sollte ich Ihnen feind sein; es geht mir wie dem König Franz von Frankreich, der jenem Mönch auf die Ermahnung, mehr nach dem Evangelio zu handeln und mit seinem Bruder Karl von Deutschland nicht länger um Mailand zu hadern, die Antwort gab: das ist's ja eben, was uns entzweit, daß ich das Gebot der Schrift so wörtlich befolge, denn was mein Bruder will, das will ich auch.«
»Sie werden an mir keinen Kain finden,« versetzte Heinrich lustig.
Abel lachte. »Aber mein Bruder will die Psychologie, und die will ich auch!« rief er.
»So will ich dabei literarische Abstecher machen und vorzüglich auf den Shakespeare rekurrieren.«
»Ei, zum Kuckuck!« rief Abel, »das ist just meine Hauptpassion! Kommen Sie, ich sehe schon, wir müssen uns vergleichen.«
Die beiden jungen Männer teilten ihre philosophischen Ländereien unter sich aus und schieden als die besten Freunde; gewiß ein seltener Fall! aber übereinstimmend mit dem Namen des »engelgleichen Mannes«, den Abels Freunde und Schüler ihm gegeben haben.
»Nun?« rief der Herzog seinem Schützling entgegen, als dieser um sechs Uhr im Schloß erschien, »bleibt's bei unserer heutigen Abrede?«
Heinrich versicherte ihn seiner Ergebenheit und berichtete ihm die vorläufige Konferenz mit Professor Abel.
»Wohlan!« versetzte der Herzog und nahm ein Papier vom Schreibtisch, »hier ist Seine Bestallung, bereits unterschrieben und konfirmiert. – Will Er wissen, was drin steht?« fuhr er fort, als er die schlechtverhehlte Spannung bemerkte, womit Heinrich das Papier entgegennahm; »mach Er's herzhaft auf! Er soll die Katze nicht im Sacke kaufen.«
Heinrich verbeugte sich tief und öffnete das Diplom.
»Wie? ist Er nicht zufrieden?« rief der Herzog rasch.
»Eure Durchlaucht halten zu Gnaden,« stammelte der Jüngling in großer Verlegenheit; »mir war schon einmal vergönnt, meinem gnädigsten Herzog anzuvertrauen, daß mein Glück unzertrennlich an das einer geliebten Person gekettet ist.«
»Was? Er hat eine Braut?« rief der Herzog verdrießlich und schien sich jener ersten Unterredung auf keine Weise mehr erinnern zu wollen.
Auf Heinrichs Zunge schwebten die Worte: »Es ist die Tochter des Pfarrers von Illingen!« aber ein unbezwingliches Gefühl hinderte ihn, sie auszusprechen, obgleich er ahnte, seine ganze Zukunft könnte an diesem Augenblicke hängen.
»Freilich,« fuhr der Herzog fort, »für eine Familie ist der Gehalt nicht berechnet – da wird's etwas knapp hergehen.«
»Es ist unmöglich, Eure Durchlaucht!« fiel Heinrich ein.
»Das steht bei Ihm!« rief der Herzog in hohem Tone, »wenn Er nicht will, so darf Er's nur sagen, es werden sich genug andere finden. – Das muß doch gleich geheiratet haben! Kann man denn nicht leben ohne das?«
Heinrich schwieg und sah zu Boden; von allen Repliken, die sich hierauf hätten geben lassen, war leider keine einzige anwendbar.
»Ich kann Ihm jetzt nicht helfen,« fuhr der Herzog nach einer Pause etwas freundlicher fort; »das Dekret ist nun einmal ausgefertigt und läuft bereits unter dieser Summe in den Rechnungen. Wenn ich Ihm gut zum Rate bin, so sage ich: laß Er der Sache ihren Lauf und fahr Er nicht oben hinaus; dagegen versprech' ich Ihm, Er soll avancieren, sobald es möglich ist. Dann kann Er ja Seine Dulcinea heiraten. Hat Er aber nicht Geduld bis dahin, so probier Er's in Gottes Namen, und such Er sich nebenher durch Stundengeben und dergleichen noch etwas zu verdienen. – Na, will Er, oder will Er nicht?«
Heinrich wußte wohl, daß er sich durch eine abschlägige Antwort jeden anderen Weg zu seinem Fortkommen abschneiden würde, und sagte: »Im Vertrauen auf die Gnade Eurer Durchlaucht will ich's wagen, obwohl ich jetzt bedauern muß, meine geistliche Laufbahn verlassen zu haben.«
»Ah was! ein Pfaff!« rief der Herzog, der den Hieb wohl fühlte, und ging heftig auf ihn zu, »ein Pfaff, sieht Er, ist gar nichts! Wenn ich Ihn auf Seinem Dorf angestellt hätte, so wär's mit Ihm aus für dieses Leben, aber jetzt, sag' ich, bleiben Ihm noch die größten Aussichten offen. Nun, also Ja?«
Was blieb unserem armen Freunde übrig, als sich in den Willen des Herrn zu fügen? Die günstige Stunde war nun einmal vorüber, die nicht wiederkehrende Gelegenheit verscherzt.
Nachdem er seine Annahme des Diploms erklärt hatte, erwartete er das Zeichen der Entlassung; der Herzog aber ging ein paarmal auf und ab und trat dann wieder zu ihm mit den Worten: »So, das wäre denn im reinen. Jetzt bleibt nur noch eine Kleinigkeit übrig, eine Kleinigkeit, sag' ich, für den Dienst, womit ich Ihn soeben versehen habe. Wir wollen's gnädig machen; hundert Gulden, denk' ich, sind nicht zuviel für jährliche dreihundert.«
Heinrich sah ihn verblüfft an. »Na, versteht Er mich nicht?« rief der Herzog, »Er soll mir hundert Gulden geben für Seinen Dienst; das ist doch sehr klar.«
»Eure Durchlaucht –«
»Was, Eure Durchlaucht! Ist Ihm das nicht genehm? Wo soll ich denn die schweren Kosten für meine Akademie aufbringen, für die mir die Landschaft nichts beisteuern will? Meint Er, Er dürfe für nichts und wieder nichts jedes Jahr Seine dreihundert Gulden einstreichen? Will Er's besser haben als Seine Kollegen? als Seine Universitätslehrer? Die haben alle Haar lassen müssen. Nur der Ploucquet,« setzte er lachend hinzu, »der wußte sich mit guter Manier zu dispensieren. Aber – hört Er? – Er braucht niemandem von den hundert Gulden etwas zu sagen! Die anderen wollen's sonst auch so billig haben. Ich habe besondere Konsideration für Ihn gehabt!«
Mit diesem Troste wurde unser Held entlassen und trat nicht in der angenehmsten Laune aus dem Schlosse. Er hatte Amalien versprochen, sie das Resultat der Audienz sogleich wissen zu lassen, und begab sich nun zögernd in ihr Haus.
»Das hätt' ich Ihnen voraussagen können,« versetzte sie, auf seinen Bericht bitter lächelnd, »daß Ihnen nicht auf Rosen gebettet werden würde.«
»Bin ich daran schuldig?« rief er mit überströmendem Unmut.
»Das kann man nicht geradezu behaupten,« sagte der Expeditionsrat, den sie aus seinem Arbeitszimmer gerufen hatte, »und doch haben Sie vielleicht zu schnell, zu willig eingestimmt, als der Herzog Ihnen Ihren ersten Vorsatz ausredete. Man muß sich den Menschen kostbar machen, wenn man ihrer versichert sein will.«
»Das kann ich noch jetzt!« rief Heinrich, den ein solcher Vorwurf aufs tiefste erbitterte. »Ich habe als ein ehrlicher Junge gehandelt und einer fürstlichen Verheißung getraut; dessen brauch' ich mich nicht zu schämen! Aber kostbar machen kann ich mich und bin es sehr gesonnen! Sie dürfen mir wahrhaftig nicht viel sagen, so send' ich dem Herzog seinen Wisch zurück, und adieu, Akademie!«
»Und adieu, Kirche, und adieu, Lottchen!«
»So geh' ich ins Ausland –«
»Und setzen sich am ersten besten Ort und leben in gloria. Als ob das so schnell ginge! Wo haben Sie denn Ihre Empfehlungen? Lieber Freund, draußen ist's gerade wie hier. Warum haben Sie denn keine Hoffnung mehr auf die Pfarre? Weil Sie versäumt haben, sich den geistlichen Machthabern zu empfehlen, und mit dem Herzog hierin nichts mehr anzufangen ist. Wie würde das erst draußen sein, wo Sie keine Seele haben! Nehmen Sie guten Rat an; die Sachen sind zu weit gediehen, als daß Sie umkehren könnten. Fügen Sie sich in das Unabänderliche. Der Herzog hat einen Fehler begangen, indem er Sie vom sicheren und – Sie werden's wohl selbst gestehen – vom besseren Weg abwendig machte und Ihnen jetzt kein Äquivalent dafür geben kann; er fühlt das, Sie dürfen versichert sein, und auch ich glaube diesmal seiner Zusage. Er wird Sie über kurz oder lang entschädigen, dann sind Sie auf einem kleinen Umwege zum Ziel gelangt.«
Heinrich blickte ihm prüfend ins Gesicht; wußte er ja doch nicht, ob er hier trauen dürfe, ob man es hier gut mit ihm meine. »Bürgen Sie mir dafür?« sagte er.
Der Expeditionsrat zuckte die Achseln. »Das kann ich nicht,« erwiderte er, »aber ich zeige Ihnen den Weg, der unter vielen zweifelhaften der beste ist.«
»Sie sind jetzt zu aufgeregt,« nahm Amalie das Wort, »um einen ruhigen Entschluß zu fassen; was Sie auch tun mögen, verschieben Sie's bis morgen.«
»Ja,« rief er, »ich bin aufgeregt, ich mag's nicht leugnen. Und ich weiß nicht, was mich am meisten erbittert: ist es, daß das Elendeste, was es auf Erden gibt, das Geld, mich hindert, einen Entschluß zu fassen, der einem edlen Manne ziemt, oder ist es das unfürstliche Benehmen des Herzogs, der das Glück meines Lebens zu gründen verspricht, und nun auch mich zum Wortbrüchigen macht; denn so kann ich meiner Braut die Hand nicht reichen! In Mangel, in Verlegenheiten aller Art kann ich sie nicht einführen. Und der schmähliche Tribut, den ich noch zahlen soll! Es ist mir nicht um die hundert Gulden, obgleich ich sie nicht wegzuwerfen habe, aber gestehen Sie, es liegt etwas Unwürdiges in diesem Handel, für den Fürsten und noch mehr für mich selbst! Es sieht ja aus, als ob ich mich durch diesen Kauf des Amts erst würdig machen müßte. Wenn das meine Fähigkeiten nicht bewirken können, so soll er's einem anderen geben.«
»Ja,« lachte der Expeditionsrat, »da haben Sie nun den berühmten Diensthandel von Angesicht zu Angesicht kennen gelernt! Trösten Sie sich, jetzt geht es doch gelinder her; seit ihn der Herzog in eigener Person betreibt, darf er schanden- und ehrenhalber doch nur taugliche Leute anstellen, also wirft das keinen Schatten auf Ihre Qualitäten. Aber früher, als der Wittleder noch seine Bude in Ludwigsburg hatte! Davon könnt' ich Geschichten erzählen, daß sich Ihnen die Haare sträuben sollten. A propos, da fällt mir eine hübsche Schnurre ein, die dem Herzog einmal auf einer seiner Landesvisitationen passierte; er war mit dem Schultheißen eines Dorfes sehr unzufrieden, der ihm auf keine seiner Fragen gehörigen Bescheid geben konnte, und rief vom Pferd herab den versammelten Bauern zu; ›Hört mal, Bauern! ich sag', euer Schulz ist'n rechter Esel!‹ – Da trat ein alter Bauer, die Mütze in der Hand, unerschrocken hervor und versetzte: ›Ihr' Durchlaucht, drum ist's 'n einkaufter!‹ – Darauf soll der Herzog seinem Roß die Sporen gegeben haben und davongejagt sein, ohne sich umzusehen.«
Heinrich mußte unwillkürlich lachen, und sein Zorn war, wenn auch nicht verflogen, doch wenigstens etwas gedämpft.
»Es kommt eigentlich nur auf das Kleid an, in welchem sich eine Sache präsentiert,« sagte der Expeditionsrat im Verlaufe dieses Gesprächs; »bei uns hatte dieses Kleid freilich eine starke Lumpenfasson und sieht auch noch jetzt nicht ganz honett aus; aber denken Sie zum Beispiel an England, diese gepriesene Republik! Dort ist es seit langen Jahren herkömmlich, daß die Ämter gekauft werden, wenigstens, so viel ich weiß, die militärischen, allerdings unter anderen Formen; aber es ist eben doch auch ein Ämterkauf, ein Diensthandel. Ich sehe die Sache so an; wo der Bauer von seinem bißchen Grund und Boden, der Gewerbsmann von seiner Profession seine Steuer zahlen muß, wo der Kapitalist von dem Vermögen, das er geerbt oder erworben hat, an den Kosten der Staatseinrichtungen, die ihm Sicherheit gewähren, seinen Teil tragen muß oder wenigstens tragen sollte, da find' ich es keineswegs unbillig, wenn man auch auf Fähigkeiten, Talente, die dem Inhaber ihren guten Nutzen tragen, indem sie vom Staate belohnt werden, wenn man, sage ich, auf diese ebenfalls eine Steuer legt –«
»Die aber dann von der Staatskasse eingezogen werden müßte,« unterbrach ihn Heinrich, »und nicht vom Fürsten oder seinen Kreaturen.«
»Mein lieber Freund!« versetzte der Expeditionsrat, »unser Herr, den es beständig zu neuen und großartigen Organisationen drängt, hat schon vor Jahren eine Staatskasse errichtet, aber – bis Ihre Ideen von einer Staatskasse realisiert werden, bis dahin hat's noch gute Wege.«

Nach einigen Stunden aber schrieb Heinrich einen ziemlich langen Brief an Lottchen
Heinrich ging, und der Rat bezeugte seiner Frau seine Verwunderung über die hochfahrenden Ansprüche des vierundzwanzigjährigen jungen Menschen und setzte ihr auseinander, wie sauer er sich's habe werden lassen müssen, bis er es so weit gebracht. »Was mag er sich nur vorgestellt haben,« sagte er, »als ihn der Herzog an sich ziehen wollte? Glaubte er denn, man werde ihm das Ruder des Staats in die Hände geben? Ich fürchte, er ist ein Phantast oder gar ein Poet, und dann wird es geraten sein, daß wir die gute Lotte noch in Zeiten von ihm losmachen.«
Als Heinrich am nächsten Morgen bei kühlerem Blute seine Angelegenheiten erwog, sah er freilich keinen anderen Ausweg vor sich, als sofort seinen Posten anzutreten. Er schrieb nach Illingen und erhielt umgehend eine Antwort, die er zwar hätte erwarten können, die ihn aber doch überraschte. Ein paar freundliche, aber kurz gehaltene Zeilen des alten Pfarrers bedeuteten ihm, da er unschlüssig gewesen sei, sogleich die sichere Zukunft zu ergreifen, an deren Schwelle er gestanden habe, so sei es wünschenswert, daß die Verbindung mit Lottchen vorderhand aufgehoben werde. Der Verlobungsring war ihm schon bei Eröffnung des Briefes in die Hände gefallen. Eine Nachschrift von Lottchen, halb durch Tränen verwischt, schien bestimmt zu sein, den bitteren Eindruck dieser Erklärung bei ihm auszulöschen. »Der Würfel liegt!« rief er und legte Ring und Schreiben in das entfernteste Schubfach; den seinigen sandte er ohne Antwort an Amalie, denn er zweifelte keinen Augenblick, daß sie es sei, welcher er diesen Dienst zu verdanken habe. Nach einigen Stunden aber besann er sich anders und schrieb einen ziemlich langen Brief an Lottchen, worin er sie seiner unverbrüchlichen Liebe versicherte. Die gehorsame Tochter gab ihm keine Antwort. – Sein Eintritt in die Akademie war ebenfalls von keinem guten Omen begleitet: der junge Tiroler, auf den er sich im stillen herzlich gefreut hatte, entfloh zwei Tage darauf nach Italien und sandte dem Herzog aus der Schweiz ein Danksagungsschreiben, in welches – sein Zopf gewickelt war.

Vom Korridor her schimmert Licht. – Still! horch!
wer spricht da? –
Die Stimme kenn' ich – – – Was für ein Ruf
Des Jammers weckt die Schläfer dieses Hauses?
Wallenstein.
In einem der vielen Gänge des Akademiegebäudes begegnen wir einem nächtlichen Wanderer. Die Lampe in seiner Hand wirft ihren Schein auf ein noch immer blühendes Gesicht, in das aber ein abgemessener oder gar etwas grämlicher Zug sich eingegraben hat. Bald geht er rasch vor sich hin und blickt mit einer gewissen Strenge rechts und links, als müßte er sich der umgebenden Ordnung und Stille versichern; bald bleibt er an einem der Fenster stehen und sieht gedankenvoll in die Nacht hinaus. Er scheint ein Vorgesetzter zu sein, vielleicht sogar ein Mensch. Ein entferntes Geräusch weckt ihn aus einer seiner Träumereien. Es ist ein leises Gehen und putschen, wie von vielen Füßen, dazwischen ein unterdrücktes Kichern, und wie er näher kommt, so zeigt sich ihm ein seltsames Schauspiel. Er sieht ein Bett im Gang stehen, worin einer ruhig schlummert, seiner ungehörigen Lage unbewußt; die Geister aber, die ihn hergetragen, sind verschwunden.