
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der Titel paßt nicht, wie so manches in dem Schauspiel von Wilhelm Schmidtbonn nicht paßt. Es müßte, nach der Gräfin von Gleichen, ›Notburg‹ heißen. Ihr gehört der Hauptanteil des Hörers wie des Dichters, der sich das nur entschlossener hätte eingestehen sollen. Dann wäre vielleicht fortgefallen, was hier ein dramatisches Hindernis ist, weil es keinen andern Existenzgrund hat, als daß die alte Mär vom Grafen von Gleichen es als Motiv oder Arabeske mit sich führt. Den Tatbestand dieser Mär vom Mann mit den zwei Frauen hat am knappsten der Dichter der ›Stella‹ ausgesprochen, wenn er Cäcilien ihre Schilderung mit den Worten beenden läßt: »Und ihr Glück und ihre Liebe faßte selig eine Wohnung, ein Bett und ein Grab.« So friedlich sind derlei Dreieckigkeiten in einer primitiven Vergangenheit ausgegangen, werden sie allenfalls wieder in einer hochentwickelten Zukunft ausgehen. Die Gegenwart ist diesem Ideal zu selten reif. Schmidtbonn mummt in mittelalterliche Gewänder drei Menschenkinder, zwischen denen eine Tragödie erst dadurch möglich wird, daß ihre Seelen drei verschiedenen Zeitaltern zugeteilt werden. Die junge Türkin lebt in ihrer naiven Hingegebenheit vor der Entdeckung der Persönlichkeit und kennt auch den Begriff der Eifersucht noch nicht. Die reife deutsche Frau, mit einer unvergleichlich reichern Denk- und Ausdrucksweise, ist ganz ihr Gegenstück, ist eine Tochter unsrer individuellern Tage. Über sie hinaus träumt sich ihr Eheherr als einen Bürger derer, welche kommen werden. Dieser Mann und die Kleinheit seiner Sehnsucht ist der wunde Punkt der Dichtung. Was will er denn? Er hängt sein Herz, das einmal für eine Idee geblutet hat und nach zwölfjähriger Gefangenschaft vor Tatendurst bersten könnte, an die Einführung der Bigamie in sein christliches Haus. Er braucht das blonde und das schwarze Haar, die dunkle und die lichte Stimme, die Kinderschultern und die breiten Hüften, die treue Zeugin seiner Jugend und die Verjüngung seines Mannesalters. Nur daß wir uns den Inhalt eines Mannesalters vielfältiger zu denken lieben. Das Lied, das in ihm singt, müßte schon eine vollere Skala haben, um uns tiefer zu berühren. Das Gezupf auf der einen Saite der Geschlechtlichkeit gibt einen gar zu dünnen Klang. Schmidtbonn hat das offenbar selbst bemerkt und hat eine Art orchestraler Tonuntermalung zu schaffen versucht. Sie macht die Musik des Grafen nicht bedeutsamer, aber prätentiöser. Kein geringerer nämlich als der Tod dröhnt allenthalben mit einem unorganischen Leitmotiv hinein, das ungefähr die Bestimmung des Bizetschen Schicksalsmotivs hat, ohne irgendwo seine Schönheit zu erreichen. Es will wohl besagen, daß über dem Grafen ein Verhängnis schwebt, das ihn vorwärts stößt, eine unbekannte Macht, die er trotzigen Hauptes zum Schluß anklagt. Das ist zu billig und der gerade Rückzug in eine überwundene Dramatik. In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne. Wo das im besondern Fall bedrohlich überzeugend hätte werden müssen, hat Schmidtbonn sich mit einer Allegorie geholfen.
An Notburg wird er wieder zum Dichter. Der Calvarienweg der Gräfin von Gleichen ist das eigentliche Drama. Es ist nicht tragisch, oder doch wenigstens nicht in diesem Schauspiel, einen Mann mit einer einzigen Frau sich begnügen müssen zu sehen, noch dazu mit einer Frau, die er keineswegs verabscheut, sondern liebt. Aber es ist tragisch für eine Frau, den einzigen Mann, den sie je geliebt hat, zu dem sie von Anbeginn gehört, auch nur zur Hälfte, auch nur zu einem Teil seiner allerphysischsten Männlichkeit zu verlieren. Mephisto hat es leicht, über der Frauen Weh und Ach zu spotten, das so tausendfach aus einem Punkte zu kurieren ist. Schmidtbonn zeigt die Kehrseite, zeigt ehrlich die Nöte des unkurierten Wehs und Achs. Die tapfere Notburg fürchtet sich nicht, das dichte Netz sentimentaler Selbstbeschwindlungen und vorgetäuschter seelischer Kompliziertheiten, das von dem einfach sexuell abwechslungssüchtigen Grafen um sie gesponnen wird, zu zerreißen mit dem einen elementaren Aufschrei: »Mein Schoß verlangt nach Dir!« In aller Brutalität ist dieses Bekenntnis dichterisch rein, weil sich in ihm eine Naturgewalt entlädt. Die Weibheit einer Frau soll mit Füßen getreten werden und bäumt sich mit ihrer letzten Kraft dagegen auf. Aber jener Aufschrei müßte von seiner Wucht einbüßen, wenn Schmidtbonn nicht für alle Phasen des voraufgehenden Kampfes den entscheidenden dramatischen Einfall hätte, wenn er nicht für alle Nuancen den bezeichnenden Ton träfe. Von der Szene an, wo Notburg durch das Liebesglück ihrer Magd an ihren eigenen Liebeshunger schmerzlichst gemahnt wird, bis zu der Szene, wo sie die verhaßte Nebenbuhlerin noch im Tode ihre beneidete Macht üben sieht, ist der psychologisch-physiologische Ablauf dieses Frauenschicksals ohne Lücke. Wars da nötig, es durch die Ansprüche, die die Übernahme der alten Mär unvermeidlich an die Ökonomie des Dramas stellt, beeinträchtigen zu lassen? Ist es nicht genug, daß Medea und Sappho ihren modernen Gehalt mühsam gegen die Starrheit antiker oder antiquierter Fabeln durchzusetzen haben? Schmidtbonn ist ein schöpferischer Sprachkünstler, wie wenige seiner Zeitgenossen. Die Rauheit und Schwere mittelhochdeutschen Rittertums klingt aus seinem Munde ebenso unverbraucht, wie die Weichheit und Beschwingtheit zärtlichster Minnepoesie. Warum gießt er diesen kostbaren Wein in abgenutzte Schläuche?
Mag aber auch noch viel mehr Schmidtbonns Schauspiel anzuhängen sein: das Theater, das es gespielt hat, verdient jeden Dank. Was diesem Theater nach wie vor fehlt, ist ein Dramaturg, der die Autoren mit demselben Ergebnis zu hypnotisieren verstünde, wie der Direktor die Schauspieler. Es hätte Schmidtbonn abgerungen werden müssen, das Vorspiel preiszugeben, dessen Inhalt im ersten Akt weit eindrucksvoller erzählt wird. Wenn damit die Allegorie des Todes ganz gefallen wäre, so hätte das nur seine Vorteile gehabt. Da aber das Vorspiel einmal aufgeführt wurde, hätte sich die Regie wenigstens eine huschende Spukhaftigkeit, nicht die gemeine Deutlichkeit der Dinge zum Ziel setzen sollen. Schauspielerisch kann einem Stück wenig geschehen, das von Wegener und der Durieux getragen wird. Man erkennt, voll Dankbarkeit, bei den meisten Mitgliedern der Reinhardtschen Bühnen von Mal zu Mal Fortschritte. Die Entwicklung dieser beiden ist besonders erfreulich, weil ihre Rapidität im graden Verhältnis zu der Schwierigkeit der Aufgaben steht. Sie sind überdies prachtvoll aufeinander gestimmt. Wenn sie einander die Profile zukehren, glaubt man Geschwister vor sich zu haben. Die Intelligenz des einen gibt für die Intelligenz des andern die beste Resonanz ab. Diese Intelligenz hat vorläufig keinem von beiden die Ursprünglichkeit geschwächt. Wegeners Furor ist ungebrochen, aber nicht sein einziges Mittel, dem Grafen Gleichen den Charakter unverfälschtester Deutschheit aufzuprägen. Die Durieux wirkt wie eine verweiblichte Eysoldt oder wie eine vergeistigte Sorma, und das ist sicherlich eine der zukunftsreichsten Mischungen für eine Schauspielerin.
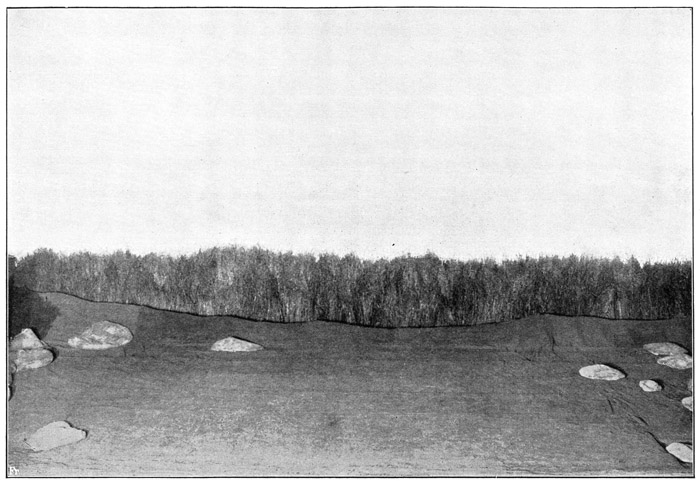
Carl Czeschka: König Lear Heide