
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
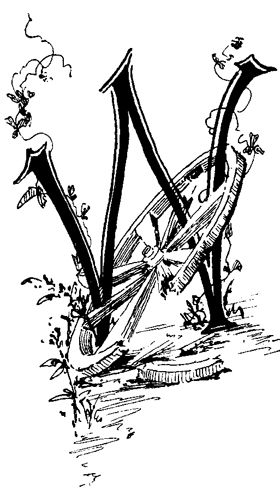 Während der Reise nach Moskau empfand Romanowna die Wahrheit des Satzes, daß nichts unangenehmer ist als gezwungene Unthätigkeit, während der Geist rastlos arbeitet. Wie endlos erschien ihr jeder Aufenthalt, der doch häufig notwendig war, wie ungeduldig wurde sie, wenn die Pferde nur langsamen Schrittes auf dem beschwerlichen Wege weitergingen. Oft glaubte sie in ihrer ängstlichen Einbildung ihren Vater zu sehen, wie er auf das Schafott stieg, und der Henker das Beil schon erhob, gerade in dem Augenblick, als sie in die Stadt einfuhr, und bei jedem Aufenthalt rief sie mit äußerst traurigem Ton: »Ach, jetzt kommen wir gewiß zu spät!«
Während der Reise nach Moskau empfand Romanowna die Wahrheit des Satzes, daß nichts unangenehmer ist als gezwungene Unthätigkeit, während der Geist rastlos arbeitet. Wie endlos erschien ihr jeder Aufenthalt, der doch häufig notwendig war, wie ungeduldig wurde sie, wenn die Pferde nur langsamen Schrittes auf dem beschwerlichen Wege weitergingen. Oft glaubte sie in ihrer ängstlichen Einbildung ihren Vater zu sehen, wie er auf das Schafott stieg, und der Henker das Beil schon erhob, gerade in dem Augenblick, als sie in die Stadt einfuhr, und bei jedem Aufenthalt rief sie mit äußerst traurigem Ton: »Ach, jetzt kommen wir gewiß zu spät!«
Man kann sich deshalb vorstellen, wie ihr zu Mute war, als sie eines Abends, gerade nachdem sie das letzte Dorf vor Moskau verlassen hatten, einen gewaltigen Stoß fühlte, und auf ihre Frage, was es gebe, die Antwort erhielt: »O nichts, es ist nur etwas am Wagen gebrochen, aber glücklicherweise habe ich die Pferde gleich zum Stehen gebracht und hoffe deshalb, daß wir so wieder zurückkehren können.«
»Nichts?« wiederholte Romanowna. »Nichts? nennt Ihr so viel Zeitverlust nichts?«
»Wenn die Pferde noch einen Schritt weiter gegangen und der Wagen umgefallen wäre, würden wir wahrscheinlich alle ertrunken sein,« sagte der Mann gleichmütig, »aber ich rate Ihnen,« fügte er hinzu, »nicht im Wagen zu bleiben, denn das könnte gefährlich werden.«
Der Weg war dunkel und einsam, und es war nicht daran zu denken, ihn zu Fuß zurückzulegen, weil die Entfernung noch zu groß war; die jungen Mädchen mußten es sich deshalb gefallen lassen, nach dem Dorf zurückzukehren.
Da kein anderer Wagen zu bekommen war, mußten sie wohl oder übel warten, bis der ihrige wieder in stand gesetzt war.
Trostlos ließ sich Romanowna auf die Bank in der kleinen Herberge fallen, als der Kutscher ihr nach einer halben Stunde die Mitteilung machte, daß sie unmöglich heute weiter reisen könnten.
»O, jetzt kommen wir gewiß zu spät,« sagte sie, in Thränen ausbrechend, und Milna hatte nicht den Mut, ihre unglückliche Freundin mit leeren Worten zu trösten.
»Könnten wir nur etwas erdenken, um die Zeit herumzubringen,« sagte sie. »Wenn ich nur ein Buch hätte, dann würde ich dir etwas vorlesen, aber ich habe keines. Trotz meiner Eile habe ich wohl unsere Schreibgerätschaften mitgenommen, weil ich Christine versprochen habe, ihr Nachricht von dir zu geben, aber du hast gewiß nicht die geringste Lust zum Schreiben.«
»O nein,« war die Antwort, »ich sehe gar nicht die Möglichkeit, meine Gedanken zu sammeln, obgleich,« fügte sie nachdenklich hinzu, »ich es doch einmal probieren könnte; vielleicht zerstreut es mich ein wenig. Ich werde der Kaiserin schreiben.«
Milna brachte ihr das Schreibgeräte, und die Freundinnen setzten sich einander gegenüber; aber wie würde Milna erstaunt gewesen sein, hätte sie den Inhalt von Romanownas Brief lesen können; denn er war nicht an die Kaiserin, sondern an Herrn Lowitz gerichtet. Gerade als Milna vorschlug, zu schreiben, fühlte Romanowna in ihrer Tasche die Adresse, die ihr Christine gegeben hatte; dadurch war sie auf den Gedanken gekommen, den sie jetzt zur Ausführung brachte. Sie schrieb:
»Sehr geehrter Herr!
Suchen Sie nicht nach der Unterschrift dieses Briefes, denn ich werde keinen Namen daruntersetzen, da derselbe doch nur schmerzliche Erinnerungen in Ihnen wachrufen würde. Dieser Anfang hat Ihnen jedenfalls schon gesagt, wer diejenige ist, die sich die Freiheit nimmt. Ihnen zu schreiben. Ja, ich bin es, die Tochter von ..., ach nein, lassen Sie mich lieber sagen die Freundin von Milna, denn als solche wende ich mich an Sie. Eine Unbescheidenheit hat mich zur Mitwisserin Ihres Geheimnisses gemacht; aber ich freue mich über meine Neugierde, weil ich sonst nie erfahren hätte, was Milna um meinetwillen aufgeben wollte, und weil ich dann zum zweitenmal dazu beigetragen hätte, Sie Ihres Lebensglückes zu berauben. Vergeben Sie mir diese Weitschweifigkeit, denn ich fühle wohl, daß jede Zeile von mir Ihnen unangenehm sein muß, wenn Sie daran denken, wer ich bin; aber die Sache, über die ich Ihnen schreiben wollte, ist viel zu zart, um oberflächlich behandelt zu werden. Milna weiß weder, daß ich ihren an Sie gerichteten Brief gelesen habe, noch daß ich an Sie schreibe, und niemals hat auch nur ein Wort mir verraten, daß Milna Sie liebt. Aber aus ihrem Brief weiß ich, daß ihr Herz Ihnen gehört, und sie verdient mehr als jede andere, glücklich zu werden. Es ist für mich sehr schmerzlich, immer denken zu müssen, daß ich das Hindernis bin, das ihrem Glück im Wege steht, und deswegen schreibe ich diesen Brief.
In einigen Tagen werden wir in Moskau sein in der Wohnung von ..., dicht beim Kreml. Sollten wir den Zweck unserer Reise erreichen oder nicht, jedenfalls werde ich Moskau bald verlassen, um mich in das Kloster des Pater Alexius zu begeben. Gott gebe, daß ich begleitet werde von einem unglücklichen und bußfertigen ... aber auch allein werde ich meine Zuflucht da suchen, wo ich durch unaufhörliche Bußübungen wenigstens einen Teil seiner Schuld sühnen kann. Ich werde Milna heimlich verlassen, denn sie will sich aus Liebe zu mir aufopfern; aber ich kann und darf das Opfer Ihres beiderseitigen Lebensglücks nicht annehmen. Senden Sie mir, sobald Sie in Moskau angekommen sind, einen Leibeignen mit einer Blume; das soll für mich das Zeichen sein, daß Sie sich in der Stadt befinden und fortan für Milna sorgen werden; sobald ich dieses Zeichen erhalte, verspreche ich Ihnen, mich sogleich zu entfernen, damit Sie mir nicht zu begegnen brauchen.«
Nachdem Romanowna diesen Brief mit äußerster Anstrengung geschrieben hatte, blickte sie einmal nach Milna. Diese saß augenscheinlich in tiefen Gedanken, ein noch unbeschriebenes Blatt Papier vor sich.
»Was machst du?« fragte Romanowna.
»O, ich dachte, ich ...« stammelte Milna zusammenfahrend; »ich bin so dumm, sieh nur einmal, ich habe noch keinen Buchstaben zu Papier gebracht, und du?«
»Mein Brief ist fertig,« sagte Romanowna, und steckte denselben, nachdem sie die Adresse geschrieben hatte, in ihre Tasche, mit der Absicht, ihn, sobald sie in Moskau angekommen wäre, abzuschicken.
Weder Milna noch Romanowna konnten sich später genau entsinnen, wie sie die Nacht und die folgenden Tage verlebt hatten. Beide hatten eine unklare Erinnerung von einer schnellen Fahrt und von der Ankunft in Moskau, wo sie sogleich hörten, daß Pugatscheff sich nicht mehr unter den Lebenden befinde. Romanowna hatte noch immer gehofft, daß sie zeitig genug ankommen würden, und auch Milna hatte noch einigen Mut gehabt. Das schreckliche Gefühl der Einsamkeit und Verlassenheit, das Romanowna überkam, als sie die Nachricht erhielt, die ihr natürlich ohne besondere Vorbereitung mitgeteilt wurde, läßt sich nur empfinden – wir wagen nicht, ihren tiefen Schmerz zu schildern. Ohne etwas dabei zu denken, hatte sie mit Milna nicht in dem gleichen Haus Wohnung genommen, in dem sie früher gewesen waren; da saß sie nun tagelang, ohne ein einziges Wort zu sprechen, und hielt die Hände im Schoß gefaltet. Auf Milnas wiederholtes Bitten nahm sie ab und zu halb mechanisch etwas Nahrung zu sich; aber selbst Milnas herzliches Zureden konnte sie nicht zum Sprechen bewegen. Eines Abends sprang sie hastig auf, als an die Thüre geklopft wurde; aber augenscheinlich enttäuscht ging sie gleich wieder an ihren Platz zurück und blieb auf demselben sitzen.
»Noch immer nicht!« murmelte sie zwischen den Zähnen.
»Wen erwartest du?« fragte Milna.
»Die Blume,« sagte Romanowna ganz ohne Überlegung; aber Milna fragte nicht nach einer Erklärung der rätselhaften Antwort, weil sie fürchtete, Romanowna sei irrsinnig geworden infolge der erschütternden Nachricht, umsomehr, da sie diese früher schon etwas von der Blume, die nicht kam, hatte murmeln hören.
»Wenn hier nur ein Arzt wäre,« dachte Milna, »vielleicht könnte er etwas für sie thun.« Aber an wen sollte sie sich in der fremden Stadt wenden?
Die Schwierigkeit war zu jener Zeit größer als jetzt; denn damals gab es zwar viele Ärzte, aber diese waren zum größten Teile so unwissend, daß manche Patienten das Opfer einer ganz verkehrten Behandlung wurden. Sehr wahrscheinlich würde Milna über diesen Umstand nicht nachgedacht haben, wenn sie nicht manchmal Herrn Doktor Dimsdale mit Herrn Lowitz über eine Unwissenheit hätte sprechen hören, welche die beiden Herren sehr entsetzte.
Romanownas Zustand beunruhigte Milna aber endlich doch so, daß sie sich entschloß, ärztliche Hilfe zu suchen; denn außer daß Romanowna zwischendurch einmal nach der Thüre lief, wenn sie jemand kommen hörte, gab sie gar kein Lebenszeichen. Des Nachts schlief sie fast gar nicht, und nicht einmal eine Thräne rollte über ihre bleichen Wangen, um ihrem Schmerz etwas Erleichterung zu schaffen.
»O, Romanowna, sage doch etwas,« bat Milna manchmal; aber ein fast unmerkliches Lächeln war die einzige Antwort, die sie erhielt.
Halb verzweifelt verließ Milna eines Tages das Haus und begab sich, ohne irgend eine bestimmte Absicht in den Gasthof, in dem sie früher gewohnt hatten, um zu sehen, ob die alte Ottekesa noch da sei. Sobald sie die Frau, die ihr die Thüre öffnete, nach Ottekesa gefragt hatte, setzte diese sie sehr in Erstaunen durch Fortlaufen und lautes Rufen: »Da sind sie, wenigstens eine von den zweien, die Sie suchen.« Aber ehe sie noch Zeit hatte, über diese Worte nachzudenken, sah sie das Rätsel gelöst, indem zu ihrer unaussprechlichen Freude Herr Doktor Dimsdale auf sie zukam. »Ach, Herr Doktor,« sagte sie fröhlich, »keine andere Erscheinung könnte mir so willkommen sein, wie die Ihrige.«
»Ist das lautere Wahrheit?« fragte der Arzt, während er Milnas Kopf zwischen beide Hände nahm und ihr lachend in die Augen sah.
Milna errötete ein wenig und sagte ausweichend: »Die arme Romanowna hat Ihre Hilfe sehr nötig. Ich glaube, der niederschmetternde Schlag hat sie wahnsinnig gemacht ...«
»Armes Kind,« sagte der Arzt. »Ich will sogleich mit Ihnen gehen, meine Frau ist eben ausgegangen mit ...« und er hielt lachend ein, »mit einem unserer Freunde.«
»Wie kommen Sie hierher, Herr Doktor?« fragte Milna, vergeblich bemüht, ihre Aufregung zu verbergen.
»Warten Sie! ich will nur meinen Hut holen,« sagte der Arzt, »ich werde Ihnen unterwegs alles erzählen.«
Herr Dimsdale erzählte nun, wie er mit seiner Frau hierhin und dorthin gereist sei, um mit Eifer ihre beiden Gäste zu suchen. »Wir würden wahrscheinlich,« sagte er, »nicht über Moskau gereist sein, wenn wir nicht gehört hätten, daß der angebliche Zar hier gefangen sitze; die Hoffnung, daß wir Sie hier mit seiner Tochter finden würden, veranlaßte uns, einige Zeit hier zu bleiben.«
»Wie gütig,« sagte Milna.
»Wir interessieren uns sehr für Sie,« sagte der Arzt; »aber ich will nicht eine Ehre in Anspruch nehmen, die mir nicht zukommt. Unser Reisebegleiter stellte uns Ihre verlassene Lage vor und veranlaßte uns, diesen Umweg zu machen.«
Milna sah vor sich hin, um den Doktor nicht merken zu lassen, wie sehr sie der Gedanke aufregte, Lowitz noch einmal wiederzusehen.
»Wir waren so glücklich,« fuhr der Arzt fort, »hier sogleich die alte Ottekesa zu finden, die steif und fest behauptete, daß Sie in den nächsten Tagen mit einem gewissen Grerowitz und seiner Frau zurückkehren würden, von denen sie uns Wunder erzählte. Glücklicherweise hat sie sich nicht geirrt in ihrer Voraussetzung; aber erzählen Sie mir jetzt etwas von sich selbst,« fuhr der Doktor fort und hörte mit großem Interesse alles an, was Milna ihm mitteilte.
Sobald Romanowna Herrn Dimsdale sah, ging sie auf ihn zu und flüsterte ihm ins Ohr: »Sind Sie der Überbringer der Blume?«
Sowohl diese sonderbare Frage wie auch das Aussehen des jungen Mädchens machten den Arzt geneigt, Milnas Befürchtung zu teilen und zu denken, Romanownas Verstand habe gelitten; er antwortete, um sie nicht zu enttäuschen: »Meine Frau, deren Sie sich doch wohl noch erinnern, wird Ihnen gern schöne Blumen mitbringen; aber mir scheint, Sie haben eben Ruhe nötiger als Blumen.«
Offenbar betrübte es Romanowna, daß der Doktor ihr diese Antwort gab; aber, sich besinnend, legte sie ihren Finger auf den Mund und sah den Arzt vielsagend an, indem sie auf Milna zeigte. Doktor Dimsdale nickte zustimmend, obgleich er ihren Wink nicht verstand und sagte, ihre Hände erfassend: »Wahrhaftig, Romanowna, Sie müssen sich Ruhe gönnen.«
»Muß ich dann noch nicht gleich fort, Herr Doktor?« fragte sie kaum hörbar.
»Nein, Sie können ruhig schlafen,« lautete die Antwort.
»Ist er denn noch nicht hier?« fragte das junge Mädchen wieder ...
»Nein, nein, aber machen Sie sich darum keine Sorge,« sagte der Doktor in beruhigendem Ton, obgleich er keine Ahnung davon hatte, was Romanownas Worte bedeuteten.
»Aber wäre es nicht doch besser ...?« fing Romanowna an; aber sie beendete ihren Satz nicht, denn bei den letzten Worten wurde sie ohnmächtig.
»Sie muß sogleich zu Bett gebracht werden,« sagte der Arzt zu Milna; während er selbst ihr ein Fläschchen unter die Nase hielt, das er bei sich trug, fing Milna an, sie zu entkleiden, worauf der Doktor sie, sobald sie etwas zu sich gekommen war, in seine Arme nahm und in ihr Bett legte.
»Sie müssen sie ruhig liegen lassen,« flüsterte er Milna zu, »denn sie hat jedenfalls große Ruhe nötig; aber man kann mit solchen Patienten nicht vorsichtig genug sein, und darum rate ich Ihnen, sie nicht zu verlassen. Ich will nur einmal zu meiner Frau gehen und komme sogleich wieder.«
Als der Arzt, um seinen Hut zu holen, noch einmal in das Zimmer zurückging, das sie eben verlassen hatten, sah er einen Brief auf der Erde liegen. Unwillkürlich hob er ihn aus und betrachtete die Adresse.
»Wie sonderbar,« murmelte er, als er sah, daß der Brief an Lowitz gerichtet war. »O, Milna hat ihn wahrscheinlich geschrieben und nicht die Zeit oder den Mut gehabt, mich zu bitten, den Brief mitzunehmen, und nun hat sie ihn hier fallen lassen in der Hoffnung, daß ich ihn finde. Nun, er soll rasch besorgt werden,« beendete der Doktor sein Selbstgespräch.
Frau Dimsdale und Herr Lowitz waren gerade von ihrem Spaziergang nach Hause gekommen, als der Doktor zurückkam.
»Nun, Lucie,« sagte er heiter; »wie ist es Euch ergangen? Da, lieber Junge, lies das inzwischen mit Vergnügen,« fügte er zu Lowitz gewendet hinzu, während er ihm den Brief reichte.
Frau Dimsdale begann, ihrem Gatten von allem zu berichten, was sie gesehen hatten, als auf einmal Herr Lowitz einen Ruf der Verwunderung ausstieß: »Sonderbar,« sagte er kopfschüttelnd. »Sie kennen doch den Inhalt dieses Briefes, Herr Doktor?« fragte er.
»Bewahre,« war die Antwort, »wie kann ich wissen, was sie Ihnen schreibt.«
»Aber der Brief ist nicht von ihr,« sagte Herr Lowitz, »lesen Sie nur einmal,« fügte er hinzu, dem Arzte den Brief reichend.
»Ah! jetzt verstehe ich ihre Fragen,« sagte dieser. »Armes Kind! sie erwartete Antwort auf diesen Brief, den sie jedenfalls schon längst abgeschickt zu haben glaubte.«
»Wie tief empfindet sie das Unrecht ihres Vaters,« sagte Lowitz, »aber was für ein sonderbarer Gedanke von ihr, daß ich ihr feindlich gesinnt sein soll, ihr, die so ganz unschuldig ist.«
»Was für liebe, edle Geschöpfe sind sie beide,« sagte Frau Dimsdale, nachdem auch sie den Brief gelesen hatte, »und wie sehr verdienen sie, glücklich zu werden.«
Lange und ernsthaft wurde von den dreien überlegt, wie sie sich in dieser Sache benehmen sollten; endlich riet Doktor Dimsdale Lowitz, sich nicht eher zu zeigen, als bis ihm eine Botschaft geschickt werde. »Ich werde,« sagte er, »mit meiner Frau Romanowna das Zeichen überbringen, um das sie gebeten hat,« und nachdem er sich eine Blume hatte geben lassen, ging er nach dem Hause, in dem die beiden jungen Mädchen wohnten.
