
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++


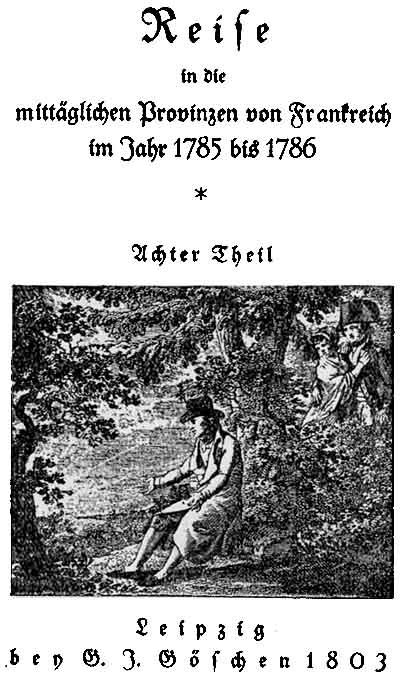
Den 21. Februar
Unterweges von Toulon nach dem Sonnental.
*
Marseille, den 22. Februar
. . . Ehe ich mich ganz von der holden Nachterscheinung entferne, . . . muß ich dir doch der Vollständigkeit wegen die stille Betrachtung noch mitteilen, mit der ich heute, ziemlich spät, mein Bette verließ. Der angeborene und treuste Freund menschlicher Natur, besonders der meinigen, zischelte ich mir zu und rieb mir die Augen munter, hat es doch diesmal wieder recht gut mit dir gemeint, aber fast zu gut! Es ist nicht der erste Morgen, wo ich ihm diesen kleinen, freundschaftlichen Vorwurf zu machen habe. Ich bin in meinem Leben, das ich gewiß, manchem widrigen Augenblicke, vielen Sorgen und Grillen, durch Vermittlung des Schlafs, wenn keine andere verfangen wollten, glücklich entwischt; durch ihn wurden nicht selten meine brausenden Leidenschaften und die harten Gegenreden meines Gewissens gemildert. Dagegen aber hat mich auch sein einschmeichelnder Besuch eben so gewiß um manche schöne Belohnung der Wachsamkeit, um manchen Gewinst an Kenntnissen gebracht, der nicht zu berechnen ist. Über süße Träume der Nacht habe ich oft weit süßere des Tags verloren, und bei Freuden, die man nur mit offenen Augen genießen kann, wie heute bei der aufgehenden Sonne, das Nachsehen gehabt. Sie, die ich kürzlich mit solcher Inbrunst besang, ist schon seit vier Stunden dem blumigen Brautbette dieses Tales entstiegen, und hat nun für mich, wie jede Schöne, die sich der weiten Welt preisgibt, nichts Anlockendes mehr. Auch Saint-Sauveur hat, wie die Sonne, das Erwachen seines Gastes nicht abgewartet. Er wäre, sagt mir der schnurrbärtige Kutscher, den er mir zu meinem Fortkommen zurückließ, mit Tages Anbruche, seinen Geschäften nach, zu Fuße, durch den Tempel des Friedens und vermutlich nach Marseille gegangen. Oh, warum hat mich der gute Mann nicht geweckt! Wie gern hätt' ich seine muntere Unterhaltung, in der Kühle des Morgens gegen die Schattenbilder meines Traums eingetauscht, da ich jetzt, bei voller Besinnung, ein paar heiße, einsame Stunden durchbrechen muß, um in meine verschraubte Wirtschaft zu gelangen, wohin mich ein paar alberne Briefe auf das ängstlichste rufen. Sie beleidigten schon mein Auge, als ich sie aufschlug, und ihre Siegel verrieten mir sogleich, als wenn es die bekannteren Wappen wären, von wem jeder herrührte. Auf dem einen war eine hirnlose Maske – auf dem andern das Petschaft des Michelangelo gedrückt. Ich griff nach dem Wahrzeichen des ersten, der mir eine wortreiche Bitte entwickelte, an deren schleuniger Gewährung mir zwar ebensoviel gelegen war, als den beiden Puppenspielern, die sie vortrugen, die aber auch gerade um deswillen mir recht böses Blut machte. Dies verlangt eine Erklärung, lieber Eduard. Du wirst dich erinnern, unter welchen Scheltworten ich mir letzthin den armen Prologus vom Halse schaffte, als er sich mit rednerischem Anstand meinem Schreibepulte näherte. Hätte ich nur zwei Minuten Geduld behalten, ihn anzuhören, so würde ich erfahren und mich längst darein gefügt haben, daß die Elektra, mit der er seine Perioden anhub, nichts weniger als griechischen Ursprungs, sondern in jenen glücklichen Tagen seiner theatralischen Herrschaft die prächtige Frau des ersten Akteurs gewesen, seit kurzem Witwe geworden – Besitzerin eines weitläufigen Sortiments trefflich organisierter Puppen, und geneigt sei, ihm, aus unveralteter Achtung, ihre Hand zu geben. Schließe ja nicht aus dem gedrungenen Auszuge des Briefs auf seine Kürze. Ich könnte dich damit töten, wenn ich dir ihn in seinem ganzen Umfange vorlegen wollte. Durch mein Zusammendrücken, wie ich es bei so heillosem Geschwätze zu tun pflege, habe ich ihm nur das Gift benommen. In einer Nachschrift bitten beide Brüder um ihre Entlassung noch diesen Vormittag, mit Beibehaltung ihrer Livree, weil der Jahrmarkt zu Montpellier, wo Elektra zuerst ihr neues Theater zu eröffnen gedächte, schon übermorgen seinen Anfang nähme, und sie dort eines Prologs und Epilogs gewiß benötigter sein würde als ich. Hierin haben nun die zwei verbrüderten Narren vollkommen recht; auch will ich eilen und meiner eigenen Freiheit so lang Zwang antun, bis ich ihnen, wie einem Paar unnützen Stubenvögeln, die ihrige geschenkt habe. Mögen sie mit ihren bunten Federn, die ohnehin nicht von der Farbe meiner Helmdecken sind, aus einer Wildnis in die andere ihren Talenten nachfliegen. Mir soll ihres Schicksals halber weiter kein graues Haar wachsen. Ungleich mehr Sorge macht mir die peinliche Frage, mit der in der zweiten Epistel der unselige Passerino mir zu Leibe geht. Freilich hatte ich es vergessen – aber er nicht, daß der einzige Tag, den uns Saint-Sauveur zu der artistischen Reise nach Cotignac frei gab, morgen eintrete. Er wolle, sagt er, die unglückliche Möglichkeit gar nicht voraussetzen, daß ich zum zweiten Male anderes Sinnes geworden sei und habe deshalb die Postpferde mit dem Frühesten in meinen Gasthof bestellt. Was will ich tun? Würde er mich wohl aus Frankreich lassen, ehe ich ihm nicht mein Versprechen halte? So sei es denn! Doch soll es gewiß der letzte Liebesdienst sein, den ich meinem tollen Lehrmeister erzeige, sowie das letzte Marienbild, das ich besuche. Ach! aber wie fällt mir der Abschied so schwer, den ich, o Gott, auf ewig von diesem reizenden, einzigen Tale nehmen soll. Ohne jenes abgeschmackte Berufsgeschäft hätte ich wenigstens noch einen Tag länger – (Saint-Sauveur stellte es mir ja anheim) – hier bleiben, und diese Höhen und Tiefen – diese Landhäuser und Wiesen, die sich vor mir hinstrecken, näher beäugeln können, als durch das Fenster. Ist es nicht zum Tollwerden, daß ich die letzte Vorstellung eines so prächtigen Schauspiels, als mir die Natur auf morgen verspricht, ausschlagen muß, damit ein paar Müßiggänger einen Tag eher ihre hölzernen Puppen den Gaffern ausstellen, und ein Schmierer an eine noch elendere als jene, seinen Pinsel versuchen kann? Vergebens wiederhole ich mir, wie viel edler solche Hingebungen werden, je mehr sie uns kosten. Meine Großmut hebt den Schmerz nicht, und am meisten ärgert es mich, daß es solche Armseligkeiten sind, die mich von hier abrufen. Ich bin doch in der Tat ein sehr guter Narr, daß ich gehe! Nur noch einen Schluck aus diesem würzhaften Luftstrom! Einen Hinblick noch auf das stärkende Grün dieser Gefilde! und dann lege ich, mit dem Seufzer eines Liebenden, der aus den Armen seiner Schönen zum Sturmlaufen gerissen wird, die Feder aus der Hand, gebe meine Nase dem Staube der Heerstraße und meinen armen Kopf den Strahlen preis, die senkrecht auf ihn herabschießen.
*
Marseille
Das Gesicht voller Schweißtropfen – alle Poren von der Hitze geöffnet, sprang ich endlich nach zwei melancholischen Stunden den Urhebern meines Mißmuts in die Hände. Sie warteten meiner am Tore des Gasthofs, wie ihres Heilandes, und spitzten die Ohren auf das erste Wort, das ich vorbringen würde, und das war: »Ein frisches Hemde!« aber diese in Feuer gesetzten Genies waren schon so fremd in meiner Haushaltung geworden, und so irre, daß sie mich an Bastian verwiesen, der aber nicht zu Hause sei. Sprachlos vor Ärger wankte ich die Treppe hinauf, und fand an meiner Türe eine Dame hocken, die sich nur noch hätte erbieten dürfen, mir eins überzuwerfen, um alle meine innern Flüche zur Sprache zu bringen. Es war die Geliebte des Prologus, die berüchtigte Elektra, die sich mir in einem Aufzuge zu Füßen warf, daß ich, trotz des Zugwindes, für das klügste hielt, sie samt ihren Theaterhelden gleich auf dem Vorplatze abzufertigen. – Ich drückte jedem zum freundlichen Lebewohl ein Goldstück unter der kurzen Vermahnung in die Hände, ihr albernes Handwerk künftighin klüger zu treiben, und die Trödellumpen, die sie aus meinem Dienst mitnähmen, vollends als ehrliche Kerle zu zerreißen. Heilfroh über mein erstes abgetanes Geschäft, schlüpfte ich nun in mein Zimmer, und bald nachher kam mir auch mein Kammerdiener zu Hülfe. Als er das Seinige besorgt hatte, fertigte ich ihn an den Marquis ab, und suchte nun Ruhe und Friede in meinem Lehnstuhle; hatte aber kaum einige Minuten – selbständig und selig, wie die Gottheit, ohne Prologus und Epilogus dagesessen, als mich der Narr von Maler in das menschliche Elend wieder zurückbrachte. Aber auch ihn überhob ich, wie die Puppenspieler, des Vortrags – »Gehen Sie jetzt wie gewöhnlich auf meine Kosten zur Wirtstafel – morgen früh, Herr Passerino, bin ich zu Ihrem Befehl!« bewegte zugleich die Hand gegen die Tür, zu der er nun, ohne den Mund zu öffnen – (so gut hatten wir einander verstanden) hinausschlüpfte. Wundere dich nicht über meine lakonische Laune, Eduard! Wie konnte ich mich wohl gegen diese Menschengesichter, die mir einen Tag voller Genuß auf dem schönsten Winkel des Erdbodens geraubt hatten, zu freundlichen Gesprächen herablassen! Doch, es kömmt noch bunter – höre nur! Hast du nicht auch, wie ich, erwartet, daß mich Saint-Sauveur auf den Mittag einladen würde? Ja, wenn er nicht durchaus an mir die Haltbarkeit seines Systems versuchen wollte. – Seine heutige Überraschung aber, mag er mir nicht übel nehmen, geht über die Erlaubnis. Rate einmal, was mir der artige Marquis an Bastians Stelle, von dem ich, ohne mich umzusehen, glaubte, er nähere sich jetzt mit seiner Botschaft meinem Lehnstuhle – für einen Abgeordneten zuschickte und mit welchen Aufträgen? Einen vornehmen Seeoffizier, der sich als einen Verwandten des Brigadiers und mir zugleich ankündigte: – »Er habe ihm die Ehre übertragen, in seiner heutigen Abwesenheit für meine Bewirtung und Unterhaltung zu sorgen.« – »In seiner Abwesenheit?« frage ich mit Befremden, das dem Herrn auffiel. – »Nun ja; denn Sie wissen doch,« antwortete er, »daß Sie ihn diesen Morgen auf seiner Bastide zurückließen?« – »Nein, das ist mir in der Tat etwas Neues,« stotterte ich unter einem mißtrauischen Blick auf den Unbekannten. – »Nun, so kann ich es Ihnen bescheinigen.« – Der Brief, den er mir mit diesen Worten überreichte, war zwar nur flüchtig und mit Bleistift geschrieben, unleugbar aber von der Hand meines Freundes – ein Glück, daß es so war, nimmermehr wäre ich sonst von der Stelle gegangen, so sonderbar kam mir der Inhalt vor – »Ich« – lautete er ungefähr, »antworte dir sehr in Eile, wie du siehst, aus meinem Janustempel, den ich dringender Geschäfte wegen vor morgen nicht verlassen kann.« – »Aus seinem Janustempel? dringender Geschäfte wegen? in dem Durchgange eines Steinbruchs?« Ich suchte geschwind über meine stillen Fragen Erläuterung in der folgenden Zeile – Was fand ich? »Die zwei ersten Feiertage deines Festes verlor ich zu Toulon – auf den heutigen dritten und letzten muß ich nun zwar auch Verzicht tun – doch stelle ich dir, um die Lücke zu füllen, meinen Mann an einem alten Bekannten von mir, aus Berlin, der eben in meinem Wagen nach der Stadt fährt« – »So?« murmelte ich, – »Er? ein sonst so guter, zuvorkommender Wirt – konnte sich doch heute vor dir unter einem Steinhaufen verstecken? Was in aller Welt hatte der Mann für Ursachen dazu?« Das Ding fing an mich zu verschnupfen, doch las ich weiter, und da erklärte sich denn der ganze Handel: doch so, daß ich beinahe außer mir kam. »Mein armer Freund,« erzählte er ganz unverblümt seinem Verwandten, »hat nach seiner Genesung von einer schweren Gemütskrankheit tägliche Veränderung nötig – und ich suche hierin nach Möglichkeit seinen Arzt zu ersetzen, der sich entfernt hat: – doch sorge ich heute gewiß so sehr für deine Unterhaltung, als für die seinige, wenn ich dich bitte, deine gastfreie Einladung von mir auf seinen Kopf überzutragen. Dieser Sonderling vom festen Lande hält, wie alle reisenden Deutschen, so gut ein Tagebuch und selbst pünktlicher noch – als ein Admiral. Ich möchte wohl hören, wie er sein erstes Gastmahl zwischen Himmel und Wasser beschreiben wird. Dabei muß ich dir nur sagen, daß ihm der Götze, dessen Wiegenfest du begehst, ein so großer Heiliger ist, daß er es gewiß, in dem Taumel seiner Verehrung, allen deinen übrigen Gästen zuvortun wird. Was willst du mehr? Morgen nehme ich dir die Sorge für ihn wieder ab. Ich muß des armen Schelms wegen zur Stadt, der auf Leben und Tod sitzt – und bin recht neugierig darauf – »So? so?« – wie angenehm ihn das Schrecken seines Pardons überraschen wird. Es soll mir – und schon deswegen ist mir dies Dienstgeschäft lieb – einen neuen herrlichen Beweis für mein System liefern.« – Ist es nicht, überdachte ich das Gelesene, ein recht hämischer Streich, den dir hier der saubere Marquis, und diesmal gewiß nicht bloß aus Vorliebe zu seinem albernen System, spielt? Er übergeht zwar deine Sottise zu Toulon mit Stillschweigen, hätte er aber wohl in seiner Missive das heutige vermaledeite Wiegenfest zweimal unterstrichen, wenn es ihn nicht für das schwindelnde Gastmahl rächen sollte, um das du ihn durch Einschub des Gehenkten gebracht hast? Wenn er glaubt, daß ein drehender Kopf zu deiner Nachkur gehört, so verzeihe es ihm Gott – aber wer ist denn der Heilige, dem so viel daran liegt? – Den meinigen – so berlinisch er ist – soll er ungehudelt lassen – Doch, wie geschwind verschluckte ich meine abschlägige Antwort, als mir der Offizier auf die obige Frage Voltairen nannte. »Ich habe das Glück,« fuhr er fort, »die Fregatte zu kommandieren, die seinen Namen führt. Einige seiner Bewunderer haben sie ausgerüstet, und so lange sie Wasser hält, verpflichtet mich meine Bestallung – unter welcher Zone der Erde ich auch den 20. FebruarEs gibt zwei Medaillen, die auf Voltairen geschlagen sind, davon die eine den 20. Februar, die andere den 20. November 1694 als seinen Geburtstag angibt. Palissot in seiner Eloge hält den erstern Datum für den richtigen; so auch die Kaufleute zu Nantes, die obiges Schiff ausgerüstet haben. vor Anker liege, zu dreitägiger Feier seines Geburtstags. Es kann mir kaum so leid tun, daß die beiden ersten ohne Teilnahme unseres Freundes vergingen, als Sie an seiner Stelle, mein Herr, mir bei der Feier des letzten willkommen sind. Es ist weltbekannt, wie viele Anhänger der Schutzpatron meines Schiffs in Berlin hat, von Friedrich dem Großen an bis auf den geringsten Standartjunker. Meine Gesellschaft wird stolz darauf sein, einen Repräsentanten seiner dortigen Verehrer in ihrer Mitte zu sehen; und auch ich freue mich herzlich auf die anziehenden Anekdoten, die Sie uns von seinem Aufenthalte in Ihrer Vaterstadt mitteilen werden.« Jetzt war ich mir nicht klug genug, weder wie ich die Einladung des Kapitäns ablehnen, noch der Verlegenheit trotzen sollte, in die mich allemal ein Kompliment verwickelt, das man mir in dieser oder jener falschen Voraussetzung aufdringt – und gewiß würde keiner von euch allen, die mit Voltaires Bekanntschaft groß tun und mit den Beiträgen seines Witzes dem ihrigen aufhelfen, meine Vokation unterschrieben haben, wenn Ihr die alberne Miene gesehen hättet, mit der ich sie annahm . . .
*
Den 23. Februar
Schon seit zwei Stunden sitze ich da, kaue meine Feder, und streite mit ihr, ob sie dich in das Geheimnis ziehen soll, dessen ich mich zu Cotignac bemächtigt habe? Doch, bist du nicht auf dem Runde der Erde mein engster Vertrauter, und müßte ich nicht fürchten, wenn ich gegen dich schwiege, von der Last, die mir auf dem Herzen liegt, diese Nacht erdrückt zu werden? Für das Verschwatzen will ich mich jedoch hüten. Ohnehin macht uns nichts lakonischer, als eine große Entdeckung. Passerino trat schon um fünf Uhr vor mein Bette. Während ich mich ankleidete, spitzte er seine Stifte – eine halbe Stunde nachher fuhren wir ab. Der Weg war so schlecht und langweilig, als seine Unterhaltung. Der elende Fleck, wo wir um zehn Uhr anlangten, war es nicht weniger, und so taumelte ich denn aus meinem Wagen durch den Klosterhof – die Vorhalle, verstimmt bis über die Ohren, in die rußige Kirche. Ein Mönch empfing uns mit der Miene, die allen den guten Leutchen eigen ist, die Archive, Hausarcana, Kinderklappern der Vorzeit, oder heilige Spielwerke im Beschlusse haben. Ich tat einen Blick auf das alberne Bild des Hochaltars und hatte auf immer genug daran. Nicht so mein Reisegefährte. Der setzte sich gegenüber auf die nächste Bank, zog sein Pergament heraus und zeichnete, als ob es für die Ewigkeit wäre. Für mich wäre es eine gewesen, wenn ich ihm länger hätte zusehen müssen. Aber der Mönch kannte den Wert der Zeit, nahm mich stillschweigend bei der Hand, führte mich durch einen dunkeln Gang in das feuerfeste Gewölbe der Sakristei und stellte mich vor einen großen, alten, vergoldeten Schrank, der meine geringe Geduld aufs ärgste durch sechs künstliche Schlösser prüfte, die weit über eine Viertelstunde wegnahmen, ehe der Pater eins nach dem andern geöffnet hatte: doch, dafür gelangte auch meine Bewunderung zu einem unerwarteten Genusse. Drei weite Schubfächer enthielten die Garderobe der Mutter Gottes – Hemden, Unterröcke, Caleçons, Strümpfe, Spitzen, Halstücher und Roben, alles, wo nicht neumodisch, doch fein, prächtig und unbefleckt, wie sie selbst. Das kostbarste ihrer Kleider, und das sie nur einmal des Jahrs ihrem Hofstaate zur Schau gibt, war von himmelblauem Atlas mit goldnen Sternen gestickt, und mit Quasten von den reinsten Perlen besetzt. »Dieses Kleid, so äußerst kostbar es auch ist,« sagte der Mönch, »wird noch merkwürdiger durch die beiliegende Nachricht, daß es unversöhnliche Feinde der Gebenedeiten, drei portugiesische Juden waren, die es besorgten; so wie ehemals bei ihrer Niederkunft drei Könige aus Morgenland, wie das Ihnen bekannt sein wird.« – »Ja, ja,« sagte ich, und nachdem er das Kleid, wie die geschickteste Kammerjungfer, wieder in seine Falten gelegt hatte, öffnete er einen mit schwarzem Sammet ausgeschlagenen Kasten. Gott verzeihe mir die Sünde! aber beim ersten Hinblick flog mir der Verdacht durch den Kopf, die heilige Jungfrau habe durch ihre dienstbaren Geister das grüne Gewölbe ausräumen lassen. Mit dieser Juwelensammlung an Ohren und Fingerringen – Halsbändern und Zitternadeln – Uhren, Zahnstochern – und Tabaksbüchsen, könnte man, dächte ich, die Bekehrung der Juden übernehmen, an der uns doch allen gelegen ist. »In der Tat, ehrwürdiger Herr,« nötigte mir diese seltne Erscheinung die Worte ab, »habe ich die Hochheilige nirgends noch so reich ausgestattet gesehen, als hier! Welcher fromme Bienenschwarm muß nicht seinen irdischen Honig diesem Kloster zugetragen haben, um sich dadurch Zellen im Himmel zu bauen!« »Nichts weniger als das, mein Herr,« antwortete der Mönch: »alle Schätze dieses Schrankes rühren von der Dankbarkeit einer einzigen Seele – von der Andacht Ludewigs des Vierzehnten her. Auch legt die Mutter ihm zu Ehren ihre kostbarsten Kleinodien, so wie jenes himmelblaue Kleid mit Perlen, nur zu seinem Geburtstage an. Verlangen Sie noch stärkere Beweise von der Achtung dieses großen Monarchen für unsere Madonne – so sehen Sie hier« – indem er ein neues Fach herauszog – »das Ordensband des heiligen Geists, das er ihr beim Antritte seiner glorreichen Regierung, – hier seinen Heuratskontrakt, den er der Wundertäterin durch einen Gesandten zuschickte, als er sich mit der Infantin Maria Theresia von Spanien vermählte, und hier, in diesem kostbaren Einband, den pyrenäischen Friedensschluß« – –
»Aber warum hat denn dieser große Monarch«, fragte ich in meiner Einfalt, »bei der Menge Madonnen in seinem weitläufigen Reiche eben der Ihrigen eine so übermäßige Auszeichnung erwiesen?« »Warum? mein Herr,« wiederholte der Mönch meine Frage mit mitleidigem Lächeln, »aus der guten Ursache, weil er allein nur ihr sein Dasein verdankte.« »Das ist etwas anders, aber ich bitte Euer Hochwürden, wie ging denn das zu?« Der Mönch verschloß erst mit dem bedächtlichsten Ernste seinen Schrank, faßte mich darauf stillschweigend bei den Schultern und drehte meine stolze Figur einer demütig gebeugten zu, die in einem prächtigen Rahme beinahe die ganze Hauptwand der Sakristei einnahm – dem Bilde eines Barfüßer-Mönchs in Lebensgröße, von Rigaud gemalt – dem wichtigsten Manne, wie der Pater sich ausdrückte, in der französischen Geschichte, und von dem ich doch – so mißlich steht es leider mit meinen historischen Kenntnissen – kein Wort in meinem Leben gehört hatte. Desto mehr Aufmerksamkeit schenkte ich jetzt dafür den Taten dieses Auserwählten, die mein Führer mit vieler Beredtsamkeit zu entfalten verstand. Bei jedem neuen Farbenstriche, den er dem Gemälde zusetzte, machte ich immer größere Augen. Wie hoch stieg aber nicht erst mein Erstaunen, als ich in dem schönen Ganzen, das sich am Ende aus seiner Erzählung ergab, den Plan zu einem Heldengedicht entdeckte, so tadellos und vollkommen, als vielleicht noch keinem Dichter der Welt einen zu entwerfen gelungen ist . . . Um jedoch nicht dem Hahne in der Fabel zu gleichen, der ein Kleinod aus dem Mist scharrte, und als zu hart für seinen Schnabel, es in seine schmutzige Verborgenheit zurückschleuderte, überlasse ich dir, oder jedem andern Barden, großmütig das ausgescharrte meinige, um es zu waschen, zu wägen und in homerischen Glanz zu setzen, ohne weiter zu untersuchen, wer mir mehr Dank schuldig wird – der Sänger, den ich in Zukunft, oder der Held, den ich schon jetzt, so gut ich kann, aus der unverdientesten Vergessenheit ziehe.
| Denn hüllt uns gleich der dickste Nebel, Den kein Varrentrapp noch Krebel Durchzubrechen wagt, seinen Ursprung ein, Frankreichs stolzen Bürgern sollt' er doch als Hebel Ihres größten Königs aus dem Ehverein Ludewigs des Schwachen unvergeßlich sein. Vor dem neuen Spiel einer Rolle bange, Und der Mönch erwacht und erweckt auch Annen. – Und der Prinz kam an, den der fromme Pater |
Der Erzähler einer merkwürdigen Begebenheit, der aufmerksame Zuhörer findet, ist, wie ein reicher Gutsbesitzer unter seinen Frönern, ein überaus glücklicher Mann. Von der einen Seite schlägt der Glanz seines Gegenstandes – von der andern das Ausströmen der erwärmten Neugier, wohltuend über ihn zusammen. Ist aber das Feld einmal geräumt und die Ernte im Trocknen, so macht er als Nachstoppler eine desto ärmlichere Figur. Ich sah den guten Mönch immer noch eine einzelne Ähre nach der andern auflesen, um die Garbe, die er gebunden hatte, wichtiger zu machen. Wir fühlten aber beide gar bald das Langweilige davon, und ich fing an, mich gewaltig nach meiner Heimreise zu sehnen, als es ihm beifiel, daß er mir für die Ehre seines Klosters noch eine Kleinigkeit zu vertrauen hätte. »Auch hat es« – fuhr er in seinem Nachstoppeln fort – »vor allen im Reiche den Vorzug, einen Urenkel von der leiblichen Schwester des heiligen Fiacre in seiner Mitte zu sehen, indes zu gleicher Zeit, im theologischen Sinne, einer auf dem königlichen Throne sitzt. Sie würden selbst Familienähnlichkeit in den Gesichtszügen jenes Porträts und des Pater André finden, wenn es Ihnen beliebte, mir in seine Zelle zu folgen.« »Lassen Sie uns«, erwiderte ich ängstlich, »doch vorher nachsehen, wie weit der Maler gekommen ist.« Dieser Pinsler aber, als wir auf ihn zugingen, winkte uns so ernstlich, wie Diogenes in der Tonne, aus dem Sonnenscheine seines Enthusiasmus, daß ich im Drange meiner Langeweile doch für klüger hielt, den gütlichen Vorschlag des Mönchs anzunehmen, als mich noch länger auf den Marmorplatten der dunkeln Kirche herumzutreiben, schimpfte aber in Gedanken desto ausgelassener auf meinen tollen Zeichenmeister. Ich hätte schon damals Ursache genug gehabt, mir diese undankbare Aufwallung meiner Laune zu verweisen; denn die Bekanntschaft mit dem Helden einer Epopee war ja wohl belohnend genug, um mich über alle und jede Unbehaglichkeit zu trösten. Mußte ich denn erst noch eine Stunde älter werden, um zur Besinnung zu kommen? Oh, du Sperling aller Sperlinge! vergib mir um des hohen Verdienstes willen, das ich späterhin deiner Narrheit mit reuigem Herzen zugestand. Wie willig und gedemütigt tat ich Ehrenerklärung und Abbitte! Sogar in diesem Augenblicke meines ruhigen Nachdenkens beuge ich mich noch vor deinem Stümpertalente tiefer, als vor der Hoheit der Raphaele und Tiziane, die sich zu vornehm dünkten, auf dem Hochaltare zu Cotignac dir ein Vorbild und jenem Barfüßer eine Kupplerin aufzustellen. Auch die kalte Küche, die du mir in prophetischer Ahndung rietest, mit mir zu nehmen, werde ich dir ewig verdanken: denn eben durch jenen Fasan, den ich an die Stelle des Eiergerichts schob, das der Pater André zu verzehren sich anschickte, und durch die vier Flaschen Burgunder, die den Braten umringten, gewann ich in aller Geschwindigkeit das Zutrauen des freundlichen Mannes; und was trug mir nicht dieses gegen das Ende des Mahles ein! Trocknes Brot, das Gott segnen will, bedarf keiner Brühe. Mein kleines, auf den Mittag versetztes und so wenig diplomatisches Frühstück, daß ich in Regensburg mir nicht getrauen würde, einen Hund damit aus dem Ofen zu locken, vermittelte mir dennoch die Entdeckung eines Staatsgeheimnisses, dem mehr als hundertjährige Riegel vorgeschoben waren. Ein Saekulum war verrauscht, ohne es zu verraten, ein zweites trug es in seinem morschen Leichentuche weiter und drohte schon mit ihm zu verschwinden, als der Genius, der über das Verborgene wacht, den Räuber im Fluge aufhielt, und wie einen Reiher zwang, seine Beute fahren zu lassen. Unbegreiflicher Zusammenhang der Dinge! . . .
Nach dem zehnten Glase ungefähr, wo es der schweren Zunge des Paters André lästig zu werden schien, den Einfluß der Mutter Gottes auf seinen Großonkel länger in Betrachtung zu ziehen, erhob er sich und taumelte der kleinen Niederlage seiner Bücher zu, zog eins aus dem Staube hervor, und – »Hier, mein Herr!« reichte er mir's über die Achsel, »verehre ich Ihnen zum Andenken die neueste Biographie des seligen Mannes – La vie du vénérable Frère Fiacre. Paris 1722. – Können Sie alte Papiere besser lesen als ich, so steht Ihnen auch noch der Plunder zu Diensten, der als sein einziger Nachlaß bis auf mich fortgeerbt hat.« Ich nahm sein, wie ich wähnte, unbedeutendes Geschenk mit höflichen Blicken an, und lüftete, während die Kuttenträger ihre Gläser aufs neue füllten, das morsche Gewebe ein wenig unter dem pappenen Umschlag, und was – Eduard – fiel mir zuerst in die Augen? Nichts Geringeres als ein Handbrief der Königin Anna. Welch Glück, daß ich keinen feinern Physiognomiken gegenüber saß, als ein paar halbtrunkenen Mönchen! Ihre gebrochenen Augen irrten nur von den leeren Flaschen zu der einzigen, die noch verstöpselt vor ihnen stand – ohne meine verfärbten Wangen des Anblicks zu würdigen. Ich bekam Zeit, mich von meiner freudigen Erschütterung zu erholen, band das lockere Paket fester, warf es so gleichgültig neben meinem Hut hin, als ob es eine deutsche Monatsschrift wäre, und gab nun – die Madonna und ihr Fiacre dürfen es mir wahrlich nicht verübeln – meinem Gespräche eine Richtung, die uns immer weiter von ihrer Glorie entfernte. Desto verbindlicher betrug ich mich gegen ihre beiden Trabanten . . . Das Dankgefühl der armen Geschöpfe war grenzenlos. Sie küßten meine ketzerischen Lippen so inbrünstig, als wenn es Schuhsohlen eines Apostels wären, und dem ehrlichen Passerino, der nach vollbrachter Arbeit hereintrat und sich hungrig nach dem Frühstücke, das er selbst bestellt hatte, umsah, setzten sie die leeren Flaschen und den verschrumpften Eierkuchen unter einem so toll ausgelassenen Gelächter vor die Nase, daß der Prior nachfragen ließ, was denn hier vorginge? Glücklicherweise – denn nun pochte mir das Herz noch stärker – stieß der Postillon ins Horn. Ich fuhr geschwind nach meinem Hute und dem Geschenke darneben, umarmte die bärtigen Kerle, empfahl mich ihrem Gebete, und ach! wie heilfroh blickte ich an den blauen Himmel hinauf, als ich den Klosterhof zehn Schritte hinter mir hatte! Der Rückweg, der abwärts ging, und das doppelte Trinkgeld, mit dem ich den Fuhrmann auf Kosten der Pferde bestach, brachten mich um vieles früher nach Hause. Passerino konnte mir unterweges kein Wort abgewinnen. Dafür entließ ich ihn an der Türe der Gaststube mit unbeschränkter Vollmacht. Ich warf meine Hülle wie ein Schmetterling ab, jagte Bastian, der ausräumen wollte, aus dem Zimmer – verschloß es, und sitze seitdem mitten unter meinen, den Motten und Mönchen abgerungenen Urkunden, an meinem lieben heimlichen Schreibtische, ohne daß ich vor Eifer mir hätte Zeit nehmen mögen, ein Billett des Marquis zu lesen, das in diesem Augenblick noch unerbrochen neben mir liegt. Nichts ist doch historischen, auch wohl andern wichtigen Untersuchungen nachteiliger, als die erste Hitze. Ich hatte schon bei einer Stunde meinen Spreuhaufen hin- und hergeworfen, ehe ich das seltne Weizenkörnchen, das mir dabei schon oft über die Finger geschlüpft war, bemerkte. Ich blätterte und blätterte alle Briefe vorbei, die nicht von der Königin waren, und von denen ich doch jetzt die meisten wieder in ihren Staub zurückwerfe, da sie schlechterdings des Durchsiebens nicht wert scheinen – voll verliebten Unsinns in altem Stil, der, so eindringend er auch zu seiner Zeit wirken mochte, aus Herzen, wie sie in der jetzigen organisiert sind, keinen als höchstens einen lächerlichen Eindruck hervorbringen. Dafür will ich Dir ein Morgenbillett der liebenswürdigen Anna, das sich bisher immer versteckt hielt, und so unbedeutend es aussah, mir doch zuerst die Augen öffnete, seiner ganzen Länge nach abschreiben: Nos neuvaines ont fait merveille. Depuis douze ans bien ecoulés, je viens de revoir mon gracieux mari et maître. L'orage d'hier qui l'a tristement éconduit du cage de sa FauvetteVermutlich ein Wortspiel mit dem Namen La Fayette., me l'a ramené. Peus-tu croire qu'il a même soupé avec moi? Oui, oui! mon reverend père, sans qu'il ait –Hier zeigt sich, daß die Gedankenstriche keine neuere Erfindung sind. touché à ton plat favori. En es-tu content? Il est reparti pour Versailles. Que Dien le conduise. J'espère chasser de ma chambre la peste de son haleine par l'encens que tu m'offriras. Je t'attens à l'heure accoutumée de ma devotion. La Beauvais te dira le reste.
Au Louvre ce 6 Decembr. 1637.
A– d'A.
Mir fiel in diesen Zeilen anfangs nichts so sehr ins Ohr als das Spatgewitter, dem überall das gemeine Volk weit wichtigern Einfluß in den Winter- als in den Sommermonaten zueignet. Nach seinen Begriffen ist es ein Wecker der Vorsehung. Einem so ungewöhnlichen Tumult der Natur müsse, hofft es, ein politischer nachfolgen. Ein fataler Volksglaube, der besonders in Rußland an manchem Unfug schuld ist, so daß ich aus Anhänglichkeit an die große Katharina froh bin, daß während ihrer glorreichen Regierung sich kein dergleichen Luftzeichen ihrem Horizonte genähert hat. Es waren nur ein paar flüchtige Augenblicke, die ich an dieses himmlische Phänomen verlor; denn ich stieg sogleich einige Zeilen tiefer, zu dem weit Erklärbarern herunter, das der Name Beauvais meinen Nachforschungen preisgab. Die vielen Briefe, die mit dieser Unterschrift in meinem Portefeuille den königlichen Handschreiben beigesellt waren, könnten doch wohl, vermutete ich, bedeutender sein, als ich ihnen bis jetzt zugetraut hatte. Ich legte also vorerst meinen Händen die verschuldete Strafe auf, die so sehr gestörte chronologische Ordnung der Briefe wieder herzustellen, ehe ich meinen Augen anmutete, ihre Hieroglyphen zu entziffern. Sie gingen freilich sehr scheu und ungern daran, aber, o was für eine wackere Lehrmeisterin ist nicht die Neugier! Kaum hatte ich die ersten Schwierigkeiten überwunden und mich überzeugt, daß es Annens vertrauteste Kammerfrau sei, mit der ich zu tun bekam, so las ich auch schon ihre Handschrift mit derselben Leichtigkeit als die deinige. Ich möchte das verschmitzte Geschöpf gekannt haben! Schon der erste Brief, den ich enträtselte, flößte mir eine hohe Meinung von ihrem praktischen Verstande ein. Sie empfiehlt in halber Frakturschrift dem ehrwürdigen Bruder die sorgfältigste Behutsamkeit in seinem Benehmen, und warnt ihn besonders vor den scharfsichtigen Augen Orleans. Gestern noch, erzählt sie, sei der Unverschämte ihrer Gebieterin, als sie eben aus der Kirche zurückkam, ohne nur Rücksicht auf ihre zahlreiche Begleitung zu nehmen, mit der Spottrede in den Weg getreten: Madame, vous venez de solliciter vos juges contre moi, je consens que vous gagniez votre procès, si le roi a assez de crédit pour cela. Anna wäre so aufgebracht darüber, daß sie ihren Gewissensrat zu sprechen verlange, und ihn eine Stunde früher als gewöhnlich in ihrem Andachtszimmer erwarte. Unter Leitung einer so vorsichtig geschäftigen Hand läßt sich ja eine zwölfjährige Ehetrennung wohl noch ertragen. Je länger ich an ihren Briefen meine Geduld übte, desto mehr verloren bei mir Notre Dame de Graces und ihr Fiacre an Ansehen – denn Marie Beauvais, wie mir jetzt jede Zeile verriet, war eigentlich das große Triebrad aller Wunder des Louvre. Sie hatte den jungen Barfüßer zuerst der trostbedürftigen Königin vorgestellt – ihm seine Rolle angewiesen und ihre gemeinschaftlichen Betstunden eingerichtet. Nach Recht und Billigkeit sollte keine andere Vermittlerin als sie den Ehrenplatz auf dem Hochaltare zu Cotignac einnehmen. Leichtsinnige und verratene Anna! – ich würde dich entschuldigen und bedauern, und ich würde Gott bitten, dir die Sünde zu vergeben, die den guten Herzog von Orleans um die Thronfolge betrog, hättest du nur nicht als eine grausame Mutter deinem Erstgebornen gleich bei seinem Eintritte in die Welt den Stein an den Hals gehängt, der ihn in den Abgrund lebenswieriger Schwermut versenkte. Ja, Eduard, spitze nur die Ohren! Ludewig der Vierzehnte hatte noch einen zwei Jahre ältern Bruder. Fiacre war Vater beider Bastarde, und der Unglückliche, von dem ich eben spreche, war die unbekannte, nur zu berühmte eiserne MaskeDie Entdeckung, die hier der Reisende schon vor fünfundzwanzig Jahren in seinem Tagebuche entwickelte, scheint so wenig mehr in Frankreich bezweifelt zu werden, daß man jetzt sogar das Gemälde jenes verlarvten Bruders Ludwigs des Vierzehnten in Lebensgröße als Schild eines Kaufladens, in der rue Coquillière zu Paris mit folgender Unterschrift ausgestellt sieht:
. Die Mutter gebar diesen ihren Erstling in einem entlegenen Gartenhause unter den hülfreichen Händen der Beauvais – und belegte schon während der Geburtsschmerzen das Pfand ihrer verbotenen Liebe – zu welchem Geschlecht es auch gehören möchte, mit dem Fluche der Weihe, inzwischen ihr Buhler Messen für ihre glückliche Entbindung las. Die Nothelferin verbarg das Kind bis in sein sechstes Jahr, und so erhielt der heilige Fiacre Zeit genug, sich nach der bequemsten Madonne umzusehen, die den unreinen Ton kneten und zu einem Gefäße der Heiligkeit bilden sollte. Er wählte die unbesuchteste von allen, die späterhin durch den geschickten Wurf ihres Deckmantels um Annens Bette, nach jener mysteriösen Gewitternacht, seine kluge Wahl nur zu gut rechtfertigte. Er erhielt den grausamen Auftrag und führte ihn gewissenhaft aus wie ein Mönch. Dasselbe Kloster, wo ich heute seinen Urenkel berauschte, erhielt das Gott geweihte Kind, unter der Bedingung, unbekannt mit seiner Herkunft, der Wundertäterin so lange als Chorknabe zu dienen, bis er zur Tonsur reif sein würde. Nimm einstweilen mit diesem flüchtigen Auszug meiner Kriminalakten vorlieb, bis ich dir die Belege dazu selbst einhändigen kann. Wenn die Köpfe einer Ehebrecherin, einer Kammerfrau und eines Mönchs zusammentreten, um den Schwefeldünsten ihres Gewissens einen Ableiter zu verschaffen, so läßt sich leicht denken, daß eine solche Vereinigung keine gemeinen Sophistereien entwickelt. Es findet sich leider! unter meinen Papieren nur ein einziges Konzept des heiligen Fiacre, das aber desto fleißiger bearbeitet ist, wie die ausgestrichenen bedenklichen und dafür eingeschalteten gewähltern Worte an den Tag legen. Gott im Himmel, welch ein Brief! an eine strafbare Königin – von ihrem Gewissensrate – zur Fastenzeit – in dem Sterbejahre ihres Gemahls, kurz nach Antritt ihrer Regentschaft –im Jahre 1643 an einem Morgen geschrieben, wo sie durch einen nächtlichen bösen Traum erschüttert, von ihrem erschlichenen Throne herab sich nach geistlicher Beruhigung umsah. Wie würde Bayle seinen gelehrten Artikel »Marie« mit diesem Briefe aufgestutzt haben, wenn er ihn gekannt hätte! Der untergeschobene Kronerbe stand damals in seinem fünften Jahre, und der ihm den Weg gebahnt hatte, in seinem siebenten. Mit welchen behutsamen Saftfarben weiß nicht der heilige Mann diesen Vorläufer des Führers seines Volks zu schildern. Alle himmlische Heerscharen, schmeichelt er sich, müßten die seligste Freude über die Gewandtheit des geweihten Knabens bei den, seinem zarten Alter angemessenen Kirchendiensten – über seine Gelehrigkeit in der Schule und besonders über die süße Anwendung seiner Feierstunden empfinden. Dann stehe er oft vor dem schönen Gemälde, das Ihro Majestät der Kirche verehrt habe – freue sich des Kindes, das dem Mutterbilde zu Füßen liege – ohne zu ahnden, wie nahe es ihm verwandt sei. Dieser rührende Instinkt von Bruderliebe, fährt er gleißnerisch fort, sei ein neuer Segen der Gebenedeiten – ein deutlicher Beweis ihres Wohlgefallens an ihm, und ein Widerschein der Strahlenkrone, die seiner in jenem Leben erwarte usw. Es nahm mich Wunder, daß ich den Brief der Regentin von der Beauvais nicht unterstützt sah, so wie es mir überhaupt vorkömmt, als sei der Traum nur aus Höflichkeit gegen einen abgedankten Liebhaber erfunden, mit dem man nicht mehr weiß was man reden soll. Schon in einigen vorhergehenden Missiven vermisse ich das Herzliche der vorigen Zeit, so daß ich wohl begreife, warum allein der dritte Sohn Philipp, nachmaliger Herzog von Orleans, seinem regierenden Bruder nicht glich. Die folgenden Briefe werden immer seltener, kürzer und kälter, und behaupten ein gewisses religiöses Zeremoniell, das gegen den ehemaligen traulichen Ton sonderbar absticht. Wem etwas daran gelegen sein könnte zu wissen, wie der heilige Fiacre die Tage seines in der Schnellwage des Hofs gesunkenen Gewichts hingebracht habe, dem könnte ich zur Erläuterung wohl noch einige Beichten mitteilen, die hier, wie verloren, daliegen, und sehr warmen Herzen entflossen scheinen. Im Jahre 1660, wo der Regentin wahrscheinlich die Neugier angekommen sein mochte, das Kind des Gartenhauses kennen zu lernen, befragt sie ihren Wegweiser aus so manchen Gängen des Lebens, sehr herablassend – um die beste Route nach Cotignac, wohin sie eine Wallfahrt zu tun vorhabe – der einzige darauf folgende Brief meldet dem ehrwürdigen Vater ihre Zurückkunft, und befiehlt ihm, sich den Tag nachher bei ihrer Kammerfrau einzufinden, wo sie über eins und das andere mit ihm sprechen wolle, das jenes Kloster beträfe. – Noch ein paar andere weisen ihn an, Gelder zu Almosen in ihrer Schatzkammer zu erheben. Mit den Anweisungen auf ihre Schlafkammer ist es vorbei. Diese Briefe machen meine Verzweiflung. Man lernt doch in der Welt Gottes nichts daraus. Glücklicherweise gibt noch eine heillose Epistel der Beauvais, die den ganzen Briefwechsel schließt, zu merkwürdigen Mutmaßungen Anlaß, die uns künftig einmal bei einem Glase Punsch munter genug machen werden. Sie scheint eine Antwort auf einen Bericht des heiligen Fiacres zu sein, der sich auf einen andern vom Prior des Klosters bezieht. Jetzt will ich dir nur den Anfang und das Ende davon zugute geben: Votre Saint-Jean ne vaut pas le diable avec sa maudite ressemblance. Il est incorrigible et fou à lier. Sa mère en est desolée, outrée, et l'abandonne à son mauvais destin. Elle vient d'en instruire le roi qui saura bien que faire. — La reine, schließt sich diese drei Seiten lange Urkunde, vous loue d'avoir brulé nos lettres. Faites de même avec celle-ci. Que rien ne reste après nous de tout ce qui a trait à ce damné. Je me recommande à vos prières. Wenn mich mein Gedächtnis nicht betrügt, dem freilich jetzt keine Bücher zu Hülfe kommen, so trifft dieser Brief mit der Zeit zusammen, wo der König sein savoir faire geltend machte, und die eiserne Maske zuerst bekannt ward. Mein Herz blutet, wenn ich an das arme, unschuldige, der Entsündigung ehebrecherischer Eltern und der Staatskunst eines unmenschlichen Bruders geweihte Schlachtopfer denke. Ich spüre dem Gefühle nach, mit welchem der Gemarterte am Fenster seines einsamen Kerkers steht, und jenes Vultus tyranni auf die Scheibe kritzelt, die sich – wahrscheinlich sein einziger Nachlaß – in meine Sammlung geflüchtet hat, als ob sie mich für meine Teilnahme an seinem Schicksal belohnen sollte. Wie betroffen werden die Geschichtschreiber in Frankreich und Deutschland – sie, die bald einen Herzog von Buckingham, bald einen Grafen Rantzau, und endlich gar den Kardinal Mazarin mit der Königin verkuppeln, einander anstaunen, wenn ich meine Dokumente bekannt mache! Die Beauvais verstand den Handel besser. Sie wußte sehr wohl, daß in solchen Angelegenheiten, als sie betrieb, ein junger Barfüßer mehr, als alle Befehlshaber der weltlichen und geistlichen Miliz – und ein Fiaker mehr wert sei, als ein Staatswagen. Ich danke es dem heiligen Manne noch in seinem Grabe, daß er diesen wichtigen Briefwechsel, statt, wie er seinen klugen Gehülfen weiß machte, dem Feuer – der schwesterlichen Treue übergab, und entweder vergaß, die Rolle seiner Jugendjahre zurückzufodern, oder seinen Erben in ihr ein Kapital zu hinterlassen gedachte, das ihnen auch gewiß – wenn sie recht verstanden hätten, es zu benützen, hohe Zinsen hätte abwerfen müssen. Siehe doch zu, Eduard, daß du seine Legende irgendwo auftreibst. Sollte sie sich denn nicht in einem Winkel der königlichen Bibliothek finden? Ich weiß zwar ungefähr, wie viel den Lobrednern der Heiligen zu trauen ist; aber zu geschweigen, daß die Wahrheit sich doch nicht so ganz verkleistern läßt, um nicht hier und da durchzuschimmern, so kömmt es dem seinigen auch gar nicht in den Sinn, die Materialien, die ihm zu Gebote standen, zu verfälschen. Er stört nur in den gemeinsten Fripperien nach den Lumpen des Schafpelzes, der dem Wolf hienieden ein so frommes Ansehn gab. Uns, die wir nun den ehrlichen Mann in sein wahres Licht gestellt sehen, kann ein solcher Umzug nicht blenden. Es trägt vielmehr bei, seine Physiognomie durch Vergleichung nur desto hervorstechender zu machen. So müde ich auch des Exzerpierens bin, soll es mich doch nicht verdrüßen, dir aus dem Büchelchen noch eine und andere Parallelstellen zu dem vorliegenden Texte abzuschreiben.
Du repos des états déplorable victime.
Le fort courba son front sous trente ans de revers,
Ce jouet du malheur etoit l'enfant du crime,
Il naquit sur le trône et mourut dans les fers.