
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Bonaparte war nun an die dreizehn Monate von Frankreich ferne gewesen. Wohl hatte er dann und wann Nachrichten gehabt, zuletzt sogar einen Packen englischer und deutscher Zeitungen: aber all das gab keine Klarheit über das vielverästelte Geschehen in dem Lande, das hinfürder ganz und gar sein Land sein sollte. Was er erfuhr, reichte eben nur hin, seine Unruhe zu steigern. In Ägypten war Rühmliches nicht mehr zu tun: die zurückgebliebenen Generäle hatten Ober- und Unterägypten so weit erobert und befriedet, daß sich das immerhin als ein Gegengewicht gegen den kaum völlig umdeutbaren Mißerfolg in Kleinasien vorweisen lassen konnte. Und als dann noch der Schlag gegen die Türken bei Abukir gelungen war und Bonaparte etwas mitzubringen hatte, das frisch sein mußte, um volle Wirkung zu tun, zögerte er nicht mehr lange, diese »große Mausefalle Ägypten« zu verlassen. Es ist bekannt, wie er, ein Zusammentreffen mit Kléber vermeidend, diesem brieflich Kommando und Verantwortung über die zurückbleibende Armee übergab, wissend, daß auf die Dauer kein Sieg die Zurückbleibenden vor Kapitulation werde retten können, und wie er sich in aller Heimlichkeit mit etlichen hundert Begleitern einschiffte. Am 23. August hatte das Schiff Alexandria verlassen, hatte drei Wochen mit widrigen Winden gekämpft, so daß die Umkehr schon fast unvermeidlich erschienen war, und war endlich am 1. Oktober genötigt gewesen, in der Bucht von Ajaccio Zuflucht zu suchen.
In den sieben Tagen, die Bonaparte gezwungenermaßen auf der Heimatinsel zubrachte, hatte das Bild der ihn betreffenden Welt und seiner selbst in ihr sich beträchtlich zu klären begonnen. Scharenweise waren aus allen Dörfern die Leute herbeigeströmt und hatten behauptet, seine Verwandten zu sein, und so viele Kinder hatten ihn Taufpate genannt, daß Bourrienne sagt, man hätte den Eindruck haben können, Bonaparte habe ein Viertel aller korsischen Kinder aus der Taufe gehoben. So hatte, nach diesen vielversprechenden Anzeichen zu schließen, der Ägyptenzug doch große Wirkung getan! Das würde sich ja bald in Frankreich erweisen, in diesem Frankreich, das gerade jetzt seiner mehr bedürfen mußte als je zuvor. Denn hier in Ajaccio blieb ihm kein Zweifel mehr, daß die neue russisch-englisch-österreichische Koalition auf allen Kriegsschauplätzen erfolgreich gewesen war und daß das von ihm eroberte Italien so gut wie verloren sei. Die Nachricht von der Niederlage bei Novi war die letzte, die er erhielt. Daß der tapfere Joubert gefallen sei, bedeutete für ihn freilich auch einen bedeutenden Rivalen weniger.
Es dauerte noch immer lang genug, von Ajaccio zur französischen Küste zu kommen. Bonaparte war voll Unrast. Wenn Karten gespielt wurde, Einundzwanzig, betrog er und gab nachher das gewonnene Geld zurück: er hätte jetzt weniger denn je zuvor ertragen können, daß das Glück auf irgendeine Art gegen ihn sein könne. Seinen Tribut ans Unglück meinte er in der unseligen Ehe gezahlt zu haben, deren festgehakte Stacheln noch immer nicht alle aus seinem Leben herausgeschwärt waren. Aber damit mußte es für ihn jetzt ein Ende haben, es gab nur noch die unvermeidlichen Formalitäten zu erledigen, dann würde Josephine ein Stück Vergangenheit geworden sein, wie die kleine Madame Fourès es derweil auch geworden war.
Knapp vor dem Golf von Juan, in dem er fünfzehn Jahre später zum letzten Male Frankreichs Boden betrat, hatte eine englische Eskader das Schiff gesichtet. Aber jetzt wollte ihm das Glück wohl. Achtundvierzig Tage nach der Ausfahrt aus Alexandria ging er in Fréjus ans Land. Der wilde Jubel, der ihn schon im Hafen umfing, ermutigte ihn, die strengen Quarantänevorschriften zu durchbrechen. Und Frankreich hatte auch diesmal mit ihm Glück: da diese mehrere hundert Menschen, die mit vielem Gepäck aus pestverseuchten Gegenden kamen, mit Napoleon Bonaparte nicht auch noch die mordende Seuche ins Land brachten.
Bonaparte hatte vor allem Sorge getragen, daß die Nachricht vom Siege bei Abukir der von seiner Ankunft vorausliefe. Die nun folgenden paar Tage dahinjagenden Triumphzuges durch Frankreich wären eine Geschichte für sich, die mit ihrer konzentrierten Vielfalt von Motiven wohl zum Erzählen verlocken möchte. Von der ersten Stunde an wunderbare erschütterte Begeisterung über das Wiederkommen. Die Bauern säumen die Wege, laufen im Abend Fackeln tragend mit dem Wagen, als Huldigung zugleich und als Schutz gegen die Räuberbanden, die neuerdings die verelendeten, von Krieg und Beamten ausgesogenen Provinzen plündernd durchziehen und denen trotz der Schutzmaßregel Bonapartes gesondert nachfolgendes Gepäck zur Beute wird. Bis in die elendesten Weiler Flaggenschmuck, oft die Trikolore aus ein paar Fetzen zusammengeflickt. Dann, wie von Etappe zu Etappe aus all den Zurufen und dem, was seine Augen sehen, Bonaparte zugleich Frankreichs Wirklichkeit in diesem Augenblicke und die ihm entgegenhoffende Erwartung immer erregender deutlich wird. Haß gegen das Direktorium und seine Sendlinge, die diese unsinnigen Gesetze durchführten, die indessen zu den vielen anderen erlassen worden waren In fünf Jahren waren von den republikanischen Regierungen mehr als 3400 Gesetze erlassen worden!: jenes Geiselgesetz, das aus allen der Gegenrevolution verdächtigen Familien die Stellung von Geiseln verlangte und als dessen Folgen Tausende, die sich mit der Republik abzufinden begonnen hatten, aus der Seßhaftigkeit getrieben, sich den royalistischen Banden anschlossen oder neue bildeten; und jenes andere Gesetz, das ohne die Macht zu ihrer wirksamen Durchführung eine progressive Vermögensabgabe vorschrieb, als deren Folge alsogleich die vielen neuen und unkontrollierbaren Vermögen sich ins ungreifbare verflüchtigten, während die großen Bankiers, die noch kurz vorher ihre finanzielle Leistungsfähigkeit durch Anleihengarantien geoffenbart hatten, ihre Kapitalien noch weiter schrumpfen sahen und in gleicher Proportion ihre Sympathien für eine solche Republik schwinden fühlten. Dazu dann die militärischen Niederlagen, die von den Feinden bedrohten Grenzen und gleichzeitig die Verschärfung aller Parteikämpfe angesichts der Unzulänglichkeit der Regierung, das Anwachsen des Royalismus sowie des Jakobinismus, drohender Terror von rechts und links. Das war das Frankreich, das Bonaparte durcheilte und das ihm, den es »l'Italique« und »l'Égyptiaque« nannte, den der Papst seinen lieben Sohn und der Großscherif von Mekka den Beschützer der Kaaba genannt hatte, als dem vom Schicksal gesandten Retter zujubelte. Nun erfuhr Bonaparte auch, daß, seit es mit den Dingen des Krieges wie mit denen im Inneren immer schlimmer gegangen war, im Volke sich die Meinung festgesetzt hatte, er sei durch Ränke der Regierung aus dem Lande entfernt worden. Und hundert kleine Beispiele, wie das, daß eine bettelarme Frau der Kirche ein paar Franken gelobt hatte, wenn nur er wiederkäme, zeigten ihm, wie er über alle Hoffnungen hinaus erwartet und ersehnt worden war. Hätte er in diesem Augenblicke sein lange später ausgesprochenes Wort, daß Frankreich seine einzige Geliebte sei, in seinem Herzen empfunden, so wäre er ein einziges Mal in seinem Dasein dem καιρὸς, dem rechten Augenblick in der Liebe begegnet. Aber im Herzen dessen, dem als dem »Retter der liberalen Ideen« zugejubelt worden, glomm andere Glut als Liebe.
Eugène hatte mit dem von Fréjus vorausgeeilten Kurier seiner Mutter die Ankunft mitgeteilt, wohl damit sie den Vorsprung dieser Nachricht nützen und Bonaparte entgegenkommen sollte, ehe noch Mitglieder seiner Familie ihn in seinem noch immer schmerzenden Entschlusse zur Scheidung vollends gefestigt hätten. Es mußte etwas in der Luft gewesen sein, das sogar Josephinen die Möglichkeit von Bonapartes jäher Rückkehr zu Bewußtsein brachte; denn sie hatte neuerlich in ihrem offiziellen Verkehr solche Leute zu bevorzugen begonnen, die dem Gatten nicht mißfallen würden. So hatte sie sich zum Beispiel dem ihr sicher grundlangweiligen Ehepaare Gohier angeschlossen. Gohier war seit kurzem Vorsitzender des Direktoriums; dieser brave revolutionäre Bürger hatte ihr schon einmal, empört über all das unwiderlegbare Gerede über sie, ernsthaft nahegelegt, sich scheiden zu lassen und Charles zu heiraten. Nun kam Josephine immer öfter, lud die beiden ein und sagte eines Tages in einer ihrer sonstigen Gewandtheit recht widersprechenden Naivität, sie hoffe, daß Bonaparte es ihr anrechnen werde, wenn er sie in regem Umgang mit so ehrbaren Leuten sähe.
Dennoch kam dann die Nachricht von der Landung in Fréjus wie die Posaune des Gerichts. Josephine scheint erst völlig den Kopf verloren zu haben; und einer der alten Bekannten, Réal, hatte Mühe, ihr zu Bewußtsein zu bringen, daß ihr Heil, wenn sie noch irgend auf diese Ehe hielte, einzig darin liegen könne, den zweifellos auch schon unterrichteten Schwägern zuvorkommend Bonaparte entgegenzueilen. Daß Barras sie dazu bestimmt habe, wie behauptet wird, um sich sogleich des Wiederkehrenden als Bundesgenossen zu versichern, ist wenig wahrscheinlich; einerseits weil Josephine neuerdings mit Barras nicht zum besten stand, andererseits auch, weil dieser in seiner selbstgefälligen Sicherheit weder einen Bundesgenossen zu brauchen glaubte noch auch daran zweifelte, daß im Bedarfsfalle der kleine Bonaparte ihm Schwierigkeiten machen könne.
Die große aus dem Süden kommende Poststraße teilte sich in Lyon: ein Ast führte durch Burgund nach Paris, der andere durch das Bourbonnais. Die zweite Straße scheint die häufiger benutzte gewesen zu sein. War es darum, daß Bonaparte sich schon beim Aufbruche für die erste entschied? In dem an ihr liegenden Sens wohnten Bourriennes Mutter und Frau, und bei ihnen hatte er sich zu kurzer Rast während einer Mahlzeit angesagt. Josephine jedoch hatte den anderen Weg eingeschlagen und reiste tränenreich dem Ungewitter entgegen. Ein jeder von ferne auftauchende Wagen machte ihr Herz zittern. Doch Bonaparte war in keinem. So kam sie elend und verzagt bis Lyon, wo sie noch das Ausglimmen festesfreudiger Erregung aus Empfang und Geleite des Heimgekehrten vorfand und wo die ersten fabelhaften Berichte über des Gatten Triumphfahrt durch die Provence sie mit dem niederdrückenden Gedanken erfüllten, daß sie vielleicht nun für immer von all der Herrlichkeit ausgeschlossen sein würde. Die Rückfahrt war kummervoll und noch verbittert durch die Besorgnis, die Schwäger möchten glücklicher in der Wahl des Weges gewesen sein und Bonaparte bereits mit all ihren gehässigen Nachrichten empfangen haben.
Widersprüche in den Aufzeichnungen und Denkwürdigkeiten, die über diese Tage erzählen, lassen nicht mit Sicherheit erkennen, ob Joseph und Lucien Bonaparte ihren Bruder nicht auch unterwegs verfehlt und erst in Paris noch genauer über Josephinens Zusammenleben mit Charles in Malmaison unterrichtet hätten. Sicher ist jedoch, daß ihm kein Detail, das irgend gewußt werden konnte, erspart geblieben ist.
Bonapartes Regiekunst, sein Wiederauftreten durch die vorausgesandte Nachricht von der bei Abukir gewonnenen Schlacht besonders wirksam zu machen, hatte in glückhaften Umständen unerwartete gewaltige Helfer gefunden. Beinahe gleichzeitig mit seiner Siegesnachricht trafen die ersten Botschaften seit langem ein, die von kriegerischen Erfolgen der französischen Armeen zu melden hatten, von dem bedeutsamen Siege bei Bergen und dem entscheidenden bei Zürich. Und alsbald durfte Bonaparte, dem dieses Zusammentreffen erst als recht ungünstig für ihn hatte erscheinen wollen, bemerken, daß die Taten Brunes und Massénas ihm auf das wunderbarste zugute kamen; es war, wie eine liebende Frau in ihrem Gefühle etwa Glücksfälle, die ihr am Tage der Wiederkunft des lange erwarteten Geliebten geschehen, natürlich mit ihm in Verbindung bringt.
Am frühen Morgen des 16. Oktober fuhr Bonaparte unbemerkt in Paris ein und begab sich in die Rue Chantereine, die nun schon seit zwei Jahren ihm zu Ehren Rue de la Victoire hieß. »Er fand das Haus wieder, wo er nach dem Italienfeldzuge seinen unrasterfüllten Ruhm geborgen hatte, in einem neuen stillen Viertel, kaum noch bebaut und von heiterem Grün gesäumt ... Das erste Gemach in Form eines Halbrunds, den Salon mit seinen pompejanischen Malereien, das Arbeitszimmer mit dem Blick auf den recht schönen Garten, wo die Bäume sich zu entlauben begannen und die Blässe der antiken Vasen sich vom rostenden Laubwerk abhob. Er sah die eheliche Wohnung wieder mit ihrem Mobiliar in einem extravaganten heroisierenden Geschmacke, Tabourets in Trommelform, das Bett wie ein Zelt gestaltet, die Stuhllehnen geschwungen wie die Bogen antiker Krieger, von Köchern flankiert, ringsum Gesuchtheit und Absonderlichkeit in der Möblierung. Ein recht auf Schein gerichteter Luxus, ein wirres Durcheinander von Kunstgegenständen und Nichtigkeiten, was alles zusammen an Josephine erinnerte und ihren Stempel trug.«
Wenn auch Bonaparte nicht im unklaren darüber sein konnte, warum er Josephine in Paris nicht vorfand, wuchs doch angesichts des leeren Hauses sein trauriges Zürnen, unter dem ein uneingestandenes Jünglingshoffen bis zuletzt noch auf irgendein Liebeswunder gewartet hatte. Nun hatte er den Brüdern wie vor allem der Mutter Lätizia nichts mehr zu Josephinens Gunsten entgegenzuhalten, dieser in Kampf und Darben eng und hart gewordenen Matrone, der Josephinens Ehebruch mindestens ebenso himmelschreiend erschien wie ihre Verschwendungssucht. Was Bonaparte nun noch mit Josephinen ins reine zu bringen hatte, mußte wohl eine lediglich juristische Angelegenheit werden und als solche einfach genug sein. Josephine hatte ja selber die kürzeste und leichtest zu lösende Form der Eheschließung gewählt, so würde die Scheidung wie tausend andere in dieser Zeit ein leichtes sein. Das Haus gehörte ja ihm, er hatte es gekauft. Im übrigen mochte er über all das, was in diesem Hause unaufhörlich mit Bildern, Frauendüften und aufschrecken machenden Geräuschen nach ihm griff, jetzt ganz und gar nicht nachdenken.
Aus diesen Tagen berichtet Bourrienne von einem Gespräch, das Bonaparte mit Collot über seine Frau und ihre allgemein bekanntgewordenen Verfehlungen geführt habe: »›Zwischen ihr und mir‹, sagte Bonaparte, ›gibt es nichts mehr Gemeinsames.‹ ›Wie, Sie wollen sie verlassen?‹ ›Hat sie es denn nicht verdient?‹ ›Das weiß ich nicht, aber ist das jetzt der rechte Augenblick, sich darum zu bekümmern? Denken Sie doch an Frankreich, das seine Augen auf Sie gerichtet hat. Es erwartet von Ihnen, daß alle Ihre Augenblicke seinem Heile gewidmet seien; wenn es bemerkt, daß Sie sich über häusliche Fragen erregen, ist Ihre Größe dahin, und Sie sind in seinen Augen nicht mehr als ein Molièrescher Ehemann. Lassen Sie doch jetzt das Unrecht Ihrer Frau; wenn Ihnen das nicht genügt, können Sie sie ja fortschicken, sobald Sie nichts anderes mehr zu tun haben; aber beginnen Sie doch damit, daß Sie dem Staat aufhelfen ... ‹ ›Nein, das ist eine beschlossene Sache, sie setzt keinen Fuß mehr in dieses Haus. Was liegt mir daran, was man darüber sagt? Man wird einen oder zwei Tage darüber klatschen, am dritten Tage redet kein Mensch mehr davon ... Meine Frau geht nach Malmaison, und ich bleibe hier. Die Öffentlichkeit weiß genug, um sich über die Gründe ihrer Entfernung keinen Täuschungen hinzugeben.‹ Auf die Bemerkung Collots, daß Bonaparte anscheinend doch noch in sie verliebt sei und ihr wohl doch verzeihen würde, antwortete dieser: ›Ich, und ihr verzeihen! Niemals! Sie kennen mich ja zur Genüge. Wenn ich meiner nicht sicher wäre, risse ich mir das Herz aus dem Leibe und würfe es ins Feuer.‹«
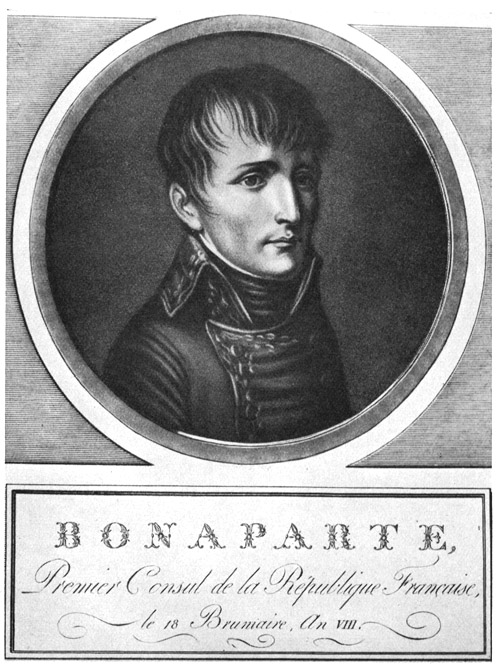
8. Bonaparte
So sehr die Übertriebenheit dieses letzten Ausrufes Collots Meinung zu bekräftigen scheint, ist doch in diesen Tagen von Josephine weiter nicht mehr die Rede. Und betrachtet man, wie ungeheuerlich erfüllt diese Zeit für Bonaparte war, so kann man meinen, daß kaum noch Platz selbst für kurze Selbstgespräche gewesen sei, die ihr gegolten hätten. Denn jetzt hatte das private Leben aufzuhören, schicksalsvolle Tage standen vor ihm; Entschließungen ohnegleichen waren zu treffen; alles ringsum mußte sogleich erfahren, erfaßt und dienstbar gemacht werden. Die ganze Wirklichkeit dieser Republik roch verdächtig, ein Flüstern und Raunen und Schleichen ging mit schlimmen Heimlichkeiten um, und ehe Bonaparte noch die Männer und Körperschaften vor sich gesehen hatte, die diesen Staat verkörperten, ahnte er, wie es bestellt sei, und auch, daß sie in der Mehrzahl sein Kommen anders aufnähmen als die plötzlich wieder gläubigen Massen: diese Massen, die durch zehn Jahre voll immer neuer Umstürze, Kriege, Staatsstreiche, durch immer wieder enttäuschte Hoffnungen, die in immer tieferes Elend geführt hatten, endlich wie lange gequälte, mißbrauchte und elend genährte Tiere geworden waren, die abgestumpft auch noch dem größten Lärm und der schlimmsten Drohung keinen Blick mehr schenkten. Daß dieses wie erstarrt gewesene Volk von Frankreich durch sein Kommen wirklich erwacht war, war nun in Paris noch weniger zu verkennen denn in den durchfahrenen Provinzen.
In den lebendigen und anschaulichen Denkwürdigkeiten des Generals Thiébault wird erzählt, wie Paris die Nachricht von Bonapartes Rückkehr aufnahm. Thiébault war in den Garten des Palais Royal gekommen und sah hier am anderen Ende unaufhörlich sich bildende und lösende Gruppen, die einen anscheinend etwas Erzählenden umdrängten und sich dann sogleich in lauter Einzelne auflösten, die eilends hinwegjagten, um die erfahrene Neuigkeit zu verbreiten. Einer von ihnen rief ihm zu: »Der General Bonaparte ist in Fréjus gelandet!« Überall anders las Thiébault die Neuigkeit auf allen Gesichtern und fand die Straßen voll von sich drängenden und stauenden Massen. Mit schmetternder Fröhlichkeit durchzogen Regimentsmusiken die Stadt, von wachsenden Mengen im Marschschritt begleitet. »Die Neuigkeit, die das Direktorium den gesetzgebenden Körperschaften durch einen Boten ankündigte, dem eine Militärmusik voranschritt, verbreitete sich mit elektrischer Geschwindigkeit. Jede Straßenecke zeigte eine neue Aufführung der Szene aus dem Palais Royal ... Als die Nacht einbrach, wurden in allen Vierteln Festbeleuchtungen improvisiert und diese ebenso unerwartete wie ersehnte Wiederkehr unter Hochrufen auf die Republik und Bonaparte verkündet. In allen Theatern suchten die Leute einander, um einander von dieser wunderhaften Wiederkehr zu berichten; sie besuchten einander in den Häusern, um sich dazu zu beglückwünschen, und die Begeisterung und der Überschwang, die Paris so seltsam belebten, verbreiteten sich alsbald über das gesamte Frankreich ...«
Wenngleich es heißt, daß einer der Volksvertreter namens Baudin vor Freude über die Wiederkehr Bonapartes gestorben sei, konnte dieser in der verlegenen mühsamen Herzlichkeit des offiziellen Empfanges von Seiten der Regierung, in deren Schoß freilich schon drei verschiedenartige Verschwörungen goren, nur gerade ein paar Fünklein einfach freundlicher Freude über seine Wiederkehr entdecken. Er schloß daraus auf die Unpopularität dieser ganzen Regierung, um so mehr, als er wußte, daß Monate vorher auf den Antrag, ihn zurückzurufen, unter zahlreicher Zustimmung geantwortet worden war, er möge nur bleiben, wo er sei, das größte politische Interesse erfordere es, ihn dort zu lassen. Bald war er sich überhaupt so wenig über die Gesinnung der Männer, mit denen er es vor allem zu tun hatte, im unklaren wie etwa über die Bernadottes, des eben zur Abdankung gezwungenen Kriegsministers, von dem er sehr wohl wußte, daß er ihn wegen Desertion und Verbrechen gegen die Quarantänevorschriften hatte vor ein Kriegsgericht stellen lassen wollen, und mit dem er in diesen Tagen doch mehrere Male Zusammenkünfte herbeiführte oder nicht vermied. Was ihm etwa noch an nötigen Kenntnissen über das verwickelte Durcheinander von Putschplänen und Intrigen fehlen konnte, lieferte ihm Talleyrand, der fast so viel wußte wie Fouché. Im übrigen kam ihm die dank ihm schnell angewachsene Machtstellung seines Bruders Lucien, der alsbald zum Präsidenten des großen Rates erwählt wurde, als Informationsquelle beträchtlich zugute.
Wenngleich die Geschichte dieser entscheidenden Tage hier nicht erzählt werden kann, muß doch angedeutet werden, was sich Bonaparte als wesentlich darstellte, da er sich zu raschem, allen anderen zuvorkommendem Handeln entschlossen hatte. Daß er trotz der Dankesverpflichtung und äußerlichen Freundschaft von Barras wenig hielt, hätte ihn nicht gehindert, ihn mit in Kauf zu nehmen, wenn es noch irgend gelohnt hätte. Aber Barras war bereits ganz und gar »sputtanato«, wie die Italiener von einem Handelsobjekt sagen, das bereits überall angeboten worden ist. Barras saß in keiner der wichtigen Kombinationen mehr sicher, außer in der für Bonaparte nicht erwägenswerten royalistischen Bewegung, die sich den kostspieligen geckenhaften Barras hielt, weil dieser den schlechtinformierten oder mitverdienenden Agenten seine Bedeutung eingeredet hatte, von der einzig noch er überzeugt war. Da auch die nicht unbeträchtliche jakobinisch gefärbte Gruppe sich ausschloß, blieb für Bonaparte, der politischen Anschluß suchen mußte, eine einzige Bündnismöglichkeit: die mit Sieyès und seinem Anhange. Daß dieser Abbé ihm ganz und gar nicht gefiel und eigentlich recht gegen die Natur ging, war als Einwand bald dadurch entkräftet, daß dieser nicht nur den intelligentest organisierten Vorstoß gegen die abgelebte Konstitution des Jahres III plante, sondern daß er anscheinend auch willens war, nach etlichen ergebnislosen Fühlungnahmen mit anderen Generälen es mit dem populärsten Heerführer Frankreichs zu versuchen. Bonaparte dachte ähnlich über Sieyès wie der royalistische Berichterstatter, der über ihn an den Prätendenten schrieb: »Sieyès ist ein mürrischer, nahezu ungeselliger Mann. Er ist düster verbohrt in seine Ideen und unfähig, sie zu verteidigen; und er versteht niemals, was das heißt, auf eine gescheiterte Meinung wieder zurückzukommen; er verbirgt die Liebe ebenso wie den Haß. In den Staatsgeschäften ist er nichts anderes als ein kaustischer Heuchler und ein in Heimlichtuerei gehüllter Sprecher.« Daß Sieyès, der dank diesen Eigenschaften als Konventmitglied dem Schafott entgangen war, als scharfsinniger Jurist brauchbar und vermöge einer tief eingewurzelten bürgerlichen Autoritätsgläubigkeit auch als Mitanbahner eines Umsturzes nicht zu fürchten sei, ahnte Bonaparte.
Als nach dem dritten dieser Tage voll sechzehnstündiger Anspannung aller Kräfte Bonaparte sich eben erschöpft zur Ruhe zurückgezogen hatte, wurde an die Türe des Ehegemaches gepocht. Josephine, eben aus dem Wagen gestiegen, in Reisekleidern, verlangte Einlaß. Die tiefe Müdigkeit aus diesen ihren Tagen voll jagender Reise, voll Erregung, Enttäuschung und Jammer hatten ihre Ängste vor dem Wiedersehen ermattet: was ging sie Charles an und all das? Sie wollte einfach nach Hause, in ihr Haus, in das Ehehaus zurück. Sie verstand nicht mehr, was sich nun noch dagegen stellen konnte, da sie ja zurück wollte. So pochte sie an die Tür, die verschlossen war, pochte wieder, immer lauter, immer ungeduldiger, da keine Antwort erfolgte. Er war in dem Schlafzimmer, das wußte sie durch die Dienstleute. Er sollte doch antworten, sollte öffnen! Ihre Hände schmerzten sie schon. Sie rief seinen Namen, immer wieder, sie legte das Ohr an die Tür. Es war schaurig still in dem Raum, in dem doch Licht brannte. Jetzt begann die Angst wieder, gräßlicher als zuvor. Erst die, jetzt wieder in die schon kalte Nacht hinaus zu müssen, dann: wohin denn? Wohin überhaupt? Nach Malmaison? Es war so weit jetzt bis dahin! Und dann begann wohl das wehevolle Durcheinander in ihr: das unbezahlte Malmaison, die Schulden, und immer weniger Menschen würden dahin zu ihr kommen ... Einsamkeit, Not, Schmuckverkaufenmüssen, Lieblosigkeit! Charles wollte sie nie, nie wieder sehen! Hätte sie doch nicht ... Sie stand noch immer vor der Tür, weinend, klopfte schon kraftlos und ohne Hoffnung, und jetzt, da alles verloren schien, mag die wunderliche tragische Paradoxie des Herzens ihr Werk begonnen und ihr zum ersten Male jäh den kleinen Mann da drinnen, mit dem sie so selbstverständlich gespielt hatte, mit der wehevollen Glorie letzten hingehenden Glücks des Daseins umkleidet haben. Und nun am Rande ihrer Kräfte, vielleicht mit einer armseligen Genugtuung über die so unerwartet geoffenbarte Größe ihres Verlustes, ließ sie das Pochen und das Hoffen und wollte gehen. Da kam die Zofe. Die wußte, was auf dem Spiele stand – wer hätte es hier auch nicht gewußt –, und sie begann auf Josephine einzureden, sie aufzurütteln. Und endlich, ob einem eigenen Einfall folgend oder einem Gedanken ihrer Herrin, der eine letzte aufflackernde Hoffnung, eine Ahnung vom Wesen dieses stummen Mannes da hinter der Tür gebracht hatte, eilte sie hinweg, um die Kinder zu holen. Und Hortense, die jetzt schon in dem Alter war, in dem Josephine verheiratet worden war, und Eugène, der Bonaparte immer mehr Sohn, Zögling und Vertrauter zugleich geworden war, pochten nun mit der Mutter an die Tür, baten, flehten, weinten endlich wie Josephine, die nun schon endlose Stunden hier gestanden hatte. Und was aller Appell an die unter Zorn und Gekränktheit verschüttete Liebe Bonapartes nicht vermocht hatte, erreichte das Schluchzen und Betteln der Kinder. Alle noch überlebende Zärtlichkeit für Josephine, alles aus dieser ersten größten Liebe seines Lebens noch heraufquellende Gefühl verkleidete sich in heißes Mitleid mit Eugène und Hortense, die ihn anflehten, er solle sie nicht abermals zu Waisen machen. Und da ihm in diesen Stunden, in denen er reglos Josephinens Pochen, Flehen und Weinen gelauscht hatte, klar geworden sein mochte, daß diese um Einlaß jammernde Bittstellerin nie mehr wieder die unfaßbare, böse, schöne Macht aus seiner Liebe haben würde, öffnete er die Tür. Und er sah Josephine tränennaß, wankend, sah die Kinder, die sich vor ihm auf die Knie geworfen hatten. Und aller Groll war fort. Er wußte: das war völlige Unterwerfung! Etwas anderes hatte begonnen, an dem das Gewesene kaum mehr Teil hatte. So nahm er die todmatte Josephine freundlich in seine Arme, und er merkte, daß er im Grunde recht zufrieden war, daß zu all dem vielen, das zu tun ihm nun bevorstand, nicht auch noch eine Scheidung gehörte.
Anderen Morgens empfing er seinen Bruder Lucien im Ehebette neben Josephinen.
Alle Berichte aus der nächsten Folgezeit erzählen übereinstimmend, daß Bonaparte auch nicht mit einem Tonfalle mehr an das gerührt hat, was er in jener Nacht vergeben hatte, und daß auch Josephinen niemand etwas von dem Geschehenen anzumerken vermochte, es sei denn, daß in den Gesellschaften ihr Blick häufiger denn je zuvor Bonaparte suchte. Und der Geselligkeit gab es wieder recht viel in dem Hause in der Rue de la Victoire. Bonaparte, der jetzt das Haar kurzgeschnitten hatte, braungebrannt von der ägyptischen Sonne und der langen Seefahrt war und oft eine Tracht trug, die Anlehnungen an die eines Paschas zeigte, gab Josephinen kleine Winke, wen sie in Gespräche zu verwickeln, zurückzuhalten oder etwa hindern sollte, zu merken, daß er selbst mit anderen sich heimlich in sein Arbeitszimmer zurückgezogen hatte. Und Josephine gehorchte mit freudiger Gewandtheit, bestrickte die Gäste durch ihr kunstreiches Lächeln, das die jetzt schon recht schlecht gewordenen Zähne nicht sehen ließ, und durch die vollendeten Bewegungen ihres noch immer schönen Körpers. Ihre Tage waren angefüllt mit Menschen, die ihr hundert Liebenswürdigkeiten sagten und kleine Geschichten erzählten; es waren fast alles »reizende« Menschen, wenn man sie nur richtig zu nehmen wußte. Daß hinter alldem, dem sie da liebenswürdig diente, etwas vorgehe, was am Ende gar wieder eines dieser historischen Ereignisse werden könnte, ahnte sie ganz und gar nicht. So war sie, die erste Unterworfene auf Bonapartes nunmehrigem Weg der Unterwerfung, guter Dinge und oftmals wahrhaftig so verliebt in ihren Mann, daß sie sich selber gar nicht wiedererkannt hätte, wenn sie nicht eben schon seit jener Nachtstunde im Ehegemache das eilfertige Vergessen angefangen hätte, aus dem das Anderswerden der meisten Frauen besteht.