
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es war in der ersten Morgenfrühe des folgenden Tages. Nur wenige Personen belebten schon jetzt die Straßen, Leute, welche zur Arbeit gingen, Verkäufer und Kutscher, auch wohl hohläugige Gestalten, denen man es ansah, daß ihr Thun und Treiben nur im Schatten der Nacht so recht gedieh. Alle diese Menschen blieben, wenn sie an dem Hause des Eisenhändlers Neubert vorübergingen, wie von plötzlichem Interesse ergriffen, stehen und sahen zur Thür des Gebäudes, als enthalte dieselbe etwas besonders Bemerkenswertes; einige schlichen auch wohl auf den Zehenspitzen behutsam über den Fahrdamm und bis unter die Mauern des Hauses, dann aber eilten sie davon, als sei ihnen ein Gespenst entgegengefahren, manche sogar mit einem halberstickten Ausruf des heftigsten Schreckens.
Allmählich wurde der Verkehr lebhafter, herumlungernde Soldaten, Gesindel, das in irgend einer Thorfahrt oder auf einer Treppe übernachtet hatte, auch Offiziere kamen des Weges und nun bildeten sich Gruppen, die sämtlich vor der Thür Posto faßten und endlich zu einer dichtgedrängten Menge zusammenflossen. Eine gewisse angenehme, aber doch auch halb und halb unruhige Erwartung schien alle diese Leute zu beherrschen.
»Jetzt kommt jemand!« flüsterte eine Stimme.
»Eben bewegten sich die Fenstervorhänge!«
»Lieber Gott, die armen Leute! Frau Neubert kann vor Schreck den Tod haben.«
»Pst! Die Deutschen bedauern heißt so viel, als seinen eigenen Kopf in die Schlinge stecken. Jeder für sich und Gott für uns alle!«
Ein Schlüssel knarrte im Schloß, die Thür öffnete sich und Herr Neubert sah auf die Straße hinaus. Eine Todesstille empfing ihn; man hörte das Summen der Insekten im Sonnenschein, so vollkommen ruhig verhielt sich die Menge. Ein großes Unglück flößt doch, ob auch noch so gemeine Schadenfreude die Gemüter erfüllt, selbst dem Rohesten Respekt ein.
»Leute!« fragte mit ruhiger, weithin verständlicher Stimme der Kaufmann, »was geht hier vor? Was habt ihr?«
Wieder antwortete ihm niemand, – da sah er im Morgenwind ein weißes Papierblatt hin und her flattern, es war mit einem Stift am Thürrahmen befestigt und auf der vorderen Seite beschrieben. Ein schneller Griff brachte es in die Hände des erschreckten Mannes, er erbleichte, seine Füße schienen den festen Halt zu verlieren, dann trat er plötzlich zurück in das Haus und schloß die Thür.
»Nun hat er's!« flüsterten einige.
»Verdientermaßen! Man sah ihn immer mit den übrigen Deutschen die Köpfe zusammenstecken, sie haben auch in den Nächten Pakete getragen und allerlei Versammlungen abgehalten. Die Deutschen sollten alle mit blanker Waffe zum Lande hinausgetrieben werden!«
»Hurra für Jefferson Davis!«
»Hipp! Hipp! Hurra!«
Die Menge verlief sich, während drinnen im Hause der Kaufmann das verhängnisvolle Blatt ansah und ein Gefühl des aufsteigenden Entsetzens vergebens zu bekämpfen suchte. Was hier geschrieben stand, das kam dem gefällten und verkündeten Todesurteil vollständig gleich.
Frau Neubert und Hermann sahen dem Oberhaupte der Familie über die Schulter und lasen mit ihm. Eisige Schauer rieselten durch die Adern der Unglücklichen.
Auf dem weißen Blatte stand Folgendes:
»Vorladung!
Der Kaufmann Ferdinand Neubert wird von dem unterzeichneten Komitee hierdurch aufgefordert, sich am heutigen Abend um elf Uhr präzis im Gasthause zum Stern Amerikas im kleinen Saale einzufinden und zwar zum Zwecke der Verantwortung, folgenden Anklagen gegenüber:
1. Parteinahme für die Nordstaaten. Abolitionistische Gesinnung.
2. Pläne zur Flucht durch die Belagerungslinie.
3. Unerlaubte Sympathieen für Neger.
4. Teilnahme an heimlichen Versammlungen von Sklaven, zum Zweck einer Aufwiegelung derselben durch Reden und Belehrungen.
Es wird in der anberaumten Versammlung nach Recht und Billigkeit gerichtet werden; sollte aber der Kaufmann Neubert vorziehen, zur festgesetzten Stunde nicht zu erscheinen, so hat er von vornherein auf eine Verteidigung vollständig verzichtet und sich selbst der genannten Verbrechen schuldig erklärt. In diesem Falle ist sein Todesurteil hiermit ausgesprochen. Möge er sich versteckt halten, wo es sei, möge er zu Hilfe rufen, wen er wolle, der Richter Lynch wird ihn finden und seines Amtes walten.
Das Vigilanz-Komitee.«
Frau Neubert legte beide Hände über die Augen. »Gott, Gott, du hast uns verlassen!« bebte es von ihren bleichen Lippen.
»Still, Anna!« tröstete ihr Mann. »Still, du versündigst dich!«
Die arme Frau schluchzte leise, diesem entsetzlichen Schlage gegenüber konnte sie ihre Fassung nicht bewahren, wie gebrochen lag sie auf den Knieen, unfähig, sich zu beherrschen.
»Vater!« flüsterte Hermann. »Gehst du hin?«
»Nein! Ach um des Himmels willen nein!« ächzte Frau Neubert.
»Ich gehe,« nickte der Kaufmann. »Ich muß es, wenn auch an kein freisprechendes Urteil zu denken ist, – wir gewinnen doch etwas Zeit.«
»Aber wenn du gleich heute abend thätlich angegriffen würdest, Vater? – Ach, könnten wir doch schon flüchten!«
»Das ist unmöglich, wie du sehr wohl weißt, mein Junge! – Ich gehe zur festgesetzten Stunde hin und – nehme aus Gottes Händen das mir bestimmte Schicksal entgegen. Soll ich glücklich davonkommen, so wird keiner dieser Rowdics mir ein Haar krümmen können.«
Frau Neubert erhob sich und streckte flehend beide Arme aus.
»Geh' nicht hin, Ferdinand, geh' nicht hin,« schluchzte sie. »Mir ahnt Schlimmes!«
Aber er blieb standhaft. »Ich muß, Anna! Glaube mir, daß ich weiß, was ich sage. Wolltest du denn in dieser Nacht unter den Trümmern unseres Hauses erschlagen werden? Wolltest du, daß diese Bestien in Menschengestalt kämen und vor deinen Augen die Kinder erwürgten?«
»Das alles geschieht auch, wenn du hingehst, wenn sie dich umgebracht haben, Ferdinand!«
Er schüttelte den Kopf. »Sie bringen mich nicht um, Anna, sie plündern mich nur aus und überlassen den Verarmten seinem Schicksal. Du weißt, daß unsere wertvollsten Besitztümer geborgen sind.«
Die weinende Frau kannte ihren Mann, sie wußte, daß es vergeblich sein würde, ihn überreden zu wollen und ergab sich stumm. »Welch' eine Zeit, die in der wir leben!« sagte sie mit gerungenen Händen. »Gott hat Amerika verlassen!«
»Er erbarmt sich endlich, endlich seiner schwarzen Kinder! – Und wenn auch über die Weißen noch so großes Leid kommt, das Ziel wird doch erreicht!« –
Er war sehr blaß, der bedrohte Mann, als er diese Worte sprach, aber vollkommen ruhig. »Das Boot liegt sicher versteckt,« sagte er. »Ich gebe nichts verloren, obwohl wir für unsere Kinder schwerlich morgen noch ein Obdach besitzen werden. Man macht das Haus dem Boden gleich!«
»Wobei dann die Trümmer auf den Schuppen fallen und jede Spur unseres heimlichen Lagers verdecken! Ja, Vater, es kommt nur darauf an, das Leben zu retten!«
»Ihr begebt euch heute abend in den Schutz eines befreundeten Hauses,« versetzte Herr Neubert. »Ach, wenn jetzt Mr. Charles Trevor noch lebte!«
Hermann trocknete sich die Augen. »Auch Lionel ist ins Elend gestürzt,« seufzte er.
»Wir werden ihn mit uns nehmen, mein Junge! Kommt Kinder, ihr müßt nicht weinen, nicht alles verloren geben! – Hole die Kleinen, Mama, Hermann soll uns etwas vorspielen, die Musik stimmt das Herz froh und hoffnungsvoll, sie lenkt den Blick zu Gott empor.«
Der Knabe hatte schon das Piano geöffnet. »Dein Lieblingsstück will ich nehmen, Vater! – Sieh, die ganze Straße steht voll von Menschen, was werden die wohl sagen, wenn sie uns hier drinnen singen hören?«
Herr Neubert zog die Vorhänge fester zusammen. »Das kümmert uns nicht, mein Junge!« versetzte er. »Da ist Mama mit den Kleinen, – so, nun wollen wir unsere Morgenandacht halten.«
Sein Herz zog sich krampfhaft zusammen, als er die Kinder in seine Arme nahm und küßte, das kleinste schien er kaum wieder freigeben zu können. Ob nach diesem Tage jemals ein anderer folgte, an dem er so inmitten seiner Lieben den Frieden des eigenen Hauses genießen durfte? Ob er glücklich den Krallen der erbitterten Feinde entrinnen würde?
Neben ihm stand die treue Gefährtin seiner Jugend, die, welche mit ihm über das Meer gezogen war, liebevoll und emsig bemüht für das Wohl der Ihrigen, aufopfernd in jeder Stunde, heute aber bleich wie der Tod, ganz gebrochen von der Schwere des Verhängnisses, das so plötzlich ihre Ruhe vernichtete. Mit bebenden Händen hielt die arme Frau das jüngste Kind an ihre Brust gepreßt, während der Vater die beiden älteren auf seine Kniee gesetzt hatte. »So, mein guter Hermann,« sagte er, mit Mühe seine Stimme beherrschend, »nun fange an.«
Leise und schmeichelnd erklang unter den kunstgeübten Händen des Knaben ein Vorspiel, dann ging er allmählich über in eine bestimmte Melodie, in Töne, die kräftig daherbrausten und mit ihrer Allgewalt die Herzen erhoben und trösteten. Es war Paul Gerhardts wunderbare Dichtung, die Herr Neubert allen anderen Liedern vorzog, es waren deutsche Worte, die jetzt von den Lippen der Eltern und Kinder erklangen:
»Gib dich zufrieden und sei stille,
In dem Gotte deines Lebens,
In ihm ruht aller Freuden Fülle,
Ohn' ihn mühst du dich vergebens.
Er ist dein Quell und deine Sonne,
Scheint täglich hell, zu deiner Wonne,
Gib dich zufrieden!«
Fest und zuversichtlich klang die Stimme des Familienvaters, halb schluchzend die der Mutter und ihrer Kinder. Das jüngste hielt andächtig seine Händchen gefaltet, es wußte, daß es noch nicht mitsingen durfte, aber eben sowohl auch, daß es sich bei einer musikalischen Feier ganz still verhalten müsse. Mächtig anschwellend erklang die schöne, getragene Melodie, selbst auf den Haufen draußen unter den Fenstern äußerte sie ihre besänftigende Wirkung. Alte Mütterchen blieben stehen und sangen ganz leise oder nur in Gedanken die frommen Worte mit, schleichend gingen Soldaten vorüber, still im Augenblick, wo sie noch eben Flüche und Verwünschungen auf den Lippen führten. Die Kinderstimmen da drinnen klopften wie Engelhände auch an harte, verschlossene Herzen.
Und nun kamen die Schlußzeilen. »Er hört die Seufzer deiner Seelen und des Herzens stilles Klagen,« – Frau Neubert sank neben ihrem Manne auf die Kniee, überwältigt vom Weh, von dem weihevollen Ernst der Stunde, – er legte um sie und das kleinste Kind den Arm, er schien es gerade ihr, der Schwergebeugten verkünden zu wollen, was der Sänger dem Trauernden, Unglücklichen zuruft, was er als selige Verheißung, als Trost in Thränen dem Weinenden verspricht: »Er ist nicht fern, steht in der Mitten, hört bald und gern der Armen Bitten, – gib dich zufrieden!«
Es wurde draußen an die Thür geklopft, ein Freund aus der deutschen Kolonie hatte von dem geschehenen Unglück gehört und kam, um zu trösten, um seinen Beistand anzubieten. »Deine Frau und die kleine Schar nehme ich auf, Neubert,« sagte er. »Es wird ihnen, so lange mir mein Haus noch bleibt, an nichts fehlen, dich selbst aber begleite ich heute abend in die Höhle des Löwen. Sie sollen sehen, daß sich deutsche Männer nicht fürchten, die Raubritter!«
Hermanns Wangen hatten sich mit Purpur überzogen. »Vater!« rief er, »wenn Herr Behrens dich begleitet, so laß' auch mich mitgehen!«
Der Kaufmann schüttelte den Kopf. »Keiner von beiden,« antwortete er. »Man verurteilt mich zur Zahlung einer Strafsumme, das ist alles; ich werde bei der Sache ein armer Mann, aber schwerere Folgen können, so weit meine Ansicht geht, nicht eintreten.«
Während er die Worte sprach, begegneten sich seine und Herrn Behrens' Blicke, nur sekundenlang, aber beide mit bedeutsamem Ausdruck. Es stand in den vier Augen eine bange Frage geschrieben.
»Jetzt packen Sie Ihre Sachen, liebe Frau Neubert,« ermahnte Behrens. »Nehmen Sie mit, so viel sich tragen läßt; Betten, Kleider, Hausgerät, – ich schicke später meine Knechte mit einem Wagen, um es hinüberzubefördern. Das beste wird dann sein, unter der Hand alles Entbehrliche zu verkaufen.«
Herr Neubert lächelte. »Es ist nur noch sehr wenig vorhanden,« sagte er, »miteinander vielleicht kaum für fünfhundert Dollar. Aber das Haus! das Haus! – All' mein sauer erworbenes Kapital steckt darin und geht ohne Rettung verloren.«
Behrens drückte ihm tröstend die Hand. »Laß' fahren dahin!« versetzte er. »Wenn wir mit heiler Haut aus den Wirrnissen dieser schrecklichen Zeit hervorgehen, so wollen wir von Glück sagen, Ferdinand. Behalte den Kopf oben, alter Freund! Mut verloren, alles verloren!«
»Das weiß ich!« nickte Neubert. »Du sollst mich immer gefaßt finden, auch in den schlimmsten Fährnissen. Gefaßt sage ich, aber doch traurig. In dem Hause stecken sozusagen meine besten unersetzlichen Jugendjahre, – es ist schwer, gegen das Alter hin nochmals beginnen zu müssen.«
Er griff mit der Rechten einen vollen Akkord und schloß dann das Instrument. »Diese Nacht fahren die roten Flammen darüber hin, – es ist nicht anders. Wir dürfen nur vorwärts sehen, Kinder! Kommt, kommt, laßt uns auswählen, was mitgenommen werden soll.«
Herr Behrens bot den Eltern und den Kindern zum Abschied die Hand, dann ging er mit dem Versprechen, in einigen Stunden einen Wagen zu schicken. Dieser Freund war treu, der Kaufmann konnte sich auf ihn vollständig verlassen.
Während des ganzen Tages wurde nun für den Umzug gerüstet und als der Abend herabsank, fand sich die kleine Familie zum Abschied zusammen. Herr Neubert konnte den Seinigen die Todesblässe, welche sein Gesicht bedeckte, nicht verbergen, aber er war jetzt ruhig. »In zwei Stunden hoffe ich euch wiederzusehen,« sagte er. »Geht mit Gott, die Trennung ist nur eine kurze.«
Frau Anna kämpfte mit einer Ohnmacht. »Wenn ich dich begleiten könnte!« flüsterte sie.
»Um des Himmels willen nicht! Adieu Kinder, adieu! Macht es kurz, – ich muß alle meine Ruhe, meine Überlegungskraft bewahren.«
Hermann hing am Halse seines Vaters, er konnte vor Schmerz nicht sprechen, nur seine Blicke zeigten, was in ihm vorging. Herr Neubert streichelte das blasse Gesicht, er küßte den Knaben und zog ihn nahe zu sich. »Du darfst nicht weinen, Hermann, du mußt dich tapfer beherrschen, mein Junge. Während ich selbst abwesend bin, sehen deine Mutter und deine Geschwister auf dich als auf ihren einzigen Beschützer.«
Der Knabe nickte, er biß die Zähne zusammen, um nicht zu schluchzen.
Noch ein letzter Kuß, eine schmerzvolle Frage des Kleinsten, warum der Papa nicht mitgehe, dann verließ Frau Neubert, umgeben von ihren Kindern, das Haus, in dem sie glückliche Jahre verlebt hatte und das sie nun, aller menschlichen Berechnung nach, nie im Leben wieder betreten würde.
An der Thür kamen ihr Herr Behrens und seine Frau schon entgegen, um die gern gesehenen Gäste in Empfang zu nehmen; der Kaufmann überzeugte sich durch einen Blick aus dem Fenster, daß die, welche er liebte, in sicherem Schutze waren, – tief atmend blieb er in der Mitte des Zimmers stehen. Achtzehn lange Jahre hindurch, ganz ohne Mittel beginnend, nur gestützt auf den Fleiß der eigenen Hände, – achtzehn lange Jahre hindurch hatte er geschafft und gekämpft, um dereinst seinen Kindern eine gute Ausbildung zu teil werden lassen zu können, um sein Weib sicher zu stellen, im Fall ihn der Tod mitten aus seiner Laufbahn herausreißen sollte, – und nun war das alles umsonst gewesen, nun fielen die Früchte eines Lebens voll treuer, harter Arbeit einer Bande von Räubern in den Schoß.
Ein bitterer, unsäglich bitterer Gedanke.
Von jedem Stück, von jeder Stelle nahm er Abschied, der unglückliche Mann. Da, das alte Ledersofa und der schwere runde Tisch, das waren die ersten größeren Mobilien, welche er gekauft hatte, – ach so deutlich stand vor seiner Seele jener langvergangene Tag, als sie in das Haus kamen, die unschuldige Freude an dem selbsterrungenen Besitz. Damals wohnten sein Weib und er noch in einem bescheidenen Dachstübchen und den ganzen Vorrat von Eisenwaren, das ganze Lager trug er auf dem Rücken herum. Er zog durch die Umgegend als sogenannter »Pedlar,« bis er sich einen kleinen Laden mieten konnte, bis späterhin die Räume wuchsen und das Haus sich dehnte. Er war nun Grundbesitzer geworden, aber die alten Sachen hielt er hoch in Ehren, er liebte sie, wie der Mensch das liebt, was er mit saurer Mühe erworben hat. Die armen alten Sachen! – wer würde sie in der Nacht, die jetzt begann, durch den Griff seiner räuberischen Faust entweihen?
Es dunkelte bereits vollständig. Von der Wand herab klang das leise, stetige »Tik! Tak!« der Uhr, zuerst überhört, um der Gewohnheit willen, dann wie eine liebe vertraute Stimme zu den aufgeregten Sinnen des erschütterten Mannes sprechend. Er entzündete die Lampe, er sah empor zu dem Zifferblatt mit dem Rosenkranz und dem Engelsköpfchen, das daraus hervorlugte, – nein, die Uhr sollte doch niemand berühren, das Tik! Tak! keinem anderen Ohre erklingen. Seit er überhaupt denken konnte, seit seinen jüngsten Kinderjahren entsann er sich des alten Familienstückes, hatte er es lieb gehabt und hoch in Ehren gehalten. Als daheim in Deutschland die Mutter gestorben war, bat er, ihm die bescheidene Schwarzwälder Uhr aus ihrem Zimmer als teures Andenken über das Meer zu schicken und seitdem hing sie nun hier, hatte in Freude und Leid die Stunden gezeigt, hatte jeden seiner Schritte begleitet bis auf diesen Tag. Er sah sie an und ein unabweisliches Grauen ging durch seine Seele. Drei Viertel auf elf! – Es wurde Zeit; die Bestien in Menschengestalt warteten.
Festen Schrittes gehend, holte Neubert aus der Küche das Holzbeil, dann nahm er die Uhr von der Wand und legte sie auf den Fußboden. Das Ticken des Werkes erstarb, – wie schauerlich still wurde doch das Zimmer, es schien gleich einem eisigen Hauche die Luft zu durchwehen. Die Hand des gequälten Mannes bebte, aus seiner Brust brach verhaltenes Schluchzen. –
Dann hob er den Arm und schlug zu, schlug, bis nur Splitter um ihn herum lagen, tausend Trümmer, die nie eine Menschenhand wieder vereinigen konnte.
Die Stunde, in der sich sein Schicksal erfüllen mußte, sollte auch die letzte gewesen sein, der das Engelsköpfchen auf dem Zifferblatt gelächelt hatte.
Und nun durfte er keinen Augenblick mehr verlieren. Nachdem das Haus von außen geschlossen war, ging er schnellen Schrittes die Straßen hinab bis zum »Stern Amerikas,« einer schmutzigen Schenke, die er freiwillig nie betreten haben würde. Der kleine Saal lag nach hinten hinaus, Herr Neubert konnte also nicht erkennen, ob sich eine Versammlung vorfand, er wollte eben seitwärts durch den Garten schlüpfen, als eine Hand seinen Arm berührte: »Ferdinand!«
»Behrens!« sagte er gepreßt. »Du bist also doch hier?«
»Ich will wenigstens in der Nähe bleiben, Neubert. Die Möglichkeit, daß doch noch ernstere Konflikte bevorstünden, ist meines Erachtens nicht ausgeschlossen.«
Der Kaufmann erschrak. »Du denkst, daß unsere Versammlungen im alten Schulhause entdeckt wären?« flüsterte er.
»Ich fürchte, ja.«
»Dann müßte es im Schoße der Landsleute einen ehrlosen Verräter gegeben haben! Welchen deutschen Mann möchtest du dessen zeihen, Behrens?«
Der andere schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht, Neubert, ich kann keinen bestimmten Verdacht aussprechen, aber die Sache scheint mir bedenklich. Hast du einen Revolver bei dir?«
»Nein! Wozu auch?«
»Weil du dich in eine Spitzbubengesellschaft begibst. Hier ist einer, ein sechsläufiger, – du kannst wenigstens einen persönlichen Angreifer damit in Schach halten.«
Der Kaufmann steckte mit einigem Widerstreben die Waffe in seine Brusttasche, dann, als es von einer nahen Kirche elf schlug, drückte er hastig die Hand des anderen und eilte ins Haus, wo ihm ein schwarzer Kellner eine Thür öffnete und den späten Gast eintreten ließ.
»Guten Abend, Gentlemen!« grüßte dieser eine rauchende, trinkende und in ihrem Aussehen höchst seltsame Versammlung. »Ich bin Ferdinand Neubert, den Sie zu sprechen wünschten! Was steht Ihnen zu Diensten?«
Lauter verlarvte oder schwarz gefärbte Gesichter sahen ihm entgegen. Es war unter dieser Rotte kein einziger, der Mann genug gewesen wäre, um offen mit seiner Person und seinen Absichten an das Tageslicht zu treten, es versteckten sich vielmehr alle hinter jener Anonymität, die dem Schurken gestattet, aus dem Dunkel hervor einen Gegner zu überfallen, ohne für diese seine Handlungsweise auch die Folgen und besonders die Verantwortlichkeit übernehmen zu müssen.
Einige Mitglieder des Vigilanz-Komitees lagen in der Weise angeheiterter Fuhrknechte mit beiden Armen breit auf dem Tische und stützten das Knie gegen die Hände, während andere sich auf den Hinterfüßen der Stühle schaukelten oder gar die Stiefel über den Tisch ausstreckten. Dampfende Groggläser standen vor allen Gliedern der ehrenwerten Versammlung, leere Flaschen häuften sich zu ganzen Regimentern. Bei dem mit ruhiger Stimme gesprochenen Gruße des Kaufmanns ging ein Murmeln durch die Reihen der Männer; einige lachten spöttisch.
»Wahrhaftig, du hast guten Mut, Geselle!«
»Ein gutes Gewissen habe ich!« versetzte der Kaufmann.
Jemand schlug mit geballter Faust auf den Tisch, daß Gläser und Flaschen klirrten. »Nimm deine Füße weg, du! – es ist eine Gerichtssitzung, die jetzt beginnt.«
Mehrere Paare schmutziger Stiefel wurden langsam von der Tischplatte entfernt. Der, welcher zuerst gesprochen hatte, erhob sich und schwenkte den Arm durch die Luft wie der Ausschreier einer Jahrmarktsbude. »Ferdinand Neubert,« sagte er, »weißt du, wer die sind, welche dich vorgeladen haben, die, deren Urteilsspruch jetzt erfolgen soll?«
Der Kaufmann bewahrte seine äußere Rnhe. Er hatte sich so gestellt, daß ein geöffnetes, auf den Garten hinausgehendes Fenster ihm zur Rechten für alle Fälle erreichbar blieb, jetzt sah er in das geschwärzte Gesicht des Vorsitzenden und antwortete ruhig: »Die Herren nennen sich das Vigilanz-Komitee. Aus eigener Machtvollkommenheit, so viel ich weiß.«
Der Geschwärzte nickte. »Wir zählen an Ort und Stelle etwa nach zweitausend Mitgliedern,« fuhr er in bedeutungsvollem Tone fort, »insgesamt nach Hunderttausenden. Das ist eine Macht, die du wahrscheinlich anerkennen wirst, Ferdinand Neubert!«
Der Kaufmann schwieg, er konnte es nicht über sich gewinnen, dem Anführer einer Schar von Buschkleppern das gewünschte Zugeständnis zu machen; in gemessener Entfernung vom Tische blieb er stehen und erwartete, was weiter folgen werde.
Aus der zerfetzten Tasche des Geschwärzten kam jetzt ein zusammengefaltetes Papier zum Vorschein, die Anklageschrift natürlich. »Rnhe!« rief der Strolch, dann begann er mit erhobener Stimme seinen Vortrag.
»Ferdinand Neubert, es wird dir schwer werden, die gegen dich vorliegenden Beschuldigungen zu entkräften. Fangen wir an mit dem ersten Punkte. Du bist ein heimlicher Anhänger der verfluchten abolitionistischen Lehre!«
»Bist du es?« fragte der seltsame Vorsitzende dieses noch seltsameren Gerichtshofes.
Der Kaufmann sah ihn an. »Hat nicht jeder unter uns das Recht seiner Gesinnung?« sagte er. »Darf nicht jeder so urteilen und so handeln, wie es ihm dem Rechte gemäß erscheint?«
Der mit dem schwarzen Gesichte schüttelte den Kopf. »Ausflüchte!« rief er. »Ich will ein Ja oder Nein hören. Bist du ein Anhänger der abolitionistischen Lehre?«
»Ja!« antwortete Neubert. »Ich bin es! Ich mag nicht lügen!«
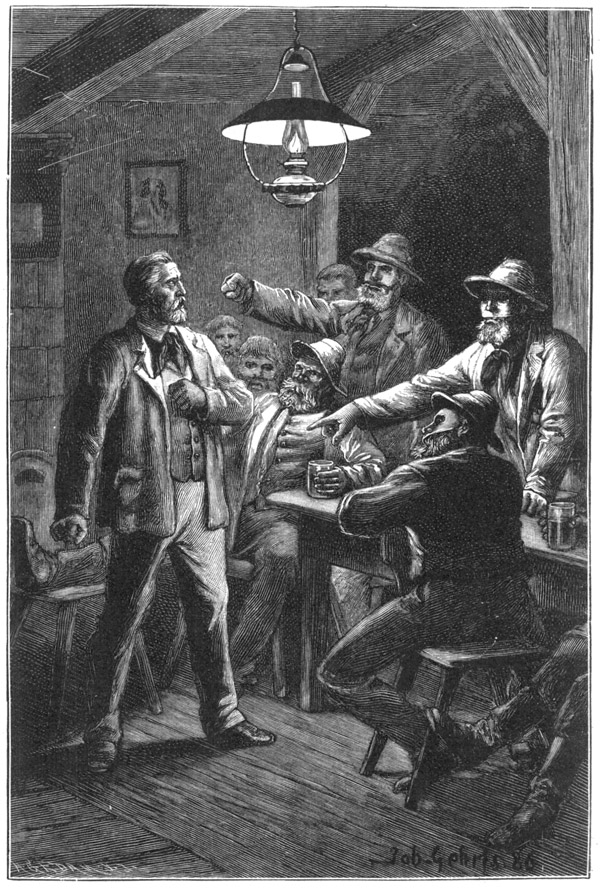
Vor dem Vigilanzkomitee.
Ein Gelächter antwortete ihm. »Du scheinst ein sehr empfindsamer Charakter zu sein,« fuhr der Fragesteller fort. »Aber desto besser für deine Richter, das Verfahren wird dadurch abgekürzt. Wir kommen jetzt zur zweiten Frage. Was schlepptet ihr nächtlicherweile hin und her, ihr verdammten Deutschen, die ihr alle wie Kletten zusammenhaltet?«
Neubert zuckte die Achseln. »Geschäftsangelegenheiten,« versetzte er. »Dinge, die keinen Dritten kümmern.«
»Und über die du auch nicht sprechen willst, Kamerad?«
»Nein.«
»Punkt zwei ist eingestanden!« rief der Vorsitzende. »Weiter im Text also! Du hegst Fluchtpläne, Ferdinand Neubert!«
»Ich will, wenn es mir möglich ist, mein Haus zu verkaufen, von hier abreisen, ja. Da ich kein Gefangener bin, so bedarf der Plan wohl auch keiner besonderen Erlaubnis.«
»Du scheinst viel Talent zum Rechtsverdreher zu besitzen, alter Junge. Schade, daß dir keine Zeit mehr bleibt, noch einer zu werden. Es kommt nämlich ein letzter Punkt der Anklage und dieser bricht dir, wie ich glaube, den Hals.«
Jetzt erschrak der Kaufmann. Wenn Behrens gut unterrichtet war, wenn er wußte, daß die heimlichen Versammlungen im Schulhause ihren Verräter gefunden hatten! – Dann allerdings schien das Leben verwirkt.
Die ganze Spitzbubengesellschaft hielt vor Erwartung den Atem an. Mitten auf dem Tische brannte eine qualmende Öllampe, die verlarvten Gestalten saßen schweigend umher, während ihr Sprecher sich erhoben hatte, um mit mehr Nachdruck zu reden. Jetzt streckte er den Arm aus.
»Unser Land ist belagert,« sagte er, »überall leidet die Bevölkerung den bittersten Mangel, es sind die gewöhnlichsten Lebensmittel für viele Arme nicht mehr erreichbar, sie sterben Hungers, sie verkommen und verderben im Elend. Das scheint aber gewissen Personen noch nicht Unglück genug, der äußere Feind drängt nur von einer Seite, sie sehen sich daher um nach einem andern, neuen, nach einem, der auch von innen die scharfe Waffe ansetzt. So soll nach ihrer Hoffnung die Konföderation zwischen zwei Gegnern zerrieben werden. Ist es so, Ferdinand Neubert?«
»Es gibt eine Partei, deren Ziele dahin gehen, ja!«
»Und zu der du gehörst, nicht wahr?«
»Wer ist es, der sich erlaubt, mich meiner Privatangelegenheiten wegen zu verhören?«
Der Geschwärzte lachte. »Gut gegeben!« sagte er. »Aber wir können beide Fragen vorläufig fallen lassen, Freund Neubert. Sage mir doch, welche Mittel werden angewendet, um die schwarze Bevölkerung aufzuwiegeln? Welchen Zweck hat es, wenn sich mitten in dunkler Nacht die Sklaven der Umgegend nach Hunderten im leerstehenden Schulgebäude der Washingtonstraße zusammenfinden, he?«
Ein Murren durchlief den Kreis. Die Köpfe erhitzten sich mehr und mehr, die Augen funkelten hinter den Löchern der Masken. Worte wie »Verdammter Deutscher!« oder »Schlagt den Hund zu Boden!« wurden hie und da gehört.
»Ich will euch sagen, was die Abolitionisten im Schulhause treiben,« fuhr der Sprecher fort. »Sie halten Anreden, sie belehren die Schwarzen über alle möglichen Gegenstände, am eindringlichsten aber über solche Dinge, die das Recht der Dienstboten in andern Ländern betreffen, sie wollen heimlich das Feuer so lange schüren, bis es in helle Flammen ausbricht. Die Haupträdelsführer dieser Unternehmungen sind Deutsche, und unter ihnen steht in unermüdlichem Eifer wieder einer den übrigen voran, – du, Ferdinand Neubert! Magst du es leugnen?«
Der Kaufmann hatte während dieser Rede seines Anklägers Zeit gehabt, sich vorzubereiten, er entgegnete daher in völlig ruhigem Tone vorerst nur wenige Worte. »Gentlemen,« sagte er, »ich stehe hier mit unverhülltem Antlitz, von allen gekannt, vor Ihnen, wäre es also nicht mein Recht, ein gleiches von Ihnen zu verlangen? Wer sind Sie und wer erlaubt Ihnen, mich so wie es hier geschieht, ins Verhör zu nehmen?«
»Danach zu fragen, können wir dir nicht gestatten, Landesverräter!« donnerte der Vorsitzende. »Genug, daß du hier bist und daß wir die Macht haben, dich nach Gebühr zu züchtigen! Du führst in den nächtlichen Versammlungen das Wort, du bist es, der dem Lande ein neues schreckliches Unglück bringen möchte, – die Revolution! Ist es so, oder nicht? Du behauptest ja, keine Lüge aussprechen zu wollen.«
Neuberts Gesicht hatte sich mit schnell verschwindender Röte überzogen, seine Augen flammten plötzlich auf. »Nein,« rief er mit starker Stimme, »nein, ich lüge nicht! Ich hasse und verabscheue die Sklaverei und ihre Anhänger! – Ein Mann, ein deutscher Mann hat euch das Wort entgegengeworfen, euch, die ihr vor den Gesichtern Larven tragt! Nun macht mit mir, was ihr wollt!«
Mehrere der anwesenden Buschklepper sprangen bei dieser Rede von ihren Plätzen auf und schienen den wehrlosen Kaufmann zu Boden schlagen zu wollen, sie brüllten vor Wut, Messer und Revolver blitzten im Lampenschein, es war ungewiß, was die nächste Minute bringen würde, als plötzlich der Vorsitzende mit herrischem Tone Halt gebot. »Berührt ihn nicht!« rief er. »So lieb euch euer Leben ist, berührt ihn nicht! Der Landesverräter soll länger leiden, als während der wenigen Minuten, in denen eine Pistolenkugel tötet, er soll vor allen Dingen zuerst sein Urteil hören!«
»Deine Güter sind hiermit konfisziert, Ferdinand Neubert!« fuhr er fort, »du selbst bist vorläufig zur Gefängnisstrafe verurteilt. Ich sage ›vorläufig!‹ – denn die Freiheit bekommst du nicht wieder, wenn auch der Tag der Hinrichtung noch nicht bestimmt werden kann.«
»Führt ihn in das Gefängnis, Kameraden!« gebot er dann.
Die Gauner erhoben sich mit wildem Frohlocken, sie waren im Begriff ihr Opfer zu ergreifen, als plötzlich der Knall eines Pistolenschusses das Zimmer gleichsam erbeben ließ. Die Lampe erlosch, Glassplitter flogen umher, ein kräftiger Arm packte von draußen die Schulter des Verurteilten, eine Stimme flüsterte in sein Ohr: »Rasch! Rasch! Hier heraus!«
Gedankenschnell hatte Neubert begriffen, ehe Sekunden vergingen, stand er im Garten und glitt geräuschlos durch die Büsche davon. Während sich in dem Saale ein wahrer Höllenlärm entwickelte, lief er, so schnell ihn seine Füße trugen, quer über Beete und Rabatten, über ein Kornfeld und zwischen Kühen, die erschreckt aufsprangen, aufs Geratewohl vorwärts. Es war Behrens, der ihn gerettet, dessen Kugel die Lampe zerschmettert hatte, jetzt jedoch konnte er den treuen Freund nirgends entdecken, er führte vielmehr höchst wahrscheinlich durch irgend eine Kriegslist die Verfolger irre, er brachte sich selbst so bald als möglich in Sicherheit.
Neubert lief, bis alle seine Pulse zu zerspringen drohten, bis sich Funken vor seinen Blicken zeigten, dann endlich stand er, an einen Baum gelehnt, einen Augenblick still und horchte. Verworrenes Geräusch drang zu ihm, Geschrei und schwere Schritte; er konnte nicht bezweifeln, daß ihm die Raubgesellen folgten.
Weiter! Weiter! Die Gefahr war noch nicht vorüber.
Er durchwatete einen seichten Bach und sprang an das entgegengesetzte Ufer. Wieder Felder und freie Flachen, wieder eine Straße, dann ein Baumwollenfeld, halb abgeerntet, – er stürmte durch die Furchen, immer verfolgt von den Stimmen der Wegelagerer, rastlos vorwärts ohne Ziel, ohne Aufenthalt.
Da stand plötzlich eine halboffene Pforte gerade vor ihm, dunkle Dächer lagen rechts und links, Verstecke bietend, vielleicht den Schutz eines Menschen, einer finsteren Ecke, in die der Feind keinen Zutritt bekam.
Hinein! Hinein! Es war höchste Zeit.
Nichts regte sich zwischen den Gebäuden; der Kaufmann horchte. In dem weiten Hofe war alles todesstill, hinter ihm aber klangen Stimmen aus nächster Nähe. »Hier muß er sein! Sucht ihn! Sucht ihn!«
»Lebendig oder tot, er darf uns nicht entwischen!«
»Bedenkt, was ihr thut!« rief ein andrer, »es ist das Hauswesen des Friedensrichters, zu dem dieser Hof gehört.«
»Einerlei! Mr. Dunkan hilft auch keinem Abolitionisten zur Flucht, er liefert ihn uns vielmehr sogleich aus.«
Jedes Wort drang zu den Ohren des Verfolgten. Er schlich an den Hütten der Neger dahin, immer im tiefsten Schatten, lautlos wie ein Geist, – jede Thür war verschlossen, so oft auch die tastende Hand den Drücker berührte, immer vergebens.
»Es ist zu Ende,« dachte der gefolterte Mann. »Gott will, daß ich sterbe.«
Die letzte Thür lag vor seinen Blicken, – o Himmel, Himmel, sie war ein wenig geöffnet, er konnte hineinschlüpfen und in dem großen, vollständig finsteren Raume Atem schöpfend stillstehen, um sich im Augenblick möglichst zu orientieren. Zwei Reihen Betten standen an den Wänden, es war ein Schlafsaal, in dem er sich befand.
Ob niemand wachte? Dann war er im Augenblick wenigstens gerettet.
Die nächste Sekunde zerstörte diese Hoffnung. »Wer ist hier?« fragte eine Stimme. »Sind Sie es, Sammy?«
»Jesus! – das ist Lionel!«
»Herr Neubert?« raunte in höchster Bestürzung der Knabe. »Wie –«
»Pst! Man verfolgt mich. Lionel, können Sie mir keinen Schutz gewähren?«
»Kriechen Sie unter mein Bett, rasch! –«
Draußen erschien Lichterglanz, die Stimme des Mulatten wurde gehört. »Ein Flüchtling, Gentlemen? – Hier ist niemand!«
Ein Hund schlug an, Lionel erschrak heftig. »Die Dogge!« flüsterte er. »Drücken Sie sich an die Mauer, Sir!«
Der Hund sprang in die Thür hinein und fuhr auf Lionels Bett los, um wütend zu bellen. Eben so schnell war ihm sein Herr nachgeeilt, jetzt fiel ein voller Lichtstrahl in den Raum, Lionel that, als erwache er erst im selben Augenblick. »Sammy!« rief er, »Sammy! was hat Ihr Hund?«
»Kusch dich, Warp! – Kusch dich!«
Das Tier gehorchte, aber doch nicht, ohne fortwährend leise zu knurren. Lionel fixierte den Mulatten, er drückte bedeutsam das Handgelenk desselben. »Bringen Sie das Tier weg!« flüsterte er. »Die da draußen mit den Larven vor den Gesichtern sind doch die Todfeinde der Farbigen, die Männer vom Vigilanzkomitee, nicht wahr?«
Ein schlaues Lächeln glitt über das gelbe Gesicht; der Mulatte wandte sich achselzuckend zu den draußen stehenden Männern. »Hier ist niemand, Gentlemen!«
»Aber weshalb bellte denn dein Hund, Aufseher?«
»Wir erhielten vorgestern einen neuen Sklaven, den Warp noch nicht kennt, weil er den ganzen Tag mit mir auf dem Felde gewesen ist.«
»Einen neuen Sklaven?« wiederholte einer der Verlarvten. »Das ist der famose Junker von Seven-Oaks, nicht wahr, Aufseher?«
»Ich weiß nicht, Sir!«
»Zeig den Burschen her, Gelber!«
»Oho, Sir, das geht nicht so geschwind! Ich will die Herren in den Parlour führen und den gestrengen Mr. Dunkan wecken, dann mag er selbst entscheiden, wie weit die Haussuchung gehen darf.«
»Lassen Sie nur, Aufseher!« riefen bei diesem Anerbieten des Mulatten wenigstens sechs Stimmen zugleich. »Es ist gut so, wir fangen den Vogel auch an einem andern Orte.«
Und erschreckt durch den Gedanken eines Zusammentreffens mit dem Richter, machte sich die ganze Bande davon. Hinter den schwarzen Larven steckte wohl so manches Gesicht, das sich der Obrigkeit aus triftigen Gründen lieber fern hielt, wenigstens verschwanden die Edlen vom Vigilanzkomitee mit wunderbarer Behendigkeit über den Hof und durch die Pforte, ohne sich umzusehen.
Ihnen nach ging der Mulatte und verschloß und versperrte den Zugang, dann kam er wieder in den Schlafsaal, wo Neubert und Lionel mit einander auf der niederen Bettstelle saßen und sich leise unterhielten. Als Sammy eintrat, reichte ihm der Kaufmann die Hand. »Erkanntest du mich, Aufseher?« fragte er.
Der Gelbe lächelte. »Ich stand am Brunnen,« versetzte er, »deshalb hörte ich alles, sah alles. So lange mein Arm Sie schützen kann, soll Ihnen nichts zuleide geschehen, Sir! Sie meinen es gut mit dem farbigen Volke!«
Die Stimme des Riesen zitterte, er war blaß unter der gelben Haut. »Was fehlt Ihnen, Sammy,« fragte Lionel. »Sie sind aufgeregt, traurig.«
Der Mulatte legte plötzlich beide Hände vor das Gesicht und schluchzte wie ein Kind. »Meine Frau,« stammelte er, »meine arme Frau, – sie ist heute so furchtbar geschlagen worden, daß es ihr nicht möglich war, einen Augenblick zu mir herüberzuschlüpfen. Ein guter Freund kam und brachte mir die schlimme Botschaft.«
Einen Augenblick schwiegen sie beide, Lionel und Herr Neubert; das was der Mulatte sagte, klang zu erschütternd, um gleich eine Antwort zuzulassen, dann aber tröstete der Kaufmann den unglücklichen Menschen, indem er ihn auf sein eigenes schweres Schicksal hinwies. »Wem gehört denn deine Frau?« fragte er ihn. »Nicht Seiner Ehren, dem Herrn Friedensrichter?«
Der Gelbe schüttelte den Kopf. »Nein, Sir! die arme Molly gehört dem Krämer drüben an der Ecke und der will sie nicht verkaufen, weil er keine andere wiederfindet, um Haus und Kinder so ordentlich im stande zu halten. Seine Frau putzt sich und geht in Gesellschaften, Molly muß alle Arbeit allein verrichten.«
»Und trotzdem wird sie so unbarmherzig geschlagen, Sammy?«
»Ja, Sir! Die Kinder des Krämers sind krank, Molly muß in jeder Nacht wachen, und da hat sie nun heute das Unglück gehabt, ihre Dame nicht so hübsch und so schnell frisieren zu können, als sonst wohl, – die armen Augen sind ihr nur so zugefallen. – Dafür hat sie grausame Strafe bekommen.«
Herr Neubert atmete tiefer. »Lionel,« sagte er im Tone unterdrückter Leidenschaft, »Lionel, ist wohl irgend ein Opfer zu kostbar, eine Anstrengung zu groß, um Ungeheuerlichkeiten wie diese aus der Welt zu schaffen?«
Ein trauriges Lächeln umspielte die Lippen des Knaben. »Lieber Herr Neubert,« versetzte er. »Sie vergessen, wie schwer es mich selbst getroffen hat.«
Der Kaufmann drückte ihm die Hand. »Wenn es Gottes Wille ist, so werden wir beide aus den Krallen der Widersacher gerettet werden, Lionel, – und vielleicht auch du, Sammy! Grüße die übrigen im alten Schulgebäude, ich darf ja nicht wagen, jemals wieder dahin zu kommen, aber wo es mir möglich ist, wo ich irgend kann, da wird es mein Bestreben sein, dem farbigen Volke zu nützen und den Greueln der Sklaverei entgegenzutreten, das magst du deinen Genossen von mir sagen.«
Hie und da hatte sich während dieser Rede ein schwarzer Kopf über den Bettrand erhoben, hie und da eine Hand sich ausgestreckt. Lionel sah mit Erstaunen, daß alle die armen geknechteten Wesen den Vater seines Freundes persönlich kannten, er seufzte in Hinblick auf die ungeheure Gefahr, der sich Herr Neubert ausgesetzt hatte. Wohin sollte er flüchten? Wie die Vorbereitungen zur Abreise treffen, jetzt, wo ihn kein Auge sehen durfte?
Der Kaufmann wollte offenbar jetzt schon gehen, er strich mit der Rechten durch das Haar und nahm seinen Hut. »Adieu, Lionel, Gott beschütze Sie! Wenn es mir gelingt, mich verborgen zu halten, so sehen wir uns wieder! Adieu, Sammy, du armer Schelm!«
Lionel fühlte sich sehr unruhig. »Wenn die Verfolger noch in der Nähe wären!« seufzte er.
»Darauf muß ich es ankommen lassen,« war die gelassene Antwort. »Meine Frau vergeht vor Angst, bis sie weiß, daß ich vorläufig gerettet bin, es ist also notwendig, ihr eine Nachricht zu geben, anderseits aber darf ich auch hier nicht bleiben, bis die Sonne am Himmel steht. Adieu! Adieu!«
Alle Sklaven rechts und links in den Betten flüsterten den Abschiedsgruß, noch einmal lag Lionels Hand in derjenigen des Kaufmannes, dann befahl Sammy seinem Hunde, sich ruhig zu verhalten, worauf er selbst in die Nacht hinausging um zu kundschaften. Hinter ihm her glitt Neubert, beide lautlos wie Schatten durch die Finsternis schleichend.
Es blieb alles still, auch auf dem Hofe des Herrenhauses. Sammy öffnete die vordere Pforte und sah hinaus, – nur einige Laternen schaukelten noch ächzend im Nachtwind, hie und da huschte eine Katze über den Weg, verschwanden behende Ratten an den Seiten der Rinnsteine. Kein Mensch war zu entdecken.
»Sir,« flüsterte der Mulatte, »wollen Sie es wagen?«
Der Kaufmann nickte. »Ich muß, Sammy! Denke an meine arme Frau, die sich zu Tode ängstigt, an meine Kinder! – Ich muß zu ihnen und sie beruhigen.«
Der Mulatte deutete auf das Eckhaus, an dem die Laterne brannte. »Da weint meine Molly,« sagte er. »Sie hat fingerdicke Striemen auf dem Rücken. Ach könnte ich die Wände einreißen und mit Nägeln und Zähnen über ihre Peiniger herfallen!«
»Du kannst besseres thun, Sammy, kannst die armen unwissenden Schwarzen unterrichten, ihnen sagen, daß sie einig werden und handeln müssen. Predige ihnen in dem Sinne, wie du es von meinen Freunden und mir im Schulhause gehört hast.«
»Und nun adieu! Gott behüte euch!«
»Adieu, Sir!«
Der Mulatte sah den Flüchtling eilends die Straße hinabgehen, sah, daß ihn niemand verfolgte oder anredete und trat befriedigt zurück in den Vorgarten, dessen Pforte er wieder verschloß, um sich dann selbst in den Schlafsaal zu begeben und sein Lager zu suchen. Er sah nicht mehr, daß in dem Augenblick, wo seine Schritte verhallten, zwei dunkle Gestalten von rechts und links aus dem Schatten hervorsprangen und dem Verfolgten den Weg abschnitten. Einer der Gesellen warf dem jählings überrumpelten Mann seinen Rock auf den Kopf und erstickte in dieser gewaltsamen Weise den Schrei, der sich Bahn brechen wollte. »Haben wir dich?« sagte eine frohlockende Stimme. »Jetzt bist du uns verfallen!«
Der Kaufmann war außer stande sich zu widersetzen, seine Hände wurden auf dem Rücken zusammengebunden und ihm unter dem fest anliegenden Rocke nur gerade Raum genug gelassen, um notdürftig atmen zu können. Ein paar Fackeln dienten der Gesellschaft als Leuchten und so ging es im Geschwindschritt zur Brauerei, die das Vigilanzkomitee als Gefängnis benutzte. Hie und da begegnete ein verspäteter Nachtschwärmer dem Zuge und wich scheu zurück. Die Verlarvten waren in der ganzen Umgebung bekannt und berüchtigt; man hütete sich, ihren Groll oder auch nur ihre Aufmerksamkeit zu erregen.
Rasselnd öffnete sich das Eisenthor des Gefängnisses. Nun konnte die Verhüllung der Augen und des Mundes fallen, – wer einmal hinter diesen Mauern sich befand, der schrie und tobte so viel er wollte, ohne von irgend einem Menschen beachtet zu werden. Man erzählte sich im Volke über die Zustände dieser Zwingburg die grauenhaftesten Geschichten, aber man hütete sich, das Vigilanzkomitee öffentlich anzugreifen. Wer eingesperrt wurde, der verschwand und kehrte meistens nie wieder zu den Seinigen zurück.
Neubert sprach kein Wort, er wußte nur zu wohl, daß doch alle Mühe, alle Überredung vergeblich gewesen wäre.
Das Gebäude war alt und verfallen, gegen den Hof hinaus hatte es keine einzige Fensterscheibe mehr, während ihm das Dach überhaupt gänzlich fehlte. Eine wahre Totenstille empfing die Ankommenden; wenn diese grausamen Henker ein neues Opfer in den Kerker schleppten, so kauerten die früheren Bewohner desselben in den entlegensten Ecken, um weder gesehen noch gehört zu werden. Der ungezügelte Übermut der Machthaber hätte ja in jedem Augenblick eine Hinrichtung anordnen und sogleich ausführen lassen können.
Viele Worte wurden nicht verschwendet, man übergab dem Aufseher, einem stumpfen, brutalen Gesellen, den neuen Gefangenen und eilte dann fort, um das hauptsächlichste Geschäft dieser Nacht zu beginnen. Alle bewegliche Habe des Kaufmanns mußte fortgeschafft und die Brandfackel unter sein Dach geschleudert werden.
»Da hinein!« gebot der Aufseher. »Es ist Gesellschaft hier!«
Und mit einem rohen Lachen ging er wieder hinab, um seine Pfeife zu rauchen und dabei so lange der Flasche zuzusprechen, bis er auf den Steinen des Hofes einschlief und wie eine Sägemühle zu schnarchen begann.
Den schauerlichen Räumen fehlte, wie man sich denken kann, alle Beleuchtung. Der leise Nachtwind fuhr durch die zerbrochenen Scheiben und brachte, so oft er kam, eine erfrischende Luftwolke, die den Miasmen des überfüllten Gefängnisses den Krieg erklärte und wenigstens sekundenlang die Lungen von drückender Last befreite. Zerbröckelnder Kalk fiel von den feuchten Wänden, die Decke zeigte klaffende Risse und der Fußboden war schlüpfrig, ein Geruch wie von moderndem Stroh erhob sich überall, ja, es raschelte sogar verdächtig in den Ecken, als ob Ratten und Mäuse mit den Menschen diese Stätte des Elends teilten.
Erst ganz allmählich gewöhnten sich des Gefangenen Augen an das herrschende Halbdunkel, er sah an den Wänden des großen Gemaches eine Schicht verdorbenen Strohes und auf demselben in verschiedenen Gestalten eine Anzahl menschlicher Gestalten, wie sie erbarmungswürdiger nicht gedacht werden konnten. Zerlumpte Gewänder, Fetzen in des Wortes verwegenster Bedeutung umhüllten elende abgemagerte Körper, denen nur noch ein letzter Rest von Leben und Lebensfähigkeit geblieben zu sein schien. Manche lagen auf dem Gesicht, ohne sich zu regen, andere kauerten gegen die Wand gelehnt, während einige wenige auf- und abschlichen, mit den Händen gestikulierten und abgerissene Sätze vor sich hinmurmelten.
Ein Grauen durchrieselte des Gefangenen Adern. Ob der Verstand dieser Unglücklichen dem furchtbaren Schicksal erlegen war?
»Guten Abend, Gentlemen!« grüßte er.
Ein Gemurmel antwortete ihm. »Wieder einer!« ächzte eine schwache Stimme. »Zwei hat der Aufseher heute im Hofe verscharrt.«
»Kommen Sie zu mir,« flüsterte es von der anderen Seite, »ich will Ihnen sagen, was Sie notwendig wissen müssen, morgen ist es dazu aber vielleicht nicht mehr früh genug, denn ich sterbe sehr bald.«
Neubert nahm aus der Tasche eine Büchse mit Zündhölzern, deren eines er in Brand setzte, freilich nur für Sekunden, dann erlosch das schwache Flämmchen unter den vereinten Anstrengungen aller Hände, die es zu erreichen vermochten. »Um des Himmels Willen,« flüsterten die Gefangenen, »kein Licht! Es ist ganz und gar verboten!«
»Kennen Sie auch die Strafen, welche in diesem Hause gelten, Sir?«
Neubert erkannte wieder die Stimme des Mannes, der bald zu sterben glaubte. »Ich weiß von nichts, Gentlemen!« antwortete er.
»Nun, so will ich es Ihnen sagen! Drei Keller befinden sich unter dem Erdgeschoß, drei Stockwerke, in die nie ein Strahl des Tageslichtes fällt! Hundertundvierzig Stufen geht es in die greuliche Finsternis hinein, – der Aufseher nimmt eine Lampe mit und für den Fall eines Mißgeschickes noch eine Wachskerze und Zündhölzchen, – dann ist der unterste Raum erreicht. Sie wissen, die Brauereien haben ihre Eisschachte. Von oben wird nachgefüllt, unten schmilzt der Bestand zu Wasser. Nun gut, die Abzugskanäle sind lange nicht gereinigt worden, sind völlig verstopft, – die faulende schreckliche Jauche steht an fünf Fuß tief im Keller, – dahin sperrt der Aufseher die Ungehorsamen, die, welche sich seinen Anordnungen nicht fügen wollen. Hunderte von Ratten fallen über ihr Opfer her, Tausende, – o Sir, Sir, das Krabbeln und Klettern in den Haaren, in den Kleidern, das Tasten der kalten Füße im Gesicht, es ist furchtbar, für solche Qualen gibt es keine Worte. Und dabei die dichte Finsternis, greifen können Sie diese Dunkelheit! – Hu, da unten wohnt das Verderben, der Tod!«
Eine Hand berührte Neuberts Arm. »Widersprechen Sie dem Alten nicht, Sir! Sein Geist ist gestört, seit er dies fürchterliche Haus bewohnt.«
»Ich war unten im Strafkeller,« fuhr der Unglückliche fort. »Das Wasser ging mir bis an die Brust, ich dachte immer, wenn es nun stiege und mir in den Mund laufen würde, – denken Sie sich, diese entsetzliche Jauche in den Mund zu bekommen! – Ach und seitdem brennt das Feuer oben im Kopfe, brennt ohne Unterlaß, das kann ich gar nicht mehr lange ertragen.«
Er fiel röchelnd zurück auf das Strohlager. »Morgen hat der Aufseher wieder ein Begräbnis,« murmelte er. »Meine Hände werden schon kalt, der Tod kommt!«
»So geht es in jeder Nacht!« seufzte ein anderer. »Alle, die da hinunter mußten in den Keller, sind gestorben, oder haben den Verstand verloren.«
Herr Neubert antwortete nicht. Er suchte seinen Platz auf dem Stroh so nahe als möglich gegen die Fenster hin, dann legte er beide Hände unter den Kopf und sah durch die vielfach zersplitterten Scheiben am Nachthimmel empor. Wie Schiffe vor dem Wind, so segelten kleine weiße und graue Wolken an dem scharf abgezeichneten Mondviertel vorüber, bald langsam, bald schnell, hier einzeln und dort in ganzen Zügen, die wie ein wanderndes Gebirge auf dem blauen Grunde dahinglitten. Ab und zu sah ein glänzender Stern durch das Grau, – ein helles Auge im Dunkel der Umgebung. Wie ein Friedensgruß traf der Blick den einsamen Mann, aber er weckte auch im Herzen ein nicht zu stillendes Sehnen nach Freiheit, nach denen, die der Gefangene liebte und die er wiederzusehen hoffte. Sie verlebten eine Nacht voll Todesangst, voll rastloser Unruhe, und am Morgen erzählte dann das Gerücht, was geschehen war. Die vom Vigilanzkomitee hatten wieder einen friedlichen Bürger aufgegriffen und in das Gefängnis geworfen! Jetzt war die entsetzliche Bestätigung des nur Gefürchteten da und alle Hoffnung des Wiedersehens schmolz wie Schnee vor der Sonne.
Die armen Kinder! Vielleicht lag ihre Mutter krank und fiebernd im fremden Hause, es tröstete sie niemand, es trocknete keine Hand ihre bittern Thränen.
Wenn Behrens erkannt war, so drohte ihm überdies ein gleiches Schicksal. Wohin sich der Blick wandte, da gähnte ein düsterer, unausfüllbarer Abgrund, da schien alles Licht verschlungen von der Finsternis, alle Hoffnung verloren.
Neubert bemerkte nicht, daß die Säume der Wolken im rötlichen Glanze zu strahlen anfingen, daß mitunter eine rote Lohe das Grau verdrängte, erst als eine langgestreckte, wehende Feuergarbe über den Himmel schlug, erwachte er jählings aus den Banden der schmerzvollen Träume, die ihn umsponnen hielten.
Sein Haus! Ihr ewigen Mächte, – sein Haus!
Er verfolgte die Richtung der Feuerwolken, aus seiner Brust rang sich ein schmerzvolles Stöhnen. Es war das Haus, in dem er bis jetzt gelebt hatte, in dem die Kinder geboren wurden, das er dereinst seinem Ältesten zu hinterlassen hoffte, wenn für ihn selbst der Feierabend des Lebens hereinbrach, wenn er die Arbeit jüngeren, kräftigeren Händen überließ. Und nun zerstörten ruchlose Horden, was er mit so unsäglicher Mühe erbaut hatte, nun flog als feuriger Regen in den Wind hinaus, was noch gestern ein schützendes Dach, ein fester Boden gewesen war.
Wie die Funken flogen! Niemand wagte es, in solchen Fällen dem wütenden Elemente Einhalt zu thun, sie standen nur mit den Rettungsgeräten bereit, um nötigenfalls ihr Eigentum zu beschützen, aber um das brennende Haus bekümmerte sich niemand.
Ganze Feuerströme zogen über den Nachthimmel; der Lauscher hörte die Turmglocken, aber er wußte nur zu wohl, daß die Aufforderung aus metallenem Munde ungehört verklingen werde. Bis die Mauern in sich zusammensanken, wütete das gefräßige Element in ungeschwächter Kraft, – dann erst floß vielleicht etwas Wasser über die Trümmer dahin, nur um die nächste Nachbarschaft von der Gefahr zu befreien.
Röter und röter wurde der Himmel. Von seinem erhöhten Standpunkte sah der Kaufmann die halbe Stadt wie in ein Meer von Glut getaucht. Purpurner Schimmer umfloß die Spitzen der Dächer, purpurn rollte der Fluß seine Wellen. Endlich tönte ein dumpfes Krachen, Wolken von Funken stoben nach allen Seiten auseinander und dann schien die Wut der Flammen gebrochen, – nun lag das Wohnhaus zerschmettert und zerschlagen auf den eingestürzten Wänden des Anbaues; alle die kostbaren Schätze im Schoße der Erde waren bedeckt und versteckt von einer dichten Schicht des unverbrennbaren, unbeweglichen Schuttes, von Kalk und Steinen, die niemand entfernen würde, weil sie nicht mehr zu brauchen waren.
Es lag ein Trost in diesem Gedanken, aber doch halb und halb ein trauriger. Wessen Hand war es, die dereinst den sorglich verwahrten Schatz heben würde?
Ein Strom von Hitze rann durch alle Adern des Gefangenen. Diese Waren unter dem Schuppen bildeten das ganze Erbe, welches er seinen Kindern hinterlassen konnte; nahmen es fremde Gewalten an sich, so behielten sie nichts, gar nichts.
Wie unendlich schwer ist es doch so oft dem Menschen, sich thatlos zu ergeben! Wie viel, viel leichter erscheint es, im mächtigen Anlaufe alle Kräfte des Körpers und des Geistes kämpfend einzusetzen, als still und mit gebundenen Händen zu sagen: »Herr, dein Wille geschehe!«
Im Osten dämmerte bereits der neue Tag; Neubert hatte kein Auge geschlossen, ja nicht einmal eine wirkliche Müdigkeit empfunden, die innere Unruhe hielt alle Lebensgeister in fieberhafter Anspannung. Jetzt ließ sich bei der herrschenden halben Beleuchtung die nächste Umgebung besser erkennen; der Gefangene schauderte bei dem Anblick dessen, was sich seinen Sinnen aufdrängte.
Wie die Menschen aussahen! Grau, leichenfarbig, mit kaum noch aneinander haftenden Lumpen bedeckt! Wie sie es verlernt hatten, sich vor dem Schmutze, dem widerwärtigsten Ungeziefer zu scheuen! – Die verfallenen Gesichter lagen auf dem modernden feuchten Stroh, die Hände zuckten selbst im Schlafe, die Lippen bewegten sich zu unruhigem Murmeln.
Und über diese Unglücklichen hinweg, neben ihnen im Stroh und an den Mauern bewegten sich jene Tiergattungen, die da einziehen, wo die säubernde Hand fehlt, die zu ganzen Armeen angewachsen sind und nicht mehr verdrängt werden, bis ein neuer Geist alles Gewesene über den Haufen stürzt. Es kroch und sprang, es schlüpfte in tausend heimliche Verstecke, es bekriegte und bekämpfte sich unter einander. Selbst größere Geschöpfe fehlten nicht; Eidechsen glitten über die Wände, Ratten mit ihren diamantnen Augen schossen durch das Stroh, riesenhafte Spinnen hingen lauernd, der reichlichen Beute froh, in ihren aus Fäden gewobenen Nestern.
In einer Ecke wanderten Tausende von kleinen Füßen. Schnurgerade war der Weg, aus dem Erdgeschoß zog das schwarze Heer seine Bahn und durch die geborstene Balkendecke marschierte es weiter bis in die oberen Räume, denen das Dach fehlte, – Ameisen, die den ganzen alten Bau bevölkerten, rastlos wandernde Ameisen, Legionen, die keinen Winkel, kein Brett und keine Stufe verschonten.
Schaudernd wandte der Gefangene den Blick, es drohte ihn in dem überfüllten Raume zu ersticken, er fühlte einen Schwindel, dem er nicht zu widerstehen vermochte. Sich leise erhebend, schlich er durch das große Zimmer und nach der vorderen Seite des Gebäudes; hier stand der Eßtisch, von rohen Bänken umgeben, sonst fehlten alle und jede Mobilien, ebenso wenig gab es einen Ofen oder Vorhänge an den Fenstern. Ein öder, schrecklicher Aufenthalt! Er trat an eins der Fenster und sah auf die Straße hinaus, – ach, er hätte Jahre vom Leben freudig geopfert, um jetzt da unten zu stehen, ganz frei, ganz unbehindert, um Weib und Kinder von der entsetzlichen Sorge befreien zu können.
Aus der Thorfahrt des gegenüberliegenden Hauses löste sich ein dunkler Körper und trat vorsichtig auf die Straße hinaus, ohne jedoch gleich von dem Gefangenen bemerkt zu werden. Dieser verfolgte seine eigenen trüben Gedanken, ihm fiel es nicht ein, sich um die etwa Vorübergehenden zu bekümmern, bis plötzlich von der Straße her ein kleiner Stein gegen das Fenster flog. Nun sah er hinab und beinahe hätte ein Schrei verraten, was der unglückliche Mann empfand. Da unten stand Hermann und streckte ihm beide Arme entgegen.
»Mein Junge!« murmelte mit erstickter Stimme der Vater. »Ach, mein Junge!«
Dann kamen Männerschritte die Straße hinauf und Hermann verschwand wie ein Schatten hinter der Thorfahrt. In einem Augenblick war das traurige Wiedersehen zwischen dem Vater und dem Sohne vorüber.
Aber so kurz es gewesen, so viel Ruhe hatte es doch dem Gefangenen gebracht. Die Seinigen wußten nun, wo er sich befand, er schien nicht mehr so ganz verlassen, seit er das blasse, thränenvolle Gesicht seines ältesten Knaben gesehen. Vielleicht gab es doch früher oder später aus dieser Hölle eine Erlösung, vielleicht schlug auch ihm noch die Stunde, wo er frei wurde und zu den Seinigen zurückkehren konnte.
Jetzt kam, gleich einem warmen Hauche die natürliche Ermüdung über alle seine Sinne, er trat vom Fenster zurück und streckte sich auf eine der Bänke. Drüben in der schrecklichen Gesellschaft, auf dem vermoderten Stroh litt es ihn doch nicht, er wollte lieber hier ein Stündchen verträumen und dann später den Aufseher bitten, ihm irgend eine Arbeit anzuweisen.
Seltsam, wie sehr der Blick seines Kindes ihn getröstet, ihn mit neuem Mute und neuer Kraft erfüllt hatte. Er wollte stark bleiben um jeden Preis, er wollte allen Leiden, allem Verhängnis trotzen, der Seinigen wegen.
Die müden Augen schlossen sich, ohne daß er es bemerkte. Leise, ganz leise entrückte ihn der Traum seinem Schmerze, er war wieder in den eigenen Räumen, er hielt Weib und Kinder fest umfaßt und tröstend erklangen von den Lippen der Unschuldigen die Worte seines Lieblingsdichters:
»Er weiß dein Leid und heimlich Grämen,
Auch weiß er Zeit, dir's zu benehmen,
Gib dich zufrieden!«