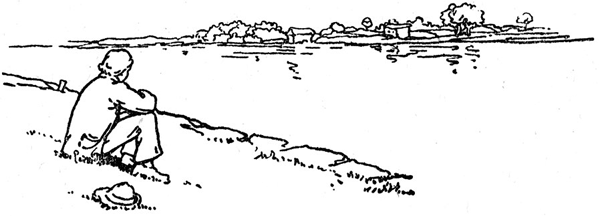|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Verwöhnt vom Glück, das ihn jedesmal streichelte, wenn es ihn geprügelt hatte, hoffte Koja fest auf eine Änderung seiner Lage zum Besseren. Gerngläubig baute er seine Hoffnung auf Zettel, die er in schöner Frakturschrift geschrieben und in die Schaufenster zweier Papierhandlungen gebracht hatte: »Nachhilfe-Unterricht in Griechisch, Deutsch, Latein, Französisch und Mathematik erteilt ein im Unterricht erfahrener Obergymnasiast.« Und schon machte er sich auf die Suche nach der neuen Wohnung. Nicht weit vom Gymnasium, in einem Eckhaus der Fillgradergasse und Theobaldgasse fand er eine geräumige langgestreckte Kammer, die nur den Übelstand hatte, daß ihr Fenster die Aussicht auf die schmutziggelbe Rückwand des Polizeigefangenenhauses bot, dessen kleine, vergitterte Fenster den Eindruck der Ödigkeit nur steigerten. Von der anstoßenden Küche der Vermieterin aus sah man auf den stillen Hof des uralten Wohngebäudes, wo stets einige Spitzhunde, Stallpinscher und Katzen auf der Lauer lagen, um die aus dem Kanalgitter sich hervorwagenden Ratten abzufangen.
Etwas nüchtern sah das weißgetünchte Gemach aus, mit seinen fast kahlen Wänden und seiner ärmlichen Einrichtung. Frau Ziegler, eine von Blattern entstellte Wäscherin, von unbestimmtem Alter, lobte dem Studenten die ruhige Wohnung ohne Wagengerassel und ohne Kindergeschrei. Außer dem grünen Schubwagen, der die Häftlinge brachte, fast kein Verkehr; und sie gäbe die Kammer um bloß acht Gulden Monatsmiete, weil sie nicht Zeit hätte, den Zimmerherrn zu bedienen; die Hilfe ihrer kränklichen Tochter Grete gebe nichts aus. Ein Blick auf das Mädchen, dessen breites Gesicht von gelblicher Blässe war und dessen langer Rumpf die kurzen nach auswärts gebogenen Beine zu überlasten schien, machte es Koja begreiflich, daß an diesem Wesen die Mutter nur eine schwache Stütze hatte. Wie gern gab er das Angeld! Hier bei den armen Leuten wollte er sich seine kleine Welt einrichten, in der er ganz sich selbst gehörte.
Bei den Zierlechnerischen rief seine Mitteilung, daß er schon eine neue Wohnung hätte, unverhohlenes Befremden hervor. Trotz aller Einsprache der Frau, trotz der Tränen der kleinen Traudel, blieb Koja dabei, am Letzten des Monats auszuziehen. Als Koja eine Woche später seine Sachen packte, schob ihm die Frau alle naturgeschichtlichen Nachschlagewerke, die er in ihrem Auftrag angeschafft hatte, zu: »Nehmen Sie das Handwerkszeug in Ihre geistige Werkstatt. Bis Weihnachten haben wir ohnehin nur mehr sieben Wochen, da kauf' ich's den Kindern neu.« – Gerührt von so viel Güte dankte er verwirrt. Am Letzten des Monats zahlte ihm der Baumeister seinen Lohn und sagte ihm ein gutes Wort: »Alles was recht ist, gelernt haben die Kinder bei Ihnen genug.«

Zum Übersiedeln brauchte Koja diesmal schon ein Streifwägelchen, das ihm der Hausknecht des Baumeisters zog. Und er dachte an seinen Einzug in die Engelgasse; damals hatte er all das Seine selbst getragen. Als Koja seine Fensterblumen, seine Bücher und Sammlungen in seiner Stube untergebracht hatte, war der Raum voll redender Dinge und heimelte den Bewohner an. Aber nach Vorausbezahlung der Miete und nach Ankauf von Holz und Kohle blieben dem Studenten nur zwölf Gulden zum Leben.
Das Mittagessen nahm er in der Volksküche ein, wo er um vier Kreuzer einen Teller eingebranntes Gemüse und um zwei Kreuzer ein großes Stück Brot bekam. Morgens und abends aß er ein Stück Brot ohne jede Zutat. Für die Sonntage kaufte er sich ein Stück Speck aufs Brot. Gabelfrühstücke und kaufen gab es nicht.
Seit Koja mit dem Baumeister den Verdruß gehabt hatte, war von ihm kein Brief und keine Karte nach Mannersdorf gegangen. Von Tag zu Tag schob er das Schreiben auf, um erst in der Vergangenheit zu berichten: »Ich habe wieder einmal Mangel gelitten – ich hab' die Not überwunden.« Doch je öfter ihm eine Nachfrage bei den Papierhändlern eine Enttäuschung brachte, je öfter ein Tag verging, an dem er nicht satt geworden war, desto quälender drängte sich ihm die Notwendigkeit auf, Agi um Hilfe anzugehen. Noch aber zögerte er. Erst hielt er Umfrage, ob er nicht irgendwo als gewerblicher Hilfsarbeiter unterkommen konnte, aber ohne Erfolg.
In dieser Zeit der Bangigkeit lernte er den Realschüler Fabian kennen, den Sohn eines Kupferstechers. Der wohnte im selben Hause wie Koja und hatte durch Frau Ziegler von der Bücherei ihres Zimmerherrn erfahren. Der hochaufgeschossene, blasse Bursch trug starke Bikonkav-Brillen und machte den Eindruck eines Bücherwurms. Als er Koja das erstemal besuchte, brachte er Lombrosos Büchlein mit »Genie und Irrsinn«. Von seinem Vater her, der sich in die Rolle eines erblich Belasteten widerstandslos ergeben hatte, mit Lombrosos Schriften vertraut, war Fabian kritiklos ein Anhänger der Lehre von der zwingenden Macht vererbter Anlagen geworden. Er entwickelte seine Anschauungen mit schonungsloser Darlegung seiner Familiengeschichte. Kojas zaghafte Einwände ließen ihn schweres Geschütz auffahren: Als Gerichtsarzt und Irrenarzt hatte Lombroso festgestellt, daß die meisten Verbrecher und Irren Kinder von Trinkern waren. Da war alles persönliche Wünschen und Wollen wirkungslos. Seine eigene Kurzsichtigkeit leitete Fabian davon her, daß sein Vater Kupferstecher, sein Großvater väterlicherseits Uhrmacher gewesen war. Was er sich selbst als Charakterfehler vorwarf, seine geringe Widerstandsfähigkeit gegen Versuchungen jeder Art, führte er darauf zurück, daß sein Vater seit seiner Jugend dem Trunke ergeben war und auch der Großvater viel getrunken hatte. Er gefiel sich in der Rolle des beklagenswerten, erblich Belasteten. Er hielt sich zwar für genial beanlagt, glaubte aber fest, daß er im Irrenhaus oder im Zuchthaus enden werde.
Nach dem Besuch zerfahrenen Burschen konnte Koja lange nicht einschlafen. – Fabians Darlegungen waren für ihn eine trostlose Offenbarung geworden. Lombrosos Lehre von der erblichen Belastung wurde ihm zum Schlüssel für das Verständnis seiner eigenen Fehler. Jetzt begriff er, daß er, der dem Vater »wie aus dem Gesicht geschnitten war«, naturgemäß auch mit seiner Genußsucht, seiner Schwatzhaftigkeit, seinem Jähzorn und seiner Willensschwäche belastet war. Er kam sich wie ein unrettbares Opfer des Verhängnisses vor, daß er gerade dieses Mannes Sohn war. Als er vom nahen Turm der Laimgrubenkirche zwölf schlagen hörte und wegen peinigenden Hungers noch immer nicht schlafen konnte, stand er auf, zündete den Schmetterlingsbrenner über seinem Tische an und hüllte sich in seinen Mantel, da es in der Kammer schon kalt geworden war. Dann begann er beim leisen Zischen der Gasflamme mit steifen Fingern einen ausführlichen Brief an die Schwester zu schreiben. Wenn sie ihm nur wieder wöchentlich einen Laib Brot und einen Guldenzettel schickte, war er vor dem verhungern geschützt, vielleicht zahlte sie ihm auch die Kammermiete, bis er wieder einen Verdienst fand. Ob er in Anbetracht seiner erblichen Belastung weiter studieren sollte, darüber sollte die Schwester entscheiden. während er die Seiten mit einer nichts beschönigenden Darlegung seines Lebens im Zierlechnerhaus und in der pennalen Verbindung füllte, schoß ihm einigemal der Gedanke durch den Kopf, es sei selbstisch, es sei rücksichtslos, der Schwester, die sich kaum von den furchtbaren Enttäuschungen des vergangenen Herbstes und Winters erholt hatte, schon wieder das Herz schwer zu machen; aber er brauchte ihre Hilfe und ihren Trost. An die Erzählung der Tatsachen reihte er die Darlegung der Lehre Lombrosos von der Macht der erblichen Belastung und schloß mit der Selbstentschuldigung, er wisse nun, daß er oft als Trinkersohn gehandelt hätte, wie er handeln mußte. – Er bat Agi, ihn darob nicht zu verachten und unterschrieb sich: »Dein unglücklicher Bruder Koja.«
Und am andern Tage gab er den Brief unfrankiert auf, damit er sicher ankomme. Zwei Tage später brachte Fabian abends einen schmierig abgegriffenen Band von Kotzebues Gedichten. Er nahm die Stellung eines Vortragskünstlers an, strich sich mit seinen mageren Fingern die schwarzen Haare aus der Stirn und begann mit viel Pathos und großartigen Gesten Kotzebues »Verzweiflung« vorzutragen:
»Was bin ich und was soll ich hier
Unter Tigern oder Affen?
Wozu hat mich Gott geschaffen …«
Als Fabian geendet hatte, war Koja in Verlegenheit. Der Vortragende hatte auf ihn erst den Eindruck eines lächerlich eitlen Menschen, dann aber den eines Geistesverwirrten gemacht. Er tat ihm den Gefallen, seine Vortragskunst »großartig« zu finden und ließ es über sich ergehen, daß Fabian, der sich ungeheuer wichtig vorkam, fast dasselbe wieder sagte, was er zwei Tage vorher gesagt hatte, als wär' es sein ganzes Um und Auf. Als es aber zu lange dauerte, stand Koja auf: »Entschuldigen Sie, ich hab' noch zu lernen.« Etwas betreten empfahl sich Fabian und lud sich für die Zukunft ein: »Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen!«

Am nächsten Morgen war im Gymnasium feierlicher Gottesdienst zum Namensfest der Kaiserin Elisabeth und dann war der Tag schulfrei. – Koja ging in gedrückter Stimmung durch den Esterhazypark heimzu, die Augen auf die Fußspuren gerichtet, die andere vor ihm in die dünne Schicht des ersten Schnees getreten hatten. Der Hunger peinigte ihn. Da hörte er sich angesprochen: »Na, Lorent, was fehlt Ihnen denn, daß S' so schleichen? Haben Ihnen heut' die Hendeln das Frühstück weggefressen?« – Aufblickend sah er in das breite, von dünnem Bart umrahmte Gesicht seines Chemieprofessors Wallentin, dessen Augen ihn ermunternd durch die Brillen anblitzten. Und ohne Umschweife sagte er ihm, wie es um ihn stand. Und Wallentin machte ihm den Vorwurf: »Sie hätten sich an Ihre Professoren wenden sollen, da hätten Sie Privatschüler genug bekommen. – Das will ich Ihnen vermitteln. Aber zunächst helfen Sie mir. Ich krieg' morgen die Reinschrift meines Lehrbuches der organischen Chemie. Bevor ich's dem Drucker schick', möcht' ich's kollationieren. Mit der Urschrift vergleichen: einer liest die Urschrift, der andere die Abschrift und bringt die Richtigstellungen an. Einstweilen nehmen S' das als Vorschuß.« – Und er drückte ihm eine Fünfguldennote in die Hand. Ehe der verblüffte Student ihm danken konnte, bestieg der Professor den Wagen der eben vorbeifahrenden Pferdebahn.
Jubeln hätte Koja mögen. Diesen Elisabethtag wollte er sich merken. Jetzt noch zu den Papierhändlern. Beim ersten war's wieder nichts, beim andern aber fand er zwei Visitkarten vor. Ein Korrepetitor für Latein wurde gesucht und einer für Französisch. Mit elastischen Schritten erledigte er auf dem Heimweg beide Gänge. Er wurde angenommen; denn Zuversicht und Selbstvertrauen strahlten ihm aus den Augen. Er machte einen guten Eindruck. In beiden Häusern sagte er: »Ich habe weder Zeit noch Lust, ins Kaffeehaus zu gehen; deswegen ersuche ich, daß mir jedesmal, wenn ich in die Stunde komme, ein Imbiß verabreicht werde.« Und die Mütter sagten lächelnd zu. Gerne wollten sie dem Herrn Studenten ein mit Schinken belegtes Butterbrot geben oder eine Tasse Milchkaffee und eine Semmel.
Daheim wartete eine größere Freude auf Koja: Von Agi war als Eilsendung ein Kistchen eingelangt. Als er es öffnete, fand er darin ein großes, weißes Brot, handhoch aufgegangen, rechteckig wie das Backblech der Mutter; es war im Ofenrohr gebacken worden. Außerdem aber waren da zwei Blechbüchsen. In der einen eine fette »Einbrenn« mit Kümmel durchsetzt, in der andern Schweineschmalz, gebräunt von darin gerösteten Zwiebelschnitten. Auf dem Grunde des Kistchens aber fand sich ein ungewöhnlich dicker Brief. Koja schnitt sich ein Rindenstück vom Milchbrot ab, dann gönnte er sich den Genuß des lieben Schreibens:
»Unser lieber, lieber Koja!
Feuchtersleben zitiert zu Beginn des 11. Kapitels Marc Aurel: ›Sei Herr deiner selbst, und bleibe guten Mutes, in gesunden wie in bösen Tagen‹. –
Recht froh bin ich, daß Du aus dem Hause draußen bist, wo es dir viel, viel zu gut gegangen ist; das taugt nicht für Dich! Sorglosigkeit ist Dir ungesund. Du brauchst die zwingende Notwendigkeit, wenn Du frisch bleiben sollst. Aber Du mußt Dir selbst gehören. Ja, Du mußt Dir selbst gehören, wenn Du andern gedient hast; ein ärmliches Stübchen, in dem Dich Deine redenden Dinge an Dein Ziel gemahnen, sei Deine Zufluchtsstätte, in die niemand eindringen soll, von dem Du abhängst. Daß Du jetzt bei armen und ordentlichen Leuten Deine Kammer für Dich hast und wieder mehr sorgen mußt, um Dir das Notwendigste zu erarbeiten, gönn' ich Dir vom Herzen. Das wird Dich wieder aufrichten. Wenn Du auf Deine Zettel bei den Papierhändlern nicht gleich Stunden bekommen hast, deshalb brauchst Du nicht zu verzagen. Denk' daran, wie ich in Wien Arbeit gesucht hab'. Geh' nur einmal zu Deinen Professoren, die wissen immer Schüler, die Nachhilfe brauchen. Du hast eine angeborene Begabung zum Unterrichten, Du weißt Dir zu helfen, da wirst Du weiter empfohlen werden, von einem Haus ins andere. Es könnte aber sein, daß Dein Glück manchmal schwankt, weil Du vielleicht noch nicht genug Dummheiten gemacht hast, um nicht wieder neue zu machen. Darum will ich Dich vor dem Ärgsten bewahren, wenn es auch nur eine kleine Hilfe ist, was ich Dir biete.
Du bekommst von nun an wieder wöchentlich einmal eine Sendung von mir und der Mutter, gleichviel, ob Du's mehr oder weniger brauchst. Und wenn Du vom Brot issest, das die Mutter gebacken hat, dann denk' daran, daß ihre lieben Hände es geknetet haben, die durchströmt sind von ihrem starken Willen. Das Brot wird etwas von ihrer Liebeskraft auf Dich übertragen. Aus der Einbrenn koch' Dir eine Morgen- und eine Abendsuppe, schneid' Brot hinein und gib etwas Schmalz darauf, daß die Fettaugen obenauf schwimmen.
Die sechs Guldenzettel, welche diesem Briefe beiliegen, verwende zum Zahlen der Interessen im Versatzamt und zur Verbesserung Deiner Kost. Und wenn Du wieder was erübrigst, so kauf' Dir Saiten für Deine Laute. Sing' und spiel', denn Du hast alle Ursache, fröhlich zu sein. Der Frohsinn ist nicht nur für die Seele gesund, sondern auch für den Leib. Den Klamschbruder Klamschen = verstimmt reden. Fabian stoß' nur sobald als möglich ab; er könnte Dich mit seinen Flausen anstecken. Wenn er sich für verloren hält, so verdirbt er ganz gewiß. – Ich will Dir etwas anvertrauen, worüber ich gern geschwiegen hätte, bis ich nach dem Erfolg hätt' sagen können: ›Es ist mir gelungen.‹ Bei den Verwaltersleuten hab' ich den neuen Oberlehrer kennengelernt, dessen Frau erst Kindergärtnerin war und dann hier an der Schule Handarbeitslehrerin geworden ist. Er hat mir zugeredet, ich sollt' auch, die Handarbeitslehrerinprüfung machen, damit ich in irgendeiner Nachbargemeinde eine Anstellung bekäme wegen der Altersversorgung. – Er und seine Frau sind sehr lieb zu mir; ich glaube, sie möchten mir gerne von hier forthelfen, weil ich als Näherin der Frau Oberlehrer im Wege bin. Sie haben mir Bücher zur Vorbereitung geborgt, Bücher sag' ich Dir, die wichtiger sind als alles, was Du und ich bisher kennengelernt haben. Besonders wertvoll ist mir die Erziehungslehre, aus welcher der Oberlehrer studiert hat. Der hat sie mit handschriftlichen Randbemerkungen gespickt. Er hat allerlei Feuilletons und Abhandlungen eingeklebt, die das Buch erst lebendig machen. In einem sehr wissenschaftlich gehaltenen Artikel spricht der Jurist Dr. Bruno Schulz vom »intellegiblen« Charakter, das heißt vom Charakter, wie er sich aus der Betrachtung der ererbten Schädelbildung im voraus erkennen, förmlich prophetisch vorausbestimmen läßt. Dabei führt auch er Lombrosos Studien an, die der an Irren und an Verbrechern gemacht hat. Ich war entsetzt über das Furchtbare einer so zwangsweisen Vorausbestimmung des persönlichen Schicksals. Am Rand steht die Notiz: ›Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm‹. Da wäre also des Menschen ehrlichstes Ringen nach der Schaffung seines Charakters und Glückes ganz vergeblich, er könnte der angebornen Triebe, die ihn der Entwertung zudrängten, nicht Herr werden. – Tief erschüttert dachte ich an Dich, mein lieber Koja, und an unseren Rudi. Um mich selbst war mir nicht bange, da ich zu einer Zeit geboren wurde, als unser Vater noch kein Trinker war. Nun fand ich aber am Ende des Artikels die Anmerkung des Oberlehrers: ›Vergleiche Stanley Hall‹ und darunter die Umänderung des obigen Spruches: ›Der Apfel fällt oft weit vom Stamm‹. Da ich im ganzen Buch von Stanley Hall nichts fand, erbat ich mir vom Oberlehrer die Erklärung. Was ich erfuhr, nahm von mir alle Angst, die ich um Dich und Rudi hatte. Stanley Hall, der seit 1887 an der Universität Worcester Seelenkunde und Erziehungslehre vorträgt, hat durch viele Versuche an Insassen von Zuchthäusern nachgewiesen, daß selbst schwere Verbrecher, durch jahrelange Anwendung gegensätzlicher Maßnahmen dauernd in gesellschaftlich brauchbare Menschen umgewandelt worden sind, die sich nach der Entlassung aus dem Gefängnis in Dienststellungen bewährt haben. Zu solchen gegensätzlichen Maßnahmen gehört vor allem die Veränderung der Trinkerkinder durch völlige Enthaltsamkeit vom Alkohol, Arbeit mit erfreulichen, sichtbaren Erfolgen, die Pflege von Blumen und Tieren zur Gewöhnung an zarte Fürsorge, wo die Roheit eine Charaktereigentümlichkeit war u. dgl. m. – Ein Sichabmühen für das Wohl anderer Lebewesen. Das ganze Geheimnis der Stanley Hall'schen Behandlung ist: Entwicklung der verkümmerten guten Anlagen durch deren Übung bei gleichzeitiger Verkümmerung der schlechten ererbten Anlagen infolge Nichtübung. Das Rezept ist einfach! Weißt Du noch, wie Du in ersten Selbsterziehungsversuchen Dir das Fürchten und das Lügen abgewöhnt hast? Damals, in Deiner glücklichen Waldläuferzeit hast Du unbewußt den Kampf gegen das Ungute in Dir aufgenommen. Und jetzt, wo Du schon so viel erreicht hast, möchtest Du verzagen? Was fällt Dir ein?! Was Stanley Hall dem Entarteten vorschreibt, das kann sich jeder Selbsterzieher nach erfolgter Selbstprüfung selbst vorschreiben. Das ist Dein Fall! Sei Dein eigener Arzt und Erzieher. Lieber Koja! Wärst Du in dem reichen Haus geblieben, wo Du üppig überfüttert und mit Alkohol getränkt worden bist, Dein Schicksal wäre ärger geworden als das unseres Vaters; denn er ist erst als Mann ein Trinker geworden. Jetzt weißt Du, was Du zu meiden hast und wirst Dein Unglück nicht wollen. – Du wirst Dir eine planmäßige Selbsterziehung zurechtlegen und Dich fest am Zügel haben. – Lies jeden Tag ein paar Sätze (Aphorismen) in der Diätetik der Seele von Feuchtersleben und such' eine Anwendung auf Dich. Gerade Feuchtersleben, der selbst ein Seelenarzt war, führt eine Menge Beispiele an von der Macht des Geistes über den Körper. Auf Seite 5 seines Vorwortes findest Du sein Selbstbekenntnis: ›… und so liegen auch diesem Büchlein – Gott weiß es! – gar manche bittere Selbsterfahrungen zum Grunde.‹ – Dein Tagebuch, das Du wohl in der Zeit, wo's Dir zu gut ging, nicht geführt hast, führ' von heut' an täglich, regelmäßig, wenn auch manchmal kurz. Beginn den Tag damit, daß Du Dir ein paar Imperative ins Tagebuch schreibst, und wenn's nötig ist, immer wieder dieselben, bis sie Dir als innere Mahnworte eigen sind, z. B. ›Schwatz nicht!‹, ›Erst die Pflicht!‹ Es können auch Schlagworte sein: ›Stramm!‹ – ›Unentwegt!‹ – ›Überwinden!‹ Aber Deine besten Vorsätze wären für Dich undurchführbar, wenn es Dir an der Kraft zur Durchführung fehlte. Darum meide alles, was Dich schwächen konnte. Bleib' abends nie über elf Uhr auf; am besten Du schläfst schon um zehn ein. Steh' dafür frühmorgens auf. Ich weiß aus Erfahrung, wie mir selbst die vor Mitternacht versäumten Schlafstunden am andern Tage abgehen. Daß mein Wille trotz der Schwächungen meines Körpers durch Schlafmangel mir über die Tage der Halbheit hinübergeholfen hat, das verdank' ich den unerbittlichen Notwendigkeiten und meiner starken Liebe zu Euch. Ließe ich Euch zugrunde gehen, so ginge ich selbst zugrunde. In Dir ist die rechte Liebe zu uns noch nicht erwacht, sie ist für Dich noch nicht eine Quelle der Kraft. Einmal kommt diese Gnade auch über Dich!
Damit es Dir nicht an körperlicher Bewegung und Schlafbedürfnis fehle, verrichte für Deine Quartierfrau mancherlei schwere Arbeit: Holzspalten, Kohlentragen, Wassertragen, so oft Du kannst. Du tust Deinem Körper wohl damit und erwirbst Dir ihre Dankbarkeit. – Und so oft Du kannst, mach' einen Marsch hinaus in den Wiener Wald. Du wirst neu gekräftigt zu Deinen Büchern zurückkehren. Du hast jetzt eine Menge herrlicher Bücher. Stell' sie nicht in Deiner Bude bloß als Schmuck auf zum Liebäugeln. Mach' sie an Abenden zu Deinen Gesellschaftern. Aus den Büchern werden wertvolle Menschen mit Dir reden. Und wenn der Fabian kommt, sag' ihm das Rezept Stanley Halls, aber gib Dich nicht weiter mit ihm ab.
Noch etwas: Du meinst, Du seiest vom Vater her erblich belastet. Angenommen es sei so. Bist Du nicht auch erblich begütert? Weißt Du noch, wie der Vater Dir in Pöchlarn das Aquarium und den Martin gekauft hat, um Dir Freude zu machen? Du hast gewiß auch diese Lust am Beglücken andrer von ihm geerbt, eine Lust, die jetzt in ihm verkümmert erscheint, weil der Ärmste durch und durch vom Alkohol vergiftet und geschwächt ist. Seine Schwatzhaftigkeit hat sich bei Dir in eine Mitteilsamkeit umgewandelt, die Dir das Unterrichten zum Vergnügen macht. Du brauchst nur zu bremsen, daß Du nicht unnützes Zeug redest. Und bist Du nicht von der Mutter her erblich begütert mit jenem herrlichen Schatz von Seelengüte, die Dich Kindern und Erwachsenen lieb macht? Wie kann dieser gute Kern in Dir sich noch entfalten zum Segen vieler Tausende von Mitmenschen! Vergiß nicht, daß Du Arzt werden willst. Ein Arzt im Sinne Feuchterslebens und Dr. Bocks: Du wirst nicht nur viele von Krankheiten heilen, sondern bei Deiner hellen Begabung zu freudigem Lehren wirst Du noch mehr die Menschen durch ehrliche Ratschläge vor dem Krankwerden bewahren. Dein Haus der Sehnsucht werden viele aufsuchen. Damit Du als ein Wissender raten könnest, lern', lern', was Du später brauchen wirst für andre! Ich und Mutter werden Dir treulich in der Wirtschaft helfen. Nicht vom Geld der Kranken sollst Du abhängen. Aber geliebt sollst Du sein von den Gesunden, die ihr Glück Dir verdanken werden. – Oh, es ist ein köstliches Bewußtsein, von anderen geliebt zu sein! Du wirst noch mehr Liebe ernten als ich. Denn Du wirst mehr Gutes tun können als ich. Jetzt aber gute Nacht, Du Beneidenswerter, Du Besonderer, Du erblich Begüterter, unser Koja!
Es küßt und umarmt Dich
Deine Mutter und Schwester.
Noch etwas: Du erinnerst Dich, daß ich Rudis krumme Beinchen zwischen Schindeln geschient hatte. Denk' Dir, sie sind fast gerade geworden. Die knorpelreichen Knochen haben sich dem Zwange gefügt. Die vorherrschende Milchnahrung hat das Kind gekräftigt. Seit einer Woche macht der Kleine erfreuliche Fortschritte im Gehen. Sag' das der guten Mutter Willys und sag' ihr auch unsern innigen Dank. – Gesundheitspflege und Erziehungskunde sollten jeder Familie eigen sein. Das sind doch keine Geheimwissenschaften. Sie gehören zur Elementarbildung jedes Laien. Koja, dafür wollen wir uns einsetzen, gelt?!« –
Als Koja den Brief zu Ende gelesen hatte, las er ihn behaglich, jeden Satz genießend, noch einmal, dann drückte er ihn an die Lippen und steckte ihn in die Brusttasche. Den wollt' er bei sich tragen und immer wieder lesen; er wollte ihn auswendig lernen, auswendig? nein inwendig!
Wie schmeckte ihm heute in der Volksküche das einfache Mittagessen! – Voll zuversichtlicher Gedanken marschierte er quer durch die Stadt zur Donau. Rastend am Ufer, sah er dem schwer hinziehenden Stromwasser zu, auf dem die matte Herbstsonne glitzerte und legte sich sein neues Leben zurecht: Arm und frei! – In den nächsten Tagen war Koja vom Kollationieren der Organischen Chemie bei Professor Wallentin stark in Anspruch genommen, was ihm noch zehn Gulden und nebenbei eine Bereicherung seines Wissens eintrug. Und dann gab es dauernden ausgiebigeren Verdienst. Von den Professoren wurden ihm noch zwei Lateinschüler zugewiesen. Köstlich waren seine Abende in wohlgeheizter Stube. Beim behaglichen Studium war er sich dessen bewußt, daß er dem Hause der Sehnsucht näher kam. Und er fühlte, daß der Mutter Geist bei ihm war und der Geist Agis.