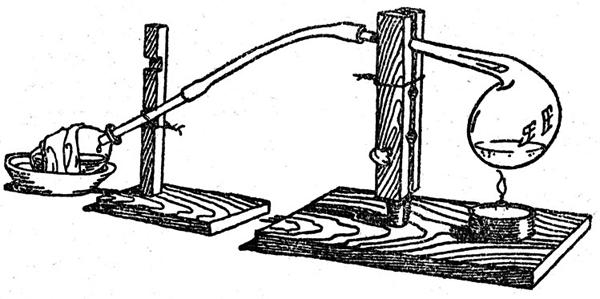|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Kojas Briefe wurden kürzer und kürzer, je näher der Sommer kam. Schließlich begnügte er sich damit, auf einer Korrespondenzkarte den rechtzeitigen Empfang des Brotlaibes und des Guldenzettels zu bestätigen. Ab und zu schloß sich an die Danksagung eine kurze Mitteilung an: von der guten Meisterin, die ihn an sonnigen Nachmittagen ins Freie schickte, vom Baden und Wettschwimmen in der kühlen Traisen, von Sonnenbädern auf durchwärmtem Wellsande, vom deutschen Schlagballspiel auf gemähten Wiesen und vom abendlichen Bummeln mit sangesfreudigen Kameraden.
Wie ganz anders ließ sich für Agi der regenarme Sommer an in der noch unausgebauten Wiener Vorstadt! Die verblühten Robinien waren bedeckt vom Staube, den die knarrenden Ziegelfuhrwerke zermahlen hatten. Der sogenannte Gürtel, der als breite, ungepflasterte, vielbefahrene Lastenstraße an den zum Teile verfallenen Linienwällen entlang um die neun inneren Bezirke führte, war eine trostlose Randwüste, wenn Agi bei ihren Liefergängen den Gürtel überquerte, begegnete sie Dienstmännern, die vor überladenen Wägelchen keuchten, hageren, lastentragenden Weibern, betrunkenen Jugendlichen und anderen Gestalten des Großstadtelendes, deren Anblick in ihr immer den Abwehrgedanken aufrief: Nur nicht verelenden, nur nicht verelenden! – Von solchen Gängen kam sie immer niedergeschlagen, von Staub und Hitze ermattet heim und mußte sich erst durch kalte Waschungen arbeitsfähig machen. – Dann suchte sie ihren lauschigen Winkel im Frieden des Gottesackers auf. Sie tränkte ihre Rosen, die ihr zu Dank nach der entschwundenen Maienblust neue Knospensträuße ansetzten. Gar lieblich heiter stach der Blüten zartes Rot vom Ernste der dunkelgrünen Zypressen ab. Agi tat den Rosen wohl, und die Rosen taten ihr wohl. Und während sie beim Nähen ihren Gedanken freien Lauf ließ, war ihr das umblühte Grab eine Stätte heimlichen, zaghaften Glückes. Hier holte sie aus ihrem Tagebuch, das auch ihre Lesefrüchte enthielt, das Gedicht vom Heinzelfräulein hervor, hatte doch ein wirklicher Dichter sie besungen! hier betrachtete sie sich ein gepreßtes Rosenblatt; es gemahnte sie an ein weißes Röslein, das ihr Urban auf die Nähmaschine gelegt hatte. Und Urban war so gut, so vorsorglich! Am Tage seiner Abreise in die Heimat hatte er der Mutter die Miete bis September vorausgezahlt, damit ihm die Kammer belassen werde, denn im Herbste wollte er wiederkommen.
Am 15. Juli trat Lorent endlich seinen Dienst als Verschieber an. Schon die fünf Viertelstunden Weges, die er beim Tagesgrauen vom äußersten Westen der Großstadt bis zum Aspang-Bahnhof im äußersten Osten zurücklegte, ließen ihn mit Unlust seine Arbeit beginnen. Den ganzen Tag verbrachte er verdrossen beim An- und Abkoppeln der Wagen wie ein zur Zwangsarbeit Verurteilter. Übermüdet vom Laufen auf dem sonnerhitzten klobigen Schotter zwischen den Schienen, die schwieligen Hände rostbefleckt, trat er nach zehn Uhr abends den Rückweg an. Und so müde, so abgeschlagen kam er zu Hause an, daß er nicht fähig war, sich über Koja zu freuen, der pausbackig und sonnverbrannt von St. Pölten heimgekehrt war. Er grüßte den Vater mit der Schüchternheit eines Knaben, der kein gutes Gewissen hat. Agi und die Mutter bangten davor, daß der Vater nach Kojas Zeugnis fragen werde, in dem ein »Nicht genügend« in Griechisch stand und die Bemerkung: »Zur Nachprüfung zugelassen.« Aber der Vater fragte nicht. Gierig aß er sein spätes Nachtmahl und legte sich schlafen, denn er mußte im Morgengrauen wieder in den Dienst. Als er beim Frühstück von Agi erfragte, daß Koja durchgefallen war, schlug er mit der Faust auf die Tischplatte: »Der Bub kommt in die Lehr zu einem Schlosser, und das gleich!«
Da legte Agi ihre beiden Hände um des Vaters Faust: »Die fremden Leut in St. Pölten haben gut gesorgt, daß Koja nicht verhungert ist; aber um sein Lernen hat sich niemand gekümmert. Jetzt ist er bei uns, und wir halten daran fest, was wir uns vorgenommen haben. Er wird im Herbst die Nachprüfung bestehen, das ist meine Sorge; und weiterstudieren wird er auf meine Kosten; nähen werd' ich für ihn Tag und Nacht, so hab ich's ihm versprochen, und so werd ich ihm's halten. Und dir, Vater, soll's von heut an besser gehen, weil du den Koja da hast. Er wird dir täglich das warme Mittagessen zutragen.« Der Vater fügte sich dem starken Willen der kaum sechzehnjährigen Tochter.
Anders, als Koja sich's vorgestellt hatte, gestalteten sich für ihn die Sommerferien. Wohl war er darauf gefaßt gewesen, daß Agi ihn zum Griechischen anhalten würde; aber die übrige Zeit hatte er im Naturhistorischen Museum zubringen wollen oder in der Schönbrunner Menagerie, im Prater oder im Wienerwald. Indessen mußte er täglich gerade in der heißesten Zeit unterwegs sein, um dem Vater das Essen zu bringen. – Wenn er mit dem Korb, in dem die vollen Töpfe standen, behutsam dahinschlich, um nichts zu verschütten, empfand er seine Armut drückender, als er sie in St. Pölten empfunden hatte. Und gleichviel, ob er von der Hitze ermattet oder vom Regen durchnäßt heimkam, die Schwester bestand darauf, daß er bald irgendeine Arbeit in Angriff nahm. Und täglich mußte Koja in der Grammatik und im Übungsbuch so viel erledigen, als Agi ihm zugerechnet hatte. In ihrem angeborenen Wissensdrang wies sie dem Bruder die Rolle des Erklärers zu. Sie ließ sich von ihm das Verständnis der griechischen Texte erschließen, damit sie seinen Übersetzungen und Rückübersetzungen gut folgen könnte. So kam Kojas angeborene Mitteilungssucht zu ihrem Rechte. Daß er nur selten im Naturhistorischen Museum eine Vormittagsstunde zubringen konnte und nur ein einziges Mal nach Schönbrunn kam, verschmerzte er. Denn köstlich waren ihm die nachmittägigen Griechischstunden im stillen Friedhofswinkel, bei denen ihn das Entzücken der Schwester über den Wohlklang der Sprache und den tiefen Sinn mancher Sätze zur Freude an der Sache führte, wie er sie beim schulmäßigen Betrieb nie empfunden hatte. So kam es, daß er die Nachprüfung verblüffend gut bestand und mit dem Ansehen eines begabten Burschen in die vierte Klasse des Mariahilfer Gymnasiums aufgenommen wurde.

Agi, die acht Wochen lang auf Kojas neue Bücher Kreuzer für Kreuzer gespart hatte, empfand die mutterhafte Freude, ihn mit allem Nötigen ausstatten zu können. Und schon begann sie, aufs Schulgeld zu sparen, von dem der mit Nachprüfung Aufgestiegene keine Befreiung erhoffen durfte.
In der letzten Septemberwoche fand sich Peter Urban richtig ein, sonnverbrannt und stattlicher, mannhafter. Seinen Vollbart hatte während der Ferien keine Schere berührt. Koja bekam als Schlafstätte einen Strohsack in einem Fensterwinkel der Wohnstube. Agi und Mutter waren wohlgemut, obwohl sie bis tief in die Nacht zu nähen hatten, wenn der Hunger gebannt und das Schulgeld für Koja gespart werden sollte. Da kam eines Abends der Vater mit einer Neuigkeit heim, die alle Vorausberechnung über den Haufen warf: Zwischen Götzendorf an der Wien – Brucker Strecke und Mannersdorf am Leithagebirge war eine kurze Flügelbahn im Bau, und er hatte die Aussicht, vom 1. Oktober an als Bremser bei den Schotterzügen Verwendung zu finden. Am 1. November sollte der Personenverkehr beginnen. Wenn's ihm glückte, als Schaffner übernommen zu werden, war er wieder so weit, als er in Pöchlarn gewesen war. Und seine Hoffnung erfüllte sich. Am 1. Oktober trat er den neuen Dienst an, verbrachte die Tage auf der Strecke, verköstigte sich in Kantinen und nächtigte in der Mannschaftsbaracke zu Mannersdorf. Mutter und Agi behielten einstweilen die Wohnung in Wien; es mußte abgewartet werden, ob es dem Vater gelang, sich in der neuen Stellung zu behaupten. Koja wollten sie auf alle Fälle im Studium belassen. Ihr Leben schien sich wieder sorgenfreier zu gestalten. Jetzt, wo die Abwesenheit des Vaters für sie eine Sicherung des Friedens im Hause bedeutete, kam über alle drei ein so anheimelnder Frohsinn, daß Urban das Bedürfnis empfand, daran teilzunehmen. Er erbat sich die Gunst, sein Abendmahl mit ihnen einzunehmen, plauderte von der geliebten Mutter, ihrer Wirtschaft und seiner grünen Heimat, sang und spielte Volks- und Studentenlieder und begann, Koja im Lautenspiel zu unterrichten. Das erste Lied, das Koja begleiten lernte, war Agis Lieblingslied »Der rote Sarafan«, und leise sang es die Schwester mit.
Koja fand an dem älteren Gefährten einen dankbaren Zuhörer, dem er Ernstes und heiteres aus der Schule erzählte. Wieder wie in Melk hatte er im Lehrkörper seine Lieblingslehrer, von denen er schwärmte. Da war der berühmte Geograph Dr. Umlauft mit seinem feinen Humor, der Deutschlehrer Dr. Karl Haas, der als ehemaliger Bühnenkünstler die Schönheiten der Balladen Uhlands und Schillers begeisternd zur Geltung brachte, dann der Chemiker Dr. Wallentin, der im gemütlichen Urwienerdeutsch in geistvollster Weise die Beobachtungen der Experimente aus den Schülern herausfragte, ferner der als Volkslieder-Sammler bekannte Physiker Dr. Josef Pommer, dann der feine Aquarellist Kantor, bei dem es keine unbegabten Zeichner gab, weil er jedem gerade das zuwies, was er leisten konnte, und der Gesangslehrer Bauer, ein feinsinniger Liederkomponist. Lauter ganze Menschen, von denen Koja mit leuchtenden Augen sprach. – Von Bauers vierstimmigem Chor »Märchenbilder« war er so begeistert, daß er sich alle vier Stimmen herausschrieb und Urban bat, das wunderbare Lied auch der Mutter und Agi zu Gehör zu bringen. Und Urban lud sich dazu seine Gefährten ein. Dolo übernahm es gern, mit der Geige jedem einzelnen seine Stimme einzuüben. Als es zur Aufführung kam, waren die Sänger wie die Lauschenden dem Alltag entrückt. – Mit leise wiegenden Rhythmen setzte das Lied ein, neckisch sang es von Nixen und Kobolden, in plötzlichen Störungen des Rhythmus von huschenden Irrlichtern, in getragenem Ernst vom warnenden Eckehardt und in mächtig anschwellenden, wie von Sturm und Blitz gejagten Akkorden von der wilden Jagd. Es sprach die Wehmut aus über die versunkene Wunderwelt und schloß mit einem erlösenden Trostwort. Die schönen Abende brachten die Menschen einander näher, und Urban, dessen Musikunterricht bei Koja unerwartet rasche Erfolge erzielt hatte, ließ sich's nicht nehmen, auch Agi im Lautenspiel zu unterweisen. – Sie litt es gerne, daß er bei ihr saß, während sie nähte, sie lauschte seinen Erläuterungen der Akkorde, selten aber nahm sie sich die Zeit zum Üben; denn immer schien es ihr ein Raub an der Zeit, die sie brauchte, um mit der Nadelarbeit die Ihrigen vor Hunger zu bewahren. Die noch immer schwächliche Mutter hatte vollauf zu tun, um neben der Pflege ihres Jüngsten die häuslichen Arbeiten zu bewältigen.
Geradeso, wie in Melk Professor Gabriels Unterrichtsweise aus Koja einen begeisterten Naturbeobachter und Sammler gemacht hatte, löste Professor Wallentins Unterricht in ihm eine neue Leidenschaft aus: die Chemie. Das war ihm eine lebendige Wissenschaft, die Rätsel löste, Geheimstes aufdeckte, Altes zerstörte und Neues schuf. Dem Jungen ging ein Licht darüber auf, daß die Grundstoffe eigentlich aus kleinsten Einzelwesenheiten bestehen, mit arteigenen Neigungen, Abneigungen, Kräften und Fähigkeiten begabt. Kein Menschenauge schaute das Zustandekommen der mineralischen Neuschöpfungen im Erdboden. Aber der experimentierende Chemiker konnte das wunderbare Naturgeschehen wieder geschehen machen nach seinem Willen! Und was ging alles in den Pflanzen vor, die aus scheinbar leblosen Mineralstoffen lebende Zellen bauten! Vgl. R. H. Francs »Die Pflanze als Erfinder«. Kosmos-Verlag. Stuttgart. Als Koja in seiner Mitteilsamkeit der Schwester von solch geheimen Leben im Innern der scheinbar seelenlosen Stoffe sprach, gewann er an ihr eine wertvolle Verbündete. Zu den chemischen Experimenten, Vgl. H. Günther »Chemisches Experimentierbuch« Kosmos-Verlag, Stuttgart. die er daheim vor Mutter und Agi machen wollte, brauchte er nämlich Geld. Und Agi war bereit, es ihm zu verschaffen, und wenn die ganze Familie auch deshalb ein paarmal auf den Genuß von Pferdefleisch-Gulyas verzichten sollte. So ermutigt, machte nun Koja einen Überschlag, was er zunächst brauchte: eine Retorte, eine Woulf'sche Flasche mit zwei Hälsen, einen Glastrichter, einen Rezipienten, einige Glasröhrchen, Kautschukschläuche, etwas Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure und – und andere Chemikalien. – »Doch nicht alles das auf einmal?« warf Agi ein. Und Koja fragte kleinlaut: »Wieviel Geld könntest du mir drauf geben?« – »Wenn's hoch geht, einen Viertel Gulden.« Da wurde er nachdenklich. – »Hm, das reicht kaum auf ein wenig von jeder Säure und auf ein paar Schlauchabfälle, vielleicht noch auf einige Glasröhrchen.« – Er sann und ersann einen Ausweg. »Statt der Woulf'schen Flasche verwend' ich die Kolbenflasche, die wir in der Bodenkram haben, in den dicken Korkstoppel brenn' ich mit einem heißen Nagel zwei Löcher. Das sind die zwei Hälse. Als Retorte verwende ich irgendein Medizinfläschchen, das ich in einem Wassertopf erhitze, und als Rezipienten bind ich eine aufgeweichte Schweinsblase vor – freilich für jeden Versuch taugt's nicht.« Und dankbar nahm er die Silbermünze aus Agis Hand. Noch am selben Tage kaufte er das Allernotwendigste. Über einer Kerzenflamme erhitzte er das Ende eines Glasröhrchens, bis es sich durch Zusammenschmelzen schloß, erhitzte es wieder, blies hinein, daß es sich ballonartig blähte, dann schlitzte er die weiche Glasblase mit dem Taschenmesser und erweiterte sie durch Streichen über der Flamme mittels eines Eisenstäbchens von innen aus, bis sie ein Trichter wurde. Dann setzte er den Trichter in die eine Stopselbohrung der Woulf'schen Flasche so tief hinein, daß sein unteres Ende beinahe den Boden berührte. Er bog ein zweites Glasröhrchen über der Flamme, so daß er ein Kniestück erhielt. Dieses senkte er durch die zweite Bohrung nur so seicht in die Flasche, daß es wenige Zentimeter weit hineinreichte, während der andere Schenkel als Gasableitungsrohr wegragte. Da fragte ihn Agi: »Was willst du denn zuallererst machen?« – »Wasserstoff will ich darstellen.« –
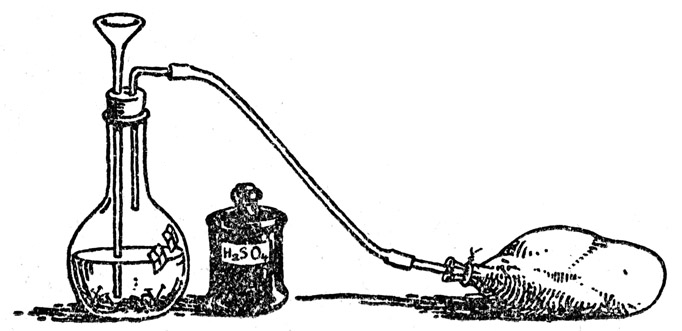
»Wo soll der herkommen?« – »Aus angesäuertem Wasser.« – »Und wie willst du den Wasserstoff austreiben?« – »In der Schule haben wir Zinkspäne verwendet. Die haben sich mit dem Sauerstoff und Schwefel der Säure zu Zinkvitriol vereinigt; dabei ist ihr Wasserstoff frei geworden. – »Du hast aber kein Zink.« – »So verwend' ich halt Eisenfeilspäne. Weißt, Agi, wie Professor Samuel Fergusson In Jules Vernes »Fünf Wochen im Luftballon«. den Wasserstoff zum Füllen seines Luftballons dargestellt hat? – Der hat Eisenfeilspäne mit verdünnter Schwefelsäure übergossen.« – »Na ja,« warf Agi ein, »so steht's in der Jules-Verniade.« – »Und ich will nachprüfen, ob's geht.« Noch am selben Abend gab Koja der Mutter und Agi eine chemische Vorstellung. In die Woulf'sche Flasche tat er eine kleine Handvoll Eisenfeile und band an das Gasausführungsrohr eine vorher eingeweichte luftleer zusammengeballte Schweinsblase als Rezipienten. Dann goß er erst Wasser durchs Trichterrohr, bis es ein Drittel des Flaschenraumes einnahm, und träufelte durch den Trichter einige Tropfen Schwefelsäure hinein. Sofort begannen dort, wo die Säure das Eisen berührte, Gasbläschen aufzusteigen. »Schaut, schaut nur, die Säure wird schon vom Eisen zersetzt. Der freiwerdende Wasserstoff verläßt die Flüssigkeit und – seht nur, wie die Blase sich zu blähen beginnt, ihre Falten gehen auseinander!« Er goß Schwefelsäure nach. Die Gasentwicklung wurde heftiger, das Wasser begann zu wallen und zu schäumen, die Blase füllte sich immer mehr und mehr. Jetzt holte Koja aus der Küche ein Schälchen, goß etwas Wasser hinein und schabte Seife dazu. Mit dem Finger verrührte er die milchige Flüssigkeit, machte sich aus Papier ein Röhrchen und tauchte es in die Seife, daß ein Tropfen daran hängen blieb. Dann blies er vorsichtig hinein, der Tropfen wurde gebläht, eine in allen Regenbogenfarben schimmernde Seifenblase entstand, an der unten noch ein Tröpflein hing, wie die Gondel am Luftballon. Vom Röhrchen abgeschnellt, fiel sie rasch zu Boden und zerplatzte. – »Wißt ihr, warum die Seifenblase so rasch gefallen ist?« fragte Koja mit der Miene eines prüfenden Schulmeisters. – »Ist das auch schon ein Wunder?« fragte Agi dagegen. »Ein Wunder wär's gewesen, wenn die Seifenblase der Schwere entgegen aufgestiegen wäre.« – »Aber womit sie gefüllt ist, das weißt du nicht?« fragte Koja dringlicher. – »Mit Luft, womit denn sonst?« – Da kramte Koja seine Weisheit aus: »Mit Kohlensäure war sie gefüllt, mit der Kohlensäure, die ich aus meiner Lunge hineingeblasen habe. Die Kohlensäure aber ist dichter als die Luft, also auch schwerer, darum ist die Blase zu Boden gefallen, so wie ein Stein im Wasser zu Boden fällt, weil er dichter ist, als das Wasser.« – Koja gefiel sich in der Rolle des Schulmeisters und fuhr fort: »Wenn ich einen Korkstöpsel im Wasser untertauche bis zum Grunde und ihn dann auslasse, steigt er sofort darin auf wie Fergussons Wasserstoffballon in der dichteren Luft; denn der Kork ist lockerer, also auch leichter als Wasser.« – Indessen hatte es in der Woulf'schen Flasche fortgebrodelt, der Schweinsblasenrezipient war kugelig gespannt, das durchs Trichterrohr aufsteigende Wasserstoffgas machte die Flüssigkeit im Trichter gurgeln und spritzen. »Jetzt aufgepaßt!« – Koja nahm den Rezipienten samt dem Kautschukröhrchen vom Glasrohr, quetschte das Kautschukröhrchen zwischen Daumen und Zeigefinger und rief triumphierend aus: »Jetzt hab ich da drinnen den Wasserstoff eingefangen, reinen Wasserstoff. Ihr werdet schauen!« – Aus einer Lade holte er ein Stümpfchen Wachslicht, einen Draht und ein Stäbchen. »So, Agi, jetzt bind' mir das Kerzel mit dem Draht ans Staberl und zünd' es an.« Agi gehorchte. Dann zog sie die Mutter auf den Diwan nieder und faßte sie bei der Hand. Beide sahen gespannt Koja zu, der mit großer Wichtigtuerei im Experiment fortfuhr. Mit der linken Hand hielt er die pralle Schweinsblase gegen die Brust, mit der Rechten steckte er das Kautschukröhrchen in die Seifenlösung. Dann lockerte er die Quetschung, drückte auf den Rezipienten, und schon begannen sich kleine und große Blasen zu bilden, die einander drängten und schoben, bis ein Häuflein von schillernden Seifenblasen die Schale füllte und über den Rand quoll.
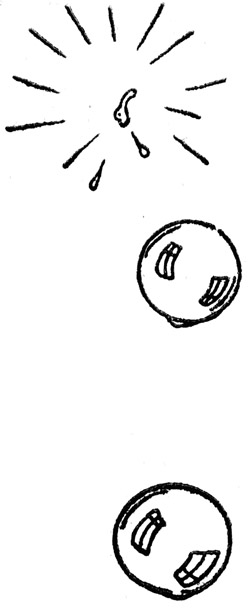
Jetzt mußte Agi das Rohr des Rezipienten quetschen, Koja übernahm von ihr die brennende Kerze und näherte sie dem Häuflein der Seifenblasen. Die Flamme griff nun von einer Seifenblase zur andern, welche nacheinander mit leisem Puffen platzten, bis aller Wasserstoff schwach leuchtend verbrannt war und sich der glatte Spiegel der Seifenlösung zeigte. »Das war schon etwas,« warf Agi anerkennend ein. Koja zündete die beim Zerspritzen der Seifenblasen ausgelöschte Kerze wieder an, reichte sie Agi und nahm ihr den Rezipienten wieder ab. »Jetzt steh' auf und halt' die Kerze hoch. Ich werde mit Wasserstoff gefüllte Seifenblasen steigen lassen und du wirst sie anzünden, wenn sie hochschweben.« »Wenn sie steigen wollen,« warf die Mutter zweifelnd ein.
Nun tunkte Koja das Ende des Kautschukröhrchens in die Seifenlösung und hob damit einen Tropfen heraus, der sich sofort zur schimmernden Blase aufblähte, als Koja die Quetschung lockerte und den Rezipienten drückte. Der Experimentator schnippte nun die Seifenblase weg. Da schwebte sie wie ein richtiger Luftballon empor und trug den anhängenden Tropfen wie eine Gondel mit sich. »Ah!« – »Anzünden!« rief Koja. Agi fuhr mit der Kerzenflamme nach, aber schon war das schimmernde Ballönchen entschwebt und trieb sich unter der Zimmerdecke herum, bis es bei der Berührung seiner Rauheit zerplatzte. Jetzt ließ Koja seine zweite Blase steigen, Agi kam diesmal zurecht, die Seifenblase platzte über der Flamme und verwandelte sie in eine bläuliche Feuerkugel von der das Seifenwasser nach allen Seiten spritzte. Koja wiederholte den Versuch, bis sein Vorrat an Wasserstoff verbraucht war. Dann aber traf er die Vorbereitungen zu einem neuen Experiment, zu dessen Verständnis er in seiner lehrhaften Weise einige Worte vorausschickte: »Jetzt werde ich versuchen, die Seifenblasen mit Knallgas zu füllen. Das Knallgas ist ein Gemenge von einem Teil Sauerstoff mit zwei Teilen Wasserstoff«. Reinen Sauerstoff hab' ich jetzt nicht. Da verwende ich gewöhnliche Luft, in ihr ist zwar der Sauerstoff mit Stichstoff gemengt; um den brauchen wir uns aber nicht zu kümmern. Wenn ich dann das Knallgas anzünde, verbinden sich sofort die zwei Gase, die darin erst gemengt sind, zu Wasser, das ja eine innige, eine chemische Verbindung von einem Teil Sauerstoff mit zwei Teilen Wasserstoff ist. Also wohlverstanden: genau dasselbe, was vor dem Brennen eine Kugel aus zwei Gasen war, dasselbe ist nach dem Brennen ein Tröpflein Wasser. Die große Hitze, die bei der heftigen Vereinigung des Wasserstoffes mit dem Sauerstoff entsteht, dehnt die brennenden Gase plötzlich aus, da treiben sie die Luft in kugelförmigen Wellen vor sich her, im nächsten Augenblick aber verwandeln sich die brennenden Gase schon in ein Wassertröpflein, da wird der Raum, den sie gerade vorher gebraucht haben, zum größten Teil luftleer. Und in diesen luftleeren Raum stürzen sich die Luftwellen zurück. Die in der Dauer eines Augenblicks hin- und herschwingenden Luftwellen schlagen an die Trommelfelle in den Ohren der Menschen und Tiere. Das ist der Knall, den wir dabei hören.« – »Da geh' nur geschwind in die Küche damit und laß es draußen krachen, sonst weckst du mir den Rudi auf,« mahnte die Mutter; »'s Kind könnt' vor Schreck die Fraisen kriegen.«
Nun übersiedelte Koja mit seinen Apparaten in die Küche: Agi, die ihm half, faßte die Woulf'sche Flasche an, ließ aber gleich wieder los. »Die ist ja brennheiß, das Wasser war doch kalt, die Säure war kalt, das Eisen war kalt. Wie kommt das?« »Das sind so die chemischen Ereignisse,« erklärte Koja eifrig. »Der Sauerstoff hat das Eisen an sich gerissen und bei der Vereinigung ist Wärme frei geworden.« – »Was ist denn eigentlich Wärme?« fragte Agi nachdenklich. – »Ja, das wissen wir noch nicht genau,« gab Koja kleinlaut zurück. »Aber jetzt will ich zunächst einen Teil des Rezipienten mit gewöhnlicher Luft füllen.« »Wie willst denn das anstellen, wenn du hineinbläst, kriegst du ja Kohlensäure hinein.« So Agi. – »Das mach' ich mit der Woulf'schen Flasche. Schau nur zu.« Rasch leerte er die Flasche aus, reinigte und verkorkte sie wieder wie früher. »Was glaubst, Agi, ist die Flasche jetzt leer?« »Natürlich, du sie ja ausgeleert.« »So, du wirst sehen, daß sie nicht leer ist.« Er streifte den Rezipienten aus und rollte ihn so dicht als möglich zusammen. »Der ist jetzt wirklich leer.« Dann schloß er ihn mittels des Kautschukrohres wieder ans Gasausführungsrohr an. Hierauf goß er durch den Trichter reines Wasser in die Flasche. Während es beim Steigen den Raum über sich verkleinerte, begann sich die Schweinsblase aufzurollen und zu blähen. »Was sagst du jetzt Agi? – War die Flasche leer? Kann das Wasser ein Nichts hinübertreiben in den Rezipienten?« – »Ich verstehe: Was da jetzt hinübergetrieben wird, das ist die Luft, die über dem Wasser in der Flasche war.« – »Ja die Luft und in ihr der Sauerstoff, den ich fürs Knallgas brauch'.« Kaum war das Wasser bis zum Halse gestiegen, quetschte Koja den Schlauch und nahm den Rezipienten ab. »Was kommt jetzt?« fragte Agi im Eifer, dem Bruder zu helfen. – Wir beschicken die Woulf'sche Flasche wieder mit Eisen und verdünnter Schwefelsäure, wir wollen ja den Sauerstoff mit doppelt soviel Wasserstoff mengen.« Da spülte Agi die bereits gebrauchten Feilspäne rein, tat sie in die Flasche und griff nach dem Schwefelsäurefläschchen. »Weg, weg damit, du Unglücksmädel! Was fällt dir ein, erst die Schwefelsäure hineinzugießen und dann das Wasser drauf.« – »Das dürfte sich wohl gleich bleiben, was früher hineinkommt und was dann, wenn's ohnehin gemischt wird. Ob ich erst den Kaffee in die Schale gebe und dann erst den Zucker oder umgekehrt, ist ja auch alles eins.« –. »Richtig, beim Kaffee kennst du dich aus. In der Chemie aber bist du noch nicht zu Haus; – hör' zu: Du hast bemerkt, daß das viele Wasser in der Flasche von den paar Tropfen Schwefelsäure siedend heiß geworden ist, obwohl die Tropfen der Säure nur nach und nach hineingekommen sind. Denk dir, die Schwefelsäure wäre zuerst in der Flasche. Was würde mit dem ersten Wassertropfen geschehen, der mit der Säure in Berührung käme? – Er würde sich sofort in überhitzten Wasserdampf verwandeln; der würde sich so plötzlich ausdehnen, daß er gar nicht Zeit hätte, erst durch das Gasableitungsrohr abzustreichen. Er würde ganz gewiß die Flasche mit einem Krach zerreißen, die Glasscherben würden auseinandergeworfen, uns ins Gesicht und auf die Hände. Die herumgeschleuderte Schwefelsäure würde uns vielleicht die Augen verätzen und Brandwunden machen, wohin nur ein Tropfen fiele.« – »Das ist ja gefährlich!« rief Agi entsetzt. – »Ob die chemischen Experimente gefährlich sind! – Aber nur, wenn einer dabei nicht scharf denkt. Der Wallentin sagt immer: ›Die Dummheit ist gefährlich, die Dummheit und die Gedankenlosigkeit.‹ – Wer nicht besonnen ist, der soll die Hände weglassen von chemischen Experimenten.« – Zaghaft füllte Agi Wasser ein. Dann goß sie ein paar Tropfen Schwefelsäure dazu. Erst als die Gasentwicklung im vollen Gange war, schloß Koja den Rezipienten an.
Heftig wallte und brodelte die Flüssigkeit, und der hinüberströmende Wasserstoff füllte den Rezipienten prall. Jetzt wurde der Rezipient durch Abquetschen des Schlauches verschlossen. und abgehoben. »Die Mutter muß auch dabei sein, wenn's knallt.« Agi holte die Mutter und zündete die Kerze an. Jetzt füllte Koja eine Seifenblase mit Knallgas. »Die taumelt ja in der Luft herum und schwebt nur langsam empor.« »Natürlich, sie ist ja nicht gar so leicht, wie ein Wasserstoffballönchen. Agi hielt die Kerzenflamme unter die Seifenblase.« Da gab es einen Knall, der klang so scharf und kurz wie ein Pistolenschuß. Die feurige Explosion der Knallgaskugel löschte die Kerzenflamme aus. Und wieder und wieder gelang der Versuch. Den letzten Rest des Knallgases trieb Koja in die Seifenwasserschale; da gab es wieder ein Häuflein Seifenblasen. Und als Koja sie entzündete, war der Krach so laut, wie ein Gewehrschuß. Rudi erwachte und fing zu weinen an. Da eilte die Mutter zu ihm, gab ihm die Brust und er war wieder zufrieden.
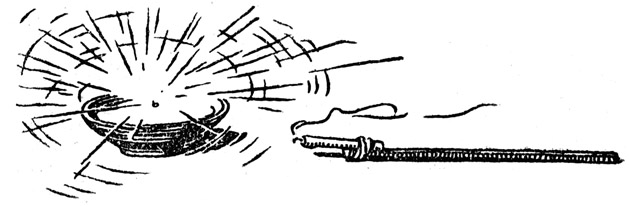
Beim Nachtmahl erging sich Koja in Ankündigungen herrlicher Versuche. Er wollte zeigen, wie eine Stricknadel im Sauerstoff mit Funkenstieben verbrennt, wie ein Stück Kaliummetall flammend und zischend auf dem Wasser herumfährt, als ob es närrisch wäre u. a. Gerne versprach ihm Agi, fürs nötige Geld zu sorgen. Koja plauderte fort von seiner lieben Chemie. Der Sauerstoff, der sich so gerne mit anderen Stoffen verband, war ihm ein Allerweltsfreund; Gold und Platin waren Eigenbrödler, die sich von allem Anfreundeln frei hielten. Es war ein fröhlicher Abend für alle. Mächtiger als alle Sorgen, die auf der Mutter und auf Agi lasteten, war ihre Freude darüber, daß Koja im Studium seine Lust fand. Da konnte alles nur gut gehen. Und dem schönen Abend folgten friedliche Tage voll stiller Arbeit und Zuversicht.
So wurde die Chemie, die um ihrer »trockenen« Formeln willen vielen jungen Leuten öde ist, für Koja, den Anschauungsbedürftigen, durch die Lust am Darstellen ein Vergnügen, an dem Mutter und Schwester redlich teilnahmen. Sie halfen ihm sich freuen.