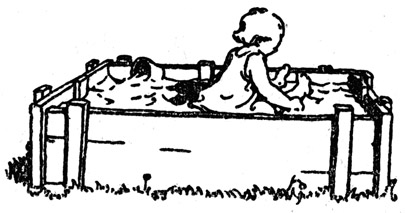|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Agi war mit Seraphinens Aussteuer fertig, aber es fand sich für sie neue Arbeit bei der Verwalterin. Die hatte ihren Vorrat an alten, wenig gebrauchten Kleidern gemustert und vieles Altmodische gefunden, das nur der Änderung bedurfte, um der Tochter als neu zu dienen. Was für Seraphine nicht mehr gut genug schien, bekam Agi; mochte sie daraus etwas für sich oder ihre Mutter zurecht schneidern. Beim Modernisieren der Kleider lernte die von Natur aus mit Formensinn begabte Näherin so viel zu, daß sie sich nun auch die Anfertigung neuer Kleider zutraute. Aus der Weißnäherin war eine Frauenschneiderin geworden, wenn sie auch noch keinen Lehrbrief hatte. Keine Bestellung wies sie zurück und mit jedem neuen Stück, das sie fertigte, legte sie sich eine neue Prüfung ab, daß ihr Können zunahm. Agis Frohsinn teilte sich der Mutter mit, die, besser genährt und durch ruhigeren Schlaf gekräftigt, sich sichtlich erholte. Beide hatten das Gefühl der Sicherheit, daß sie nimmer zugrunde gingen, wenn auch der Vater versagte. Nur eines machte ihnen Kummer: Rudi, den sie bisher für ein zwar ungewöhnlich zartes, stilles, aber doch für ein gesundes Kind gehalten hatten, zeigte jetzt unverkennbare Anzeichen der »englischen« Krankheit Rachitis, eine Knochenweichheit infolge ungenügender und unrichtiger Ernährung.. Seine Hand- und Fußgelenke waren weich geblieben; die Beinchen bogen sich nach außen. Seine Versuche, sich im Bettchen aufzurichten, fielen kläglich aus. Und wenn die Mutter ihm auf dem Fußboden zum Stehen verhelfen wollte, sank er in sich zusammen und kroch dann auf allen Vieren, ohne sich an Tischbeinen aufzurichten, wie es sonst die Kinder zu tun pflegen. Er legte sich eine eigene Art der Fortbewegung zurecht: sitzend schob er sich mit Hilfe der Arme weiter und lallte dabei noch immer seine unverständliche Eigensprache, in die sich nur selten die schwer erkennbare Nachahmung eines gehörten Wortes mischte. Es schien, daß er nicht nur körperlich, sondern auch geistig zurückblieb. Agi befragte den Bahnarzt; der riet zu einer kräftigen Ernährung des Kindes, nahm aber die Sache nicht sehr ernst. Agi tröstete die Mutter, so gut sie konnte, aber sich selbst machte sie ernste Sorgen, daß ihr Brüderchen zeitlebens an den Folgen der Unterernährung während seiner ersten Lebenszeit leiden möchte. Der Gedanke war ihr furchtbar, daß dieses liebe Kind büßen sollte, wo es nicht gefehlt hatte. Sie bat in ihrem Briefe den Bruder, er möchte ihr in einer Buchhandlung eine Schrift über Kinderpflege besorgen; es mußte doch Mittel geben, dem Fortschreiten der Verkümmerung vorzubeugen.
Bald darauf kam von Koja ein Schreiben:
»Liebe Agi!
Deinen Brief, in dem Du von Rudis Krankheit schreibst, habe ich dem Willy für seine Mutter mitgegeben. Ich habe nur auf ihren guten Rat gehofft. Sie aber hat mir schon bei meinem nächsten Kommen ein dreifingerdickes Buch gegeben, für das ich mit Willy an vier Sonntagen nacheinander je eine Stunde lang Latein treiben soll. O wie gern! Es ist Dr. Bocks Buch »Vom gesunden und kranken Menschen«. Verlag: Union Stuttgart. Es hat viele farbige und schwarze Bilder vom Bau des menschlichen Leibes und genaue Anweisungen darüber, wie man leben soll, um gesund zu bleiben und wie man Kranke pflegen soll, damit sie gesund werden. Agi! es ist ein herrliches Buch! Ich habe schon angefangen, mir davon einen Auszug mit Skizzen zu machen. In einer Woche ist Semesterschluß, da fahre ich auf drei Tage zu Euch und bringe Dir's mit. Es soll Dein sein. Für mich habe ich das »Kräutterbuechlein« des Apollinaris bekommen, wenn ich einmal Arzt auf dem Lande bin, will ich mir im Garten viele Arzneipflanzen anbauen.
Stell' Dir vor, was bei uns geschehen ist: Du weißt, daß in dem Zimmer, wo ich schlafe, Aquarien und Terrarien mit Fischen, Molchen und Schlangen sind, was mir bisher unsagbare Freude gemacht hat. Nun hat gestern abend die Frau Schuster in der anstoßenden Küche gebügelt und die Türe war offen, weil mein Zimmer nur von der Küche aus erwärmt wird. Und ich hab' bei der Küchenlampe meine mathematische Hausarbeit geschrieben. Auf einmal schreit die Frau Schuster auf, das Bügeleisen fällt auf den Boden und der glühende Stahl rollt aufs Klinkerpflaster. Eine Hornviper hatte sich im Fuße der Frau festgebissen. Ohne zu zögern, packt sie die Schlange mit der Kohlenzange beim Genick und gibt sie mir zum Halten; dann stößt sie die Spitze des Schürhakens ins Ohr des Bügelstahls und drückt ihn mit der Kante auf die Bißwunde, daß es zischt und raucht. Sie hat sich die Lippen blutig gebissen, aber geschrien hat sie nicht mehr. Dann hat sie die Rumflasche aus dem Kasten geholt und hat daraus so viel getrunken, daß ich gemeint hab', sie müßt' einen Rausch bekommen. Aber ganz besonnen und ruhig hat sie das wertvolle Tier selber ins Terrarium zurückgebracht und das Drahtgitter mit einer Glastafel gedeckt, weil es an einer Stelle durchgerostet war. Ihr Mann gibt sich die Schuld an dem Unglück; er hat nämlich die schadhafte Stelle im Gitter bei der Fütterung übersehen; aber er kann doch nichts dafür, weil er schon schlecht sieht. Und er hat mich um den Arzt geschickt. Der hat nur die Brandwunde mit einem Gemenge von Leinöl und Kalkwasser betupft und verbunden, und hat die Frau gelobt, daß sie gleich den Alkohol als inneres Gegengift angewandt hat.
Ich habe die Geschichte in mein Tagebuch eingeschrieben unter dem Titel: Geistesgegenwart einer Frau.
In Feuchterslebens »Diätetik der Seele«, Reklam-Bändchen zur Selbsterziehung. die du mir gegeben hast, hab' ich wieder einmal gelesen und darin einen wichtigen Gedanken gefunden, den ich im Tagebuch festgelegt habe: »Wenn nach Jean Paul die Heiterkeit der Seele der Himmel ist, unter dem alles gedeiht, so ist die Verbitterung des Gemütes die tiefste Grundwurzel zum Bösen.« Dieser Satz hat mir für die Beurteilung unserer Mutter einen neuen Gesichtspunkt gegeben. Denk' zurück an die traurigen Zeiten, wo wir unseren ersten Besitz verloren haben und dann an die Zeit, wo wir aus unserem Optimum, unserem Besten, wegziehen mußten, aus dem Mühlhof am Bach in der Neuda inmitten des Gartens, der Wiesen und Auen, denk' zurück an unseren traurigen Auszug aus dem lieben Prokop-Haus, an unser Elend in Wien – hat sich die Mutter verbittern lassen? Hat sie uns Kinder den Sonnenschein ihrer Herzlichkeit, ihres Frohsinns entbehren lassen? Und Du, liebe Agi, bist der Mutter gleich an sonniger Liebe zu uns allen. Ihr seid mir zwei Heilige des schaffenden und rettenden Frohsinns. Eure Photographien, die noch aus der glücklichen Neuda-Zeit stammen, habe ich über mein Bett gehängt; und wenn ich sie morgens nach dem Erwachen und abends vor dem Einschlafen betrachte, macht mir die lebhafte Erinnerung an Euch Mut. Auf ein baldiges Wiedersehen freut sich Euer
Koja.«
Mitten im Februar, als nach kurzem Tauwetter andauernder Frost die Wege hart und die Luft klarsichtig gemacht hatte, verbrachte Koja die drei Tage der Semesterferien bei seinen Leuten in Mannersdorf. Agi vertiefte sich schon am ersten Abend nach seiner Ankunft ins Studium des Bock-Buches und legte sich die Mittel zurecht, mit denen sie der »englischen« Krankheit beikommen wollte: Heublumen- oder Thymianbäder, Salzwasserbäder, sehr viel Milch zu den Mahlzeiten und wann möglich viel rohes Obst. Und in der schönen Jahreszeit das Krabbeln im sonndurchwärmten Sande. Oh, wie sehnte sie den Sommer herbei! Ein paar Scheibtruhen voll Sand wollte sie im Hofe aufhäufen, da sollte Rudi seine Sandbäder nehmen. Und die Hoffnung gab ihr frohen Mut, als sei das Übel schon behoben.
Am nächsten Morgen ließ sie Koja einen Anzug probieren, den sie für ihn schon vorgeschnitten und geheftet hatte. Um ungestört daran arbeiten zu können, mahnte sie den Bruder zu einer Wanderung; er sollte das Leithagebirge kennen lernen. Imbiß, Hammer und Meißel im Ränzel, brach er auf. Wandernd und sammelnd machte er verblüffende Entdeckungen. Auf der Bergeshöhe, von der aus er den Blick ungehemmt bis zum schimmernden Bande der Donau und zum Häusermeer Wiens schweifen ließ, erklirrte unter seinem Fuß die Schale einer riesenhaften breitrippigen Pilgermuschel. Und in einer Einsattelung des Kalkbodens ragte eine tischgroße Kuppe von Glimmerschiefer mit verblaßtem Rosenquarz aus dem kahlen Geranke von Brombeeren. – Rosenquarz! Da guckte also der Urgesteinsboden unterm Kalk hervor, den das Tertiär-Meer aufgelagert hatte! Alle Zwischenschichten fehlten! Im Osten erblickte Koja eine Burgruine, im Tale unter ihr das brandgeschwärzte Gemäuer einer Klosterkirche und einiger Nebengebäude, die eingeäschert und nie mehr aufgebaut worden waren. Der Waldheger, dem er begegnete, nannte die Burg »Scharfeneck« und die zerstörte Siedlung darunter die »Wüste«. Er konnte aber nicht sagen, ob die Verheerung von Türken oder Magyaren herrührte. Nach zweistündiger Wanderung durch den Wald, wo Koja mehrmals die Freude hatte, Rehwild zu beobachten, langte er just beim Mittagläuten wieder in Wannersdorf an.
Nach Tisch mußte Koja zu den Verwaltersleuten, um Agi zu entschuldigen, daß sie nicht kommen konnte, weil sie für ihn nähte. Und Koja machte Eindruck. Er hatte seine Laute mitgebracht. Er sang und spielte mit einer Unbefangenheit, als wäre er da längst daheim. Seraphine, für die Koja als Bruder Agis kein Fremder war, sang mit und der Frohsinn bemächtigte sich des ganzen Hauses. Spätnachmittags kam Agi nach und nahm ihre Arbeit auf. Sie sang dabei fröhlich mit den Fröhlichen.
Als die Reihe der lustigen Studenten- und Volkslieder erschöpft war, nicht aber die Sangeslust, schlug die Stimmung um. Es kam das ernste Lied daran: »Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum …« Die Braut war es, die aus einem ihr selbst unverständlichen Bedürfnis heraus das traurige Lied angestimmt hatte. Aber die leuchtenden Augen der Glücklichen wurden nicht feucht, während sie vom Leide sang, das ihr so ferne lag. Sie merkte nicht, daß Agi neben ihr verstummt war. Unbeirrt verlangte sie das Lied »In einem kühlen Grunde … " und als es verklungen war, begann sie Feuchterslebens Lied zu singen: »Es ist bestimmt in Gottes Rat, daß man, was man am liebsten hat, muß meiden, muß meiden.« Sie sang es mit leichter Rührseligkeit. Agi aber schwieg und neigte sich tief über die Näherei. Ohne in ihrem Singen inne zu halten, griff ihr Seraphine unter das Kinn und hob ihr Gesicht empor. Sie sah große Tränen niederperlen über die Wangen der Freundin. Erschrocken schlang sie den Arm um ihren Nacken und drang flehend auf sie ein: »Agi, was ist dir, Agi, was hast du, sag's, geh', sag' mir's doch –« – Kojas Händen war die Laute entglitten, forschend senkten sich seine Blicke in die Augen der Schwester. Sie aber schüttelte den Kopf. »Nichts hab' ich, was sollt' ich denn haben. Nur das Lied ist so traurig. Feuchtersleben muß es geschrieben haben, als er jemand ihm so recht Lieben hatte meiden müssen.« Und sie bestand darauf, daß das unterbrochene Lied zu Ende gesungen wurde bis zum tröstlichen »Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen!« –

Beim Abendmahl merkte Koja nicht, daß er für zwei Gäste aus Wien, den Baumeister Zierlechner und seine Frau, der Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit war. Um so angenehmer war er überrascht, als ihm der Baumeister beim Weggehen seine Adreßkarte gab und ihn fragte, ob er als Hauslehrer seiner zwei Mädeln und zwei Buben zu ihm siedeln wollte. Als Anfangszahlung bot er ihm zu Wohnung und Verköstigung dreißig Gulden monatlich. Koja sagte vorschnell zu; ohne erst zu fragen, was alles von ihm verlangt werde. Auf dem Heimweg fragte Agi den Bruder: »Was sagst du zum neuen Schritte vorwärts? Bist du nicht ein Glückspilz?« – »Was ich dazu sage? Ein Glückspilz bin ich, weil ich dein Bruder bin. Daß ich diesen Schritt vorwärts nicht täte, wenn du nicht Liebkind wärst bei den Verwaltersleuten, ist sicher.«
Noch eine Nacht opferte Agi, um den Anzug für Koja fertig zu bringen, in dem er nach Wien fuhr mit dem Hochgefühl eines Menschen, der sich zu den besseren Leuten zählt, weil er in einem neuen, gutsitzenden Anzug steckt. Was sein Selbstgefühl noch mehr hob, waren zwei Silbergulden, die ihm Agi mit einem Zettel in den rechten Hosensack gesteckt hatte: »So oft Dich die Versuchung anwandelt, diese zwei Gulden auf eine Nichtigkeit auszugeben, widersteh'; denk' Dir, die Agi hat's schwer verdient. – Wenn Du aber etwas findest, das Dir vorwärts helfen kann, dann kauf's.«
Zwei Wochen später nahm Koja Abschied vom Präparator Schuster und seiner Frau, die ihn nur ungern ziehen ließen. Der alte Mann gab ihm zum Andenken zwei schadhafte Schädel, die aber für Koja unschätzbaren Wert hatten. Es war ein mehrfach geflickter Gipsabguß eines Orangschädels und ein abgegriffener Menschenschädel mit abgesägtem Schädeldach. Der Schädel stammte aus der Hinterlassenschaft eines Arztes, dem er einst beim Anatomiestudium gedient hatte. Als Koja bei den Zierlechnerischen sein Zimmer bezog, belegte er den Aufbau des altmodischen Schreibtisches mit seiner kleinen, sorgfältig etikettierten Schädelsammlung, so daß seine Blicke von einem Stück zum andern gehen konnten. Es waren für ihn lauter redende Dinge; denn das vergleichende Schauen löste in ihm immer Betrachtungen aus. Als am ersten Abend das Ehepaar Zierlechner und die vier Kinder den Schreibtischschmuck ihres Studenten bestaunten, entwickelte er eine frohe Beredsamkeit über die Zusammenhänge zwischen Lebensform und Lebensgebrauch. Hier die meißeligen Schneidezähne der kleinen Nager, dort die krummdolchigen Fangzähne der berufsmäßigen Mörder. Hier das vom Zug der gewaltigen Beißmuskeln förmlich gedrückte Schädeldach des Orang, dort das fast glatte, hochgewölbte Schädeldach des Menschen, in dessen Gebiß die Fangzähne verkümmert sind. Als die Hausfrau, die Kojas Ausführungen mit wachsender Bewunderung gelauscht hatte, ihn fragte: »Studieren Sie 'leicht auf einen Doktor, Herr Koja?« gab er mit Überzeugung zurück: »Ja, gnädige Frau, auf den Doctor medicinae.«
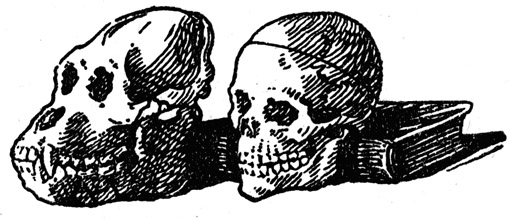
Durch seine Übersiedlung ins Haus des Baumeisters verwandelte sich Kojas Lebenslage mit einem Schlag ins Günstige. Sein teppichbelegtes Wohnzimmer mit dem wohlgepflegten Stubengerät aus der Biedermeierzeit bekam in aller Morgenfrühe das volle Licht der aufgehenden Sonne, so daß Koja wach wurde und aufstand, um noch vor dem Frühstück zu studieren.
Agis Postsendung, die einen Tag vor Kojas Einzug bei den Zierlechnerischen eingetroffen war, enthielt diesmal nicht Brot noch Geld, sondern einen bewurzelten Ableger ihrer Passiflora, Passiflora, wegen der symbolischen Deutbarkeit ihrer Blütenteile auch »Leiden Christi« genannt. eine Fuchsie, ein Geranium und sechs Farnkrautpflanzen, deren Wedel noch eingerollt waren. Agis Brief begann mit einem Aphorismus Goethes: »Die Tätigkeit ist's, was den Menschen glücklich macht.« Und in der Nachschrift gab sie dem Bruder den Rat: »Halt' die Blumen feucht und schütz' ihre Töpfe vor dem Sonnenbrande. Am besten werden sie Dir gedeihen, wenn Du sie täglich beim Untergang und beim Aufgang der Sonne gießest.«
Rasch gewöhnte sich Koja an seine neue Art zu leben. Als Frühaufsteher erledigte er den Großteil seiner eigenen Lernarbeit vor dem Frühstück. Wenn er vom Nachmittagsunterricht heimkam, widmete er zwei Stunden den Kindern. Es war ihm ein Vergnügen, mit der sechsjährigen, flachsköpfigen Traudel und der neunjährigen, braunhaarigen, dunkeläugigen Regerl zu lernen. Nicht so leicht war's mit den Knaben. Der elfjährige, pausbackige Blondkopf Ferdi, der die erste Realklasse wegen eines Mißerfolges im Französischen wiederholte, war mit dem blassen, zehnjährigen Flori, der im Französischen tüchtig war, in derselben Klasse.
Die Schwierigkeit, welche niemand bedacht hatte, bestand für den Hauslehrer darin, daß er selbst nie Französisch betrieben hatte. Koja war in der Zwangslage, sich sobald als möglich in den neuen Gegenstand hineinzuarbeiten, wenn er mit seinen Schülern aufmerksam wiederholte, was sie in der Schule gelernt hatten, und dann heimlich nach- und vorlernte, mußte er doch in wenig Tagen so weit kommen, um sie richtig zum Lernen anzuhalten. Für den Anfang galt es, die Kenntnisse des tüchtigen Flori seinen eigenen und denen Ferdis dienstbar zu machen. Er ließ von Flori die letzten Musterstücke aus dem Französischen ins Deutsche übertragen, wobei er selbst mit höchster Aufmerksamkeit feststellte, daß die meisten französischen Wörter sich wie verballhorntes Latein ausnahmen. Mit der sonderbaren Aussprache mußte er sich erst befreunden. In steigendem Vergnügen stellte er für sich die erkennbaren Wortverwandtschaften fest, um für die Rückübersetzung Anhaltspunkte zu haben. Nach Durchnahme der Vokabeln und des betreffenden Grammatikteiles überließ er es Flori, die neue schriftliche Aufgabe selbständig anzufertigen, während er mit Ferdi die drei alten Stücke, die er soeben gehört hatte, wiederholte. Dann mußte Flori dem Bruder das Neue vorübersetzen. Zur Verbesserung des Entwurfes bediente sich Koja unbemerkt der Arbeit des Flori. Ferdi zulieb nahm er im Lauf der nächsten Tage eine lückenlose Wiederholung des Lernstoffes von der ersten Seite des Lehrbuches an vor. Unter dem Vorwande, für die Knaben aus dem alten Lernstoff Diktate zusammenzustellen, entlieh er sich von ihnen das Lehrbuch und das Toussaint-Langenscheidtsche Wörterbüchlein, wo jedem Worte die Aussprache beigefügt war. Damit zog er sich meist nach dem Abendmahl auf seine Stube zurück und schob den Riegel vor, um ungestört zu sein. Sein Versuch, mit Hilfe des Wörterbuches die ersten Lesestücke zu übersetzen, mißlang. Die wechselnden Zeitwortformen ließen sich im Wörterbuche nicht nachschlagen. Dieses Hindernis mußte also vor allem genommen werden. Zu den wichtigsten im französischen Lehrbuch abgewandelten Zeitwörtern suchte er sich in der lateinischen Grammatik die Grundformen auf und achtete stets vergleichend auf die Abweichungen der französischen Formen von den lateinischen. Er legte sich eine Sammlung der verwandten Wörter an. Beim Lernen mit den Kindern bestand er auf einem wörtlichen Einprägen der französischen Musterstücke, die er dann deutsch diktierte und französisch niederschreiben ließ. Erst, als er sich selbst sicher fühlte, zerlegte er jedes Stück in Fragen und Antworten. Das waren für ihn selbst höchst förderliche Sprechübungen. Das Beispiel Agis vor Augen, machte er im Französischen Fortschritte, wie diese im Kleidernähen vorwärts gekommen war, und bald war er seinen Zöglingen weit voraus.
Eines Tages stand er unvermutet vor der Buchhandlung der Bibelgesellschaft am Opernring. Da sah er aufgeschlagen im Schaufenster das Neue Testament in allen Sprachen, von denen er wußte, und in vielen, von denen er keine Ahnung hatte. Er versuchte, durchs Fenster ein paar Sätze der griechischen, dann der französischen und lateinischen Ausgabe zu lesen. Wie leicht das ging! Wie ein Blitz der Erleuchtung fuhr ihm der Gedanke durchs Hirn: Denselben Bibelvers deutsch lesen, dann lateinisch, dann französisch! Gab es eine leichtere Art Sprachvergleichung zu treiben? War das nicht ein Mittel, sich einzulesen in die fremde Sprache, ohne durchs Vokabelsuchen aufgehalten zu sein? War das nicht die beste Gelegenheit, die Zeitwortformen durch Beobachtung sich anzueignen? – Agis Worte kamen ihm in den Sinn: »Wenn du etwas findest, das dir vorwärts hilft, kauf's!« – Entschlossen trat er ein. Und es genügten dreimal fünfzig Kreuzer, das Neue Testament in Deutsch, Latein und französisch zu erwerben, von diesem Tag an wuchs seine Sammlung verwandter Wörter Tag für Tag um Hunderte. Und in sein Wesen kam ein zielstrebiger Ernst; denn er begann auch über den Inhalt des Gelesenen zu grübeln. Dies kam auch in seinem Tagebuch zum Ausdruck, in das er manchen Satz als Lesefrucht eintrug, den er als fliegendes Wort gekannt hatte, ohne zu wissen, woher er stammte. Solange der Winter anhielt, verbrachte Koja mit den Kindern jeden Sonntagvormittag im Naturhistorischen Museum.
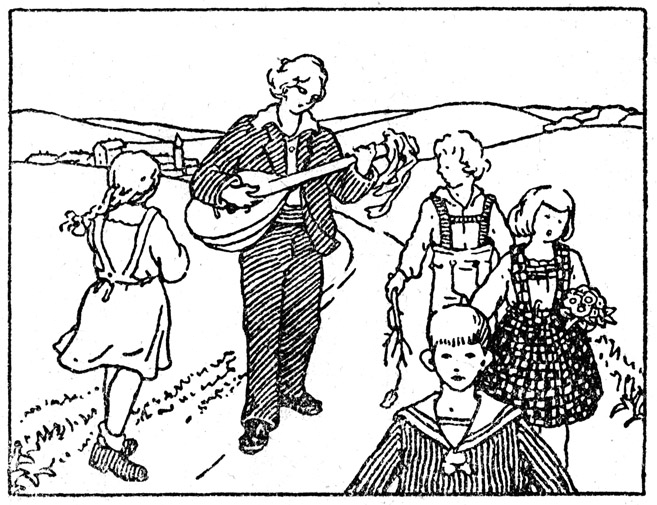
Aber mit dem Erwachen des Frühlings begannen die Wanderungen in den ergrünenden Wiener Wald. Koja spielte zum Gesang der Kinder die Laute und half so auch der kleinen Traudel über die Müdigkeit hinweg. Vorüber ging's an den Buchenhängen des Schottenwaldes. Sein Boden prangte im Schmucke der blauen Leberblümchen und der gelben Sträuße der Schlüsselblumen, die von Zitronenfaltern, Tagpfauenaugen, Hummeln und Bienen Besuche empfingen. Im Gebüsch des Halterbach-Ufers leuchteten weiß und zartrosig die Lerchensporne. Im Föhrenbestande, durch den der Pfad zur Riegler-Hütte führte, dufteten die roten Blütenschöpfe des Seidelbastes. Und wenn zur Mittagszeit die Höhe der Sophien-Alm erklommen war, trug der Wind den hungrigen Wanderern aus der Küche die gemischten Gerüche von gebackenen Schnitzeln, Rostbraten und Selchfleisch entgegen. Von der Mutter der Kinder reichlich mit Zehrgeld ausgestattet, konnte Koja auftischen lassen, wonach es die Kinder und ihn gelüstete.
Und ein Spaßmacher trieb sich bettelnd zwischen den mit schwatzenden und lachenden Gästen reich besetzten Tischen herum. Es war des Wirtes grauzottig behaarter, allbeliebter Esel, der auf den Namen Peter hörte und mit freudigem I – aa! I – aa! für jeden Wecken, für jedes Stück Brot dankte. Zeigte ihm jemand eine Zigarre und forderte ihn auf: »Schön bitten, Peter!«, so schlug er mit dem rechten Vorderhuf so lange gegen den Boden, bis man ihm das gewickelte Tabakheu ins Maul steckte, das dem Grautier ein ganz besonderer Leckerbissen war. Wenn aber ein boshafter Spender ihm eine glimmende Zigarre gab, antwortete der Esel mit Pusten und Schnauben, schüttelte die langen Ohren, ja, nicht selten rächte er sich, indem er dem witzigen Herrn ins Bier nieste. Und damit hatte er die Lacher auf seiner Seite.
Als die warme Zeit kam, geschah es nicht selten, daß Herr Zierlechner, der bei seiner Beleibtheit kein Freund von Märschen war, in aller Frühe den Landauer anspannen ließ (den die Kinder scherzhaft die »Arche Noah« nannten), um selbst mit seiner Frau an den Freuden der Jugend im Prater und in der alten Donau teil zu haben. – Die Grottenbahn im Prater mit ihrem unterirdischen Märchenreich von Zwergen, Drachen und Kristallhöhlen, die Schwarzkünstlerbude Kratky-Baschiks, das Ringelspiel mit lebendigen Ponys, die Kahnfahrten auf der alten Donau, das Baden in der seichten Bucht einer Au-Insel, das Lagern auf sonndurchwärmtem Wellensande und schließlich ein reichliches Fischessen im Wirtshaus zum Nordpol, das waren die Vergnügungen, die für jung und alt die Sonntage zu hellen Freudentagen machten.
Kojas ausführliche Plauderbriefe gaben Agi und Mutter begründete Anlässe zum Mitfreuen. War doch ihr Koja schon in seiner Gymnasialzeit das, was für unbemittelte Hochschüler begehrenswert war: ein Hofmeister, und noch dazu einer, dem's gut ging, weil er sich bewährte. Und weil Agis Einnahmen durch ihre Geschicklichkeit im Kleidernähen unerwartet zugenommen hatten, mietete sie bei der verwitweten Aggsbacher Sali eine freundliche Wohnung, die, im Halbstock des Bauernhauses gelegen, licht, sonnig und trocken war. Von der Küche aus sah man in den Hof hinunter, der von Hühnern, Enten und Gänsen wimmelte. Vier festgekeilte Bretter umgaben einen Sandhaufen, der, von der Sonne durchwärmt, Rudis Spielplatz geworden war. Hier krabbelte er herum, wühlte Gruben und Höhlen aus, häufte Hügelchen auf und plauderte in seinem Kauderwelsch mit sich selbst, waren es die Sandbäder, die Thymian- oder Salzbäder, war es der reichliche Milchgenuß, oder alles zusammen, Rudi erstarkte zusehends, aber seine Beinchen waren nach außen gekrümmt. Da entschloß sich Agi zu einer Gewaltkur. Sie lieh sich von der alten Sali Dachschindeln aus, wickelte jeden Abend Rudis Unterschenkel in Watte und Tücher und legte je drei Schindel als Schienen daran, welche, festgeschnürt, die noch weichen Knochen geradbiegen sollten. Und jeden Morgen, wenn sie die Schienung abnahm, glaubte sie, schon einen Erfolg wahrzunehmen. Die Mutter lächelte dazu: »So geschwind geht das nicht, aber mit der Zeit wird's werden. Es bleibt den Knochen nichts anderes übrig, als sich dem Zwange zu fügen.« Im Fenstergärtchen hatte die Passiflora reichlich Knospen angesetzt. Aus vielem Leide erblühten der guten Agi ihre Freuden, die an tiefer Innigkeit und Reinheit die Freuden ihrer Altersgenossinnen weit übertrafen.