
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Vom Anbeginn aller Dinge her zieht in der breiten Schar der Lebenden ein Wesen dahin, so absonderlich in allem, daß die schreckhafte Phantasie der Menschheit Seltsamres und Gewaltigeres zugleich niemals erdacht hat. Nichts hat gelebt und nichts lebt heute, was sich an Kraft und Größe mit ihm vergleichen ließe. So lang fast, wie das Niederwalddenkmal hoch ist, an Gewicht einer Herde von fünfzig Elefanten oder zweihundert Rindern gleich, mit einem Rachen, so weit, daß ein kleines Boot bequem darin Platz fände. Wenn es atmet, keucht es stundenweit hörbar und gellend wie aus dem Eisenleib einer Lokomotive, und einer Fontäne vergleichbar sprüht dampfend die Atemluft empor. Das ist der Wal, der Wal fisch, wie naives Schauen dieses Riesengeschlecht von Meeressäugern genannt hat und immer wieder nennt.
Schon das ist wie ein Wunder, daß der Wal wirklich ein Säugetier und nicht ein Fisch ist. Aber sein Körperbau und die Art der Fortpflanzung läßt darüber keinen Zweifel. Die Walmutter bringt in gewissen Zeitabständen (beim Riesenwal etwa jedes zweite Jahr) ein lebendiges, bei der Geburt schon auffällig großes Junges zur Welt und säugt es wie eine Kuh ihr Kalb. Die Brusthöhle des Wals füllt eine riesige Säugetierlunge, die dem Tiere gestattet, soviel Luft einzuatmen, daß es eine Stunde und selbst länger unter Wasser zu bleiben vermag; ein vierkammeriges Säugetierherz pumpt das warme Blut durch den Leib. Betrachten wir den Bau der Vorderflosse näher, so sehen wir, daß sie nichts andres ist als eine dem Leben im Wasser angepaßte, für die Aufgabe des Schwimmens umgestaltete Säugetier-Vordergliedmaße mit Ober- und Unterarm, Handwurzel-, Mittelhand- und Fingerknochen, alle freilich stark verkürzt und verbreitert und durch derbe Muskel- und Bandmassen zu einer starren Ruderplatte nach Fischflossenart verbunden. Die Hintergliedmaßen sind zwar äußerlich völlig verschwunden, aber im Fleisch des Hinterleibes sind ihre Reste als kleine Knochen noch deutlich erkennbar. Kurzum – es kann gar nicht zweifelhaft sein, daß der Wal ein Säugetier ist, das allerdings schon in grauen Urzeittagen wieder ins Meer hinabstieg und darin für alle Zeiten nun verblieb.
Solch ein Riesentier hat ja auch nur Platz im Meere, und so hat sich der Körper des Wals dem Leben im Wasser allmählich in jeder Hinsicht aufs trefflichste angepaßt. Das Haarkleid, das er vermutlich einmal besaß, ist bis auf einige borstenartige, wie Glas splitternde Tasthaare am Kopfe, verschwunden. Dafür hat der Wal sich als Wärmeschutz eine den ganzen Körper umhüllende bis halbmeterdicke Speckschicht zugelegt. Diese Speckschicht dient zugleich als eine Art von Schwimmgürtel – Fett schwimmt ja oben, wie man zu sagen pflegt – und verhindert endlich, daß der in großen Meerestiefen herrschende, ungeheure Wasserdruck den Leib des Wales bei schnellem Tauchen zusammenpressend zertrümmere. Ins Gigantische sich streckend, hat der ungegliederte Leib Spindelform angenommen, wie unsre Technik sie den Rennern des Luftmeeres und des Ozeans, dem Zeppelin und dem Torpedoboote, gegeben hat. Gleich einer seidenen Ballonhülle umschließt ihn eine dünne, glatte, weiche Haut. Ohne sichtbaren Hals geht der unförmliche Kopf in den Rumpf über. Die Augen, so groß nur wie eine Billardkugel, aber auch so hart, daß ein Beilhieb sie kaum spaltet, liegen wie in einer Mulde dicht hinter den Mundwinkeln. Die Ohren dahinter sind nur ein Schlitz, ohne Ohrmuscheln, eine winzige, kaum auffindbare Grube. Der Wal hört wie der Maulwurf mit dem ganzen Körper, und das so scharf, daß er selbst das Eintauchen eines Ruders in das Wasser bemerken soll. Hoch oben auf dem Kopfe, man möchte sagen: auf dem Scheitel, öffnet sich, einen kleinen Hügel vorwölbend, das doppelte, schlitzförmige Atemloch der Nase; es ist durch Klappen vollendet wasserdicht verschließbar und wird von dem ruhig schwimmenden Tier meist über Wasser gehalten. Die Nase ist nämlich beim Wale nicht mehr Riechorgan, sondern dient ausschließlich der Atmung. Durch sie bläst der Wal die verbrauchte Atemluft mit hörbarem Schnaufen und Zischen empor, daß sie wie eine Fontäne aufschießt: kleine Wasserteilchen werden mit hoch gewirbelt und, wie an Wintertagen unser Atem sich zu Wasserdampf ballt, wird die blutwarme Atemluft wie ein Springbrunnen, oft viele Meter hoch, sichtbar. Das Maul ist weitgespalten, abgrundtief; am Boden liegt die riesige, dicke, festgewachsene Zunge. Statt der Zähne haben die Bartenwale vom Gaumen Hunderte von Hornplatten herabhängen, eine dicht neben der andern, außen bis zu vier Meter lang, nach der Mitte zu immer kürzer werdend; sie sind am Innenrande zerschlissen, zerfasert, ausgefranst, diese »Barten«, die das »Fischbein« liefern, und stellen einen Seihapparat, eine Art von Haarsieb, ein Fischernetz dar. Tut der Wal das Maul auf, so strömen mit dem Wasser Myriaden kleinster Tierchen hinein; schließt er es wieder, so preßt die plumpe Zunge das Wasser hinaus, die Tierchen aber bleiben in den Bartenfransen hängen, werden von der Zunge daraus abgefegt, in den Rachen gedrückt und nun verschluckt. Durch das Maul, wie die Fische es tun, nimmt der Wal keine Luft (mit dem Wasser) auf; darum münden auch Kehlkopf und Luftröhre nicht wie sonst in die Mundhöhle, sondern steigen turmartig zur Nasenöffnung in die Höhe. Der Schlund ist so eng, daß nur ganz winzige Tierchen ihn passieren können. So besteht denn die Nahrung des Riesen tatsächlich in kleinen Krustern, Meerschnecken und andern Weichtieren. Der Grönlandwal nährt sich fast ausschließlich von einer kleinen Flügelschneckenart ( Cliône), die davon den Namen »Whalaat« (d. h. Walfraß) erhielt. Zur Stillung seines Hungers braucht ein großer Bartenwal Millionen und Milliarden dieser winzigen Geschöpfe. Zu Millionen und Milliarden bevölkert das Whalaat aber auch die arktischen Meere; erscheint doch nach den Berichten der Walfänger gelegentlich das Meer in einer Ausdehnung von 2 000 bis 3000 Quadratkilometer durch diese purpurnen Schnecken rot gefärbt! Nach hinten spitz zulaufend, endet der Leib in einer Schwanzflosse von sechs bis acht Meter Breite; im Gegensatz zu der der Fische steht diese muskelstarke »Finne« aber wagerecht. Wie die Flügelschraube eines Dampfers etwa, sich abwechselnd nach beiden Seiten drehend, treibt sie das Tier vorwärts: auf der Flucht soll der Riesenwal so über sieben Meter in der Sekunde zurücklegen. Durch Schläge nach oben oder nach unten läßt sie den kolossalen Leib wie ein Unterseeboot rasch in die Tiefe sinken oder hebt sie ihn zur Oberfläche empor. So gewaltig ist der Schlag der Schwanzflosse, daß er das riesige Tier im Spiel oft meterhoch aus dem Wasser schleudert, und daß der Wal mit einem Schlage ein Walfängerboot zu zertrümmern vermag. Zum Steuern benutzt der Wal die Brustflossen, indem er, wie der Ruderer im Boot das Ruder, die Flosse derjenigen Seite abspreizt, nach der er schwenken will. Eine kleine, kurz vor der Schwanzflosse nach oben abgehende, dreieckige Fettfinne ist in ihrer Wirkung dem sichernden Schiffskiele zu vergleichen.
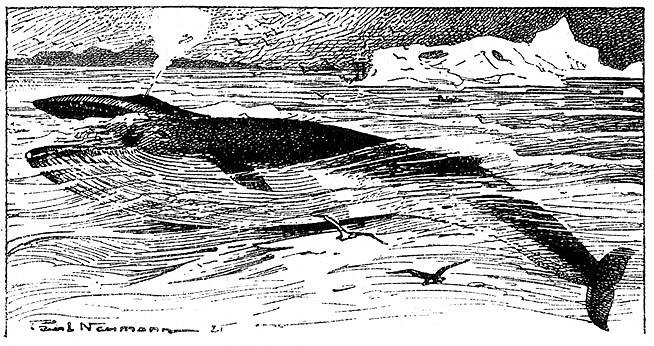
Finnwal
Die riesige Länge der großen Walarten – der Blau-, Schwefelbauch- oder Riesenwal ( Balaeno´ptera, mu?´sculus), den wir hier vornehmlich schildern, wird über 30 Meter lang und bis 3000 Zentner schwer – hat der Phantasie des Menschen immer dankbare Fabelstoffe geboten. Sindbad der Seefahrer, aus »Tausendundeiner Nacht«, erzählt, wie sein Schiff einst an einer Insel Anker warf, die »war keine Insel, sondern ein großer Fisch, der mitten im Meere stillstand. Und Sand war auf ihm angeschwemmt und Bäume waren drauf gewachsen«. Als nun die Mannschaft Feuer auf ihm entzündete, spürte der Wal die Hitze und tauchte unter: die Insel erbebte plötzlich und schoß mit allem, was sich darauf befand, in den Abgrund des Meeres. Schon Plinius, der »Vater der Naturgeschichte«, berichtet von dem Wale, er sei »vier Juchert« lang, und der Spötter Lukian erzählt in seinen »Wahren Geschichten« nach Art Münchhausens von einem Wale, der vollends 1500 Stadien, d. h. 37 Meilen, lang war. Der Wal verschlang das Schiff mit Mann und Maus wie jener biblische Wal den Propheten Jona. Die Reisenden landeten aber im Bauche des Wals an einer großen, dichtbewaldeten und reichbevölkerten Insel. Eines Tags setzten nun die Schiffbrüchigen einen Wald der Insel in Brand. Da verfiel der Wal in ein hitziges Fieber und starb nach zwölf Tagen. Die wundergläubige Naturgeschichte des Mittelalters hat solche Schilderungen, die wohl seit undenklichen Zeiten unter den Seeleuten von Mund zu Mund gingen und so aus dem Morgenlande in das Abendland gewandert waren, für bare Münze genommen, und der »deutsche Plinius«, im 16. Jahrhundert lebende »weitberümpte Herr Doctor Conrad Gesner«, wie er auf dem Titel seines »Tierbuchs« genannt wird, erzählt so vom »Tüffelwall« der »mit Sand besprengt« sei, und »auf welchem die Schiffsleut, der Meinung, es wären kleine Inseln, kochen, das Schiff daran geheftet haben, und also manchesmal in große Gefahren kommen«. Er weiß auch von andern Walen zu berichten, die lange Patriarchenbärte und wahre Klaviervirtuosenmähnen, Stirn- und Nasenhörner und vollends feurige Augen »von zwanzig Schuh Umfang« hätten!
Gewiß, etwas Wahres ist schon an diesem Schifferlatein. Auf dem Körper des Wales siedeln sich nicht selten allerhand Schmarotzer an, was aus der Ferne wohl wie ein Bart oder eine Mähne oder gar eine Art von Tangwald oder Rasen aussehen mag. Der Narwal trägt im Oberkiefer einen oder zwei bis drei Meter lange, wie ein Horn gewundene Stoßzähne. Der Delphin, der kleinste der Wale, und eine Zahnwalart ist wirklich musikliebend und zutraulich, wennschon er kaum, vom Spiel und Gesang Arions bezaubert, den Dichter auf seinem Rücken durch die Flut getragen haben dürfte und wohl auch nicht, wie Plinius uns überliefert hat, den ihm befreundeten Knaben täglich über den Lukrinischen See nach Puteoli zur Schule brachte. Nicht nur der Delphin, sondern fast alle Walarten halten sich gern in der Nähe großer Schiffe auf, begleiten sie oft tagelang. Bisweilen tummeln sie sich in ganzen »Schulen«, wie die Walfänger diese Herden von Hunderten von Walen nennen, die beim Pottwal unter Führung eines alten Männchens als »Schulmeisters« stehen, tauchen dann zu gleicher Zeit, blasen, wenden, springen, ganz so exakt wie die Mitglieder eines Schwimmklubs bei einer Übung. Von allen Beobachtern wird die große Liebe der Muttertiere zu ihren Jungen gerühmt: sie übertrifft, wie Eschricht sagt, fast alles, was wir sonst bei Tieren kennen. Die Wanderungen der Wale erfolgen fast so regelmäßig wie die der Zugvögel und führen die Tiere durch alle großen Meere.
Seit den ältesten Zeiten schon jagt der Mensch den Wal, der ihm in seinen Barten das Fischbein, in seinem Speck den Tran – beim Grönlandwal wird die Ausbeute an Tran und Fischbein für ein ausgewachsenes Tier auf rund 25 000 Mark geschätzt –, beim Pottwal ferner das Walrat zu Seifen und Salben und den Amber, ein Räuchermittel und zugleich eine Arznei, sowie die Zähne zu Knöpfen, Spielmarken und dergleichen liefert. Heut wird die Jagd mit Geschützen betrieben und Geschossen, die im Leib des Riesen explodieren. Ehedem gehörte zum Walfang großer Mut und ausdauernde Geduld. Die ersten Walfänger, die regelrechte Jagden veranstalteten, waren im 14. Jahrhundert die Basken. Ihnen folgten Holländer, Engländer und Amerikaner. Auch Friedrich der Große rüstete mehrmals Walfänger aus.
Solch eine Waljagd früherer Zeiten sei hier mit den Worten Meisters Johann Dietz, Feldschers des großen Kurfürsten, nach dessen jüngst aufgefundener Lebensbeschreibung geschildert. Dietz machte auf einem holländischen Walfängerschiff als Schiffsarzt die Reise von Hamburg nach Grönland und ins Eismeer mit.
Wir fuhren wohl drei Wochen, erzählt er sehr anschaulich, ehe wir ins Eis kommen konnten; denn es war fest geschlossen, daß wir ganz hoch, fast bis Grönland, das an Amerika grenzt, segeln mußten. Unsre beiden andern Schiffe hatten wir aus dem Gesicht verloren. Das Eis lag von beiden Seiten des Schiffs wie große Berge, ganz blau, wie Kupferwasser, und so tief in See. Wir legten unser Schiff an solchen Eisberg, der wohl eine halbe Meile in der Länge und Breite hatte. Wir hatten kaum zwei Stunden gelegen, so schrie die Wacht: »Wal, Wal!« Da ward ein Getümmel. Jeder lief an sein Werk. Wir setzten die Schaluppen in See, die am Schiffe hingen, und je sechs Mann mit einem Harpunier sprangen in eine. Damit ging's auf einen großen Walfisch los, der unfern in See lag und aus seinem Kopf durch zwei Röhren haushoch blies mit solchem Gebrause, daß man's weit hören konnte. Die Schaluppen eilten wie ein Pfeil dem Fisch von hinterwärts zu; denn vorwärts dürfen sie ihm nicht kommen, da er mit Gewalt um sich schlägt und gleich forttaucht. Wenn sie nun in aller Geschwindigkeit dicht an ihn gestrichen, so stellt sich der Harpunier vorn auf. Das ist ein Mann, der den Wal mit einem scharfen, spitzigen, stählernen Pfeil, der an einer drei Ellen langen Stange befestigt und wohl sechs Pfund schwer ist, beschießt. An der Stange ist eine Leine festgemacht, die mitten in der Schaluppe ordentlich in Reff liegt, damit sie sich nicht verwirren kann. Sobald der Wal den Wurf fühlt, fährt er mit geschwindester Gewalt in die Tiefe, öfters wohl eine Viertelmeile unter Wasser und Eis. Weil aber das Tier riesengroß, fett und hitzig ist, kann es nach der schnellen Bewegung nicht lange unter See bleiben, sondern taucht an einem andern Orte wieder auf, holt Atem und bläst gewaltig den Dampf wieder durch die zwei Röhren zum Kopfe heraus. Indessen müssen die Schaluppen mit den Leinen immer hinterherlaufen, so schnell, daß öfters der Bord, worauf die Leine läuft, raucht und anbrennt. Mit Seewasser muß einer den Brand löschen. Wenn sich aber wider Verhoffen die Leine verwirrt, haben sie ein Beil daliegen, gleich die Leine abzuhauen. Sonst werden die Leute mit der Schaluppe im Augenblick vom Wal ins tiefe Meer gezogen, wie dergleichen Beispiele viel geschehen. Wenn nun der Wal, wie geschildert, wieder auftaucht, sind die Leute in den andern Schaluppen schon nachgefahren und parat. Und wenn er noch frisch ist, geben sie ihm noch eine Harpune. Nun schlägt er weidlich um sich, daß niemand ihm zu nahe kommen darf, sonst schlägt er mit dem Schwanz und den Seitenflossen alles in Grund und Boden. Endlich taucht er wieder fort. Weil ihm aber die vielen Leinen, die oft zwei bis drei Zentner wiegen, zu schwer sind, kommt er bald wieder herauf. Da sind sie denn wieder parat mit allen Schaluppen. Jetzt nehmen sie Lanzen, daran vorn spitze, scharfe, zweischneidende Messer befestigt sind. Die stechen sie dem Wal tief in die Eingeweide, sobald er in den Leinen etwas ermüdet und still liegt. Wenn er das fühlt, geht's wieder an, und er schlägt und braust so grausam um sich, daß kein Mensch an ihn darf und die See um ihn schäumt. Haben die Lanzen nun glücklich die Eingeweide, Lunge, Leber, Magen, Gedärme usw. getroffen – zum Zeichen dessen bläst er Blut aus statt des Dampfes, und die Leute in den Booten werden davon über und über blutig –, so stirbt er bald. Sonst haben sie noch lange mit ihm, öfters ein ganz »Etmal«, das ist einen Tag, zu tun. Sobald der Wal sich verblutet hat, davon die ganze See sich ringsum färbt, wird er matt und legt sich auf die Seite wie andre Fische. Dann machen sie ihm ein Loch durch den Schwanz, daran sie ein Seil befestigen, ebenso einen großen Haken mit dem Seil ins Maul. Und damit winden sie ihn, wenn er an dem Schiff ist, in die Höhe, etwas außer Wasser. Liegt er aber weit vom Schiff, so muß entweder das Schiff zu ihm fahren, oder es müssen alle sechs Schaluppen vorspannen, mit sechsunddreißig Ruderknechten, und den Wal nach und nach an das Schiff bugsieren. Das geht langsam. Wenn er nun, wie geschildert, etwas in die Höhe gewunden ist, so springen sechs oder acht Kerle auf ihn hinunter, mit großen, scharfen, langen Messern. Damit schneiden sie all das Fette und den Speck los, der ins Schiff gewunden, oben auf einem Tisch zerhackt und dann in Leinwandschläuchen verstaut wird. Das Fleisch und die Knochen bleiben liegen, und ist's ein Fressen für die Eisbären und die großen Seemöwen, die es von weitem riechen und herzuschwimmen. Wenn das Fett herunter, wird dem Wal der Rachen ausgeschnitten, worin die Barten, wohl fünfhundert Stück, dicht aneinander stehen.