
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Unterhalb des Felsens glitzert wie Silber das trockne Bett des Gasch; denn der Gasch ist ein Regenstrom, der nur während einiger Monate im Jahre, der Regenzeit, Wasser führt, den übrigen Teil des Jahres aber lediglich eine gewaltige Fläche blendenden Sandes bildet. Hie und da im Sande findet man natürliche Wasserlöcher, Stellen, deren harter Untergrund das Versickern des Wassers verhindert hat. In der Nähe unsres Lagers,« so schildert Joseph Menges, Hagenbecks berühmtester Tierfänger, den in der italienischen Kolonie Eritrea am Roten Meere gelegenen Fangplatz und die Jagd des großen, braunen Atbara-Pavians, »verengte sich das Flußbett durch eine vorgeschobene Felsenleiste auf fünf Meter Breite, und hier fanden sich in kurzem Abstande mehrere Wassertümpel, die von den Affen als Tränkplätze benutzt wurden. Den ganzen Tag hörten wir das Streiten und Schnattern der Affen, wenn sie zur Tränke zogen; auch des Nachts wurden unsre Ohren von diesem Konzert verfolgt. Auf schmale Felsleisten hingekauert saßen ganze Familien. Leise grunzt und quiekt es, Mütter lullen ihre Babies in Schlummer, und alte Herren brummen über die Störung. Plötzlich ein Kreischen, und die ganze Herde bricht in ein wahnsinniges Geschrei aus. Sicherlich hat der ärgste Feind der Paviane, der Leopard, einen Einbruch versucht. Bei Tage konnte man aus nächster Nähe riesige, alte Männchen bewundern, wahre Prachtexemplare voll Kühnheit und Selbstbewußtsein, und der Wunsch ward rege, diese Herren etwas näher kennenzulernen. Dazu war man ja schließlich ins Lager gekommen. Da erscheint eines Tages unser alter Freund Abdalla Okutt, ein Straußenjäger vom Stamme der halbwilden Basas, und machte uns den Vorschlag, zunächst für uns eine Anzahl der großen »Hobeï« (Paviane) zu fangen, bis sich ein edleres Wild für ihn fände. Alles, was der Jäger zu diesem Zweck gebrauchte, bestand in einigen Äxten und Stricken. Abdalla ging sogleich ans Werk und verstopfte die sämtlichen Wasserlöcher des Flußbettes mit Dornbüschen bis auf eines. Auf diese Weise waren die Paviane gezwungen, alle dieselbe Tränke zu benutzen, und zwar diejenige, an die auch unsre Tiere geführt wurden. Sie hatten sich längst an unsre Anwesenheit gewöhnt und bald ihre Scheu so weit verloren, daß sie mit unsern Tieren an die Tränke gingen und, nur fünfzig Schritt von unsern Leuten entfernt, ihren Durst löschten. Um die Affen noch sicherer und vertraulicher zu machen, wurde in der Nähe des Wasserlochs regelmäßig Durrha (eine Hirseart) gestreut, das die großen Männchen mit Gier annahmen; sie ließen keines der kleineren oder schwächeren Tiere an den kostbaren Fund heran. Inzwischen wurde die Falle hergerichtet. Sie besteht in einem aus Baumzweigen geflochtenen Käfig und gleicht in ihrem Äußern den kegelförmigen Dächern der Negerhütten. Zuerst wird aus zähen Ruten ein Kranz von etwa zwei Meter Durchmesser geflochten. In diesen Kranz werden starke Stangen in Abständen von dreißig Zentimeter gesteckt, die oben mit den Spitzen zusammenlaufen und hier fest verbunden werden. Der ganze Kegel wird darauf mit dünnen Zweigen und Stricken, die man aus der Rinde des Baobab (Affenbrotfruchtbaum) dreht, durchflochten und bildet dann einen derben Käfig von ziemlichem Gewichte. Wenigstens hatten unsre Leute schwer zu schleppen, um eine solche Falle vom Bauplatz nach der Fangstelle, der Tränke im Gasch, zu schaffen. Diese Falle nun wurde derart aufgestellt, daß die eine Seite emporgehoben und durch einen starken, in den Sand getriebenen Knüppel hochgehalten wurde. Jetzt streute man die täglichen Durrhaportionen nicht mehr in den Sand, sondern legte sie in die Falle. Als die Tiere auch in den Käfig gingen und sich hier seelenruhig ihr Futter holten, machte Meister Abdalla Ernst. Im Dunkel der Nacht wurde ein langer Strick an dem Knüppel befestigt, der die Falle offen hielt; im Sande verborgen, führte er zu einem Versteck, von wo aus man den Fangapparat im Auge hatte. Und nun kam die Tragödie. Heiß brennt die Mittagsonne hernieder, und ein Trupp durstiger Paviane eilt schnatternd zur gewohnten Tränke. Einige der stärksten Männchen eilen in den Käfig und machen sich über den Schmaus her. Der Jäger sieht alles, wartet den günstigsten Moment ab – ein Ruck an dem Strick, die Falle schlägt zu Boden, und drei große Affen sind gefangen. Einen Augenblick sitzen die Überrumpelten wie erstarrt, in ihren Augen glüht das Entsetzen; dann suchen sie auf allen Seiten nach einem Auswege und drehen sich dabei wie die Kreisel. Die Herde draußen, nicht minder überrascht, ist im ersten Schrecken geflohen; nun kehrt sie zurück, sammelt sich in der Nähe und feuert die Gefangenen durch ohrenbetäubendes Grunzen und Schreien an, das Äußerste zu versuchen. Die Kühnsten springen dicht an die Falle heran und führen ein erregtes Zwiegespräch mit den drinnen Befindlichen. Die Jäger lassen es aber natürlich nicht einmal zu einem Versuch der Selbstbefreiung kommen. Sobald die Falle geschlossen ist, eilen sie aus ihrem Versteck herbei, um zu verhindern, daß die Gefangenen, die über große Körperkräfte verfügen, das Geflecht durchbrechen. Die Tiere versuchen das sofort, nachdem sie zur Besinnung gekommen sind. Beim Anrücken der Jäger steigert sich die Angst der Gefangenen, die sich an den Holzstäben in die Höhe schwingen und buchstäblich mit dem Kopf durch die Wand zu gehen suchen. Die Jäger haben sich jeder mit einer langen, gegabelten Stange, der »Scheba«, versehen. Man stößt sie durch das Flechtwerk und sucht mit der Gabel den Hals eines Tieres zu fassen. Ist das geglückt und jeder Affe mit einer Scheba zu Boden gedrückt, dann wird der Käfig hoch gehoben, und alsbald fesselt man die Gefangenen. Dies geschieht in sehr gründlicher Weise. Mit starken aus Blättern der Dumpalme geflochtenen Stricken umschnürt man den Tieren das Maul, dann fesselt man Hände und Füße und wickelt den ganzen Körper zur Sicherheit noch einmal fest in ein Tuch, so daß der Gefangene schließlich aussieht wie eine riesige, zum Räuchern präparierte Wurst. Das Paket wird an eine Stange gehängt und von zwei Leuten im Triumph zur Station getragen.
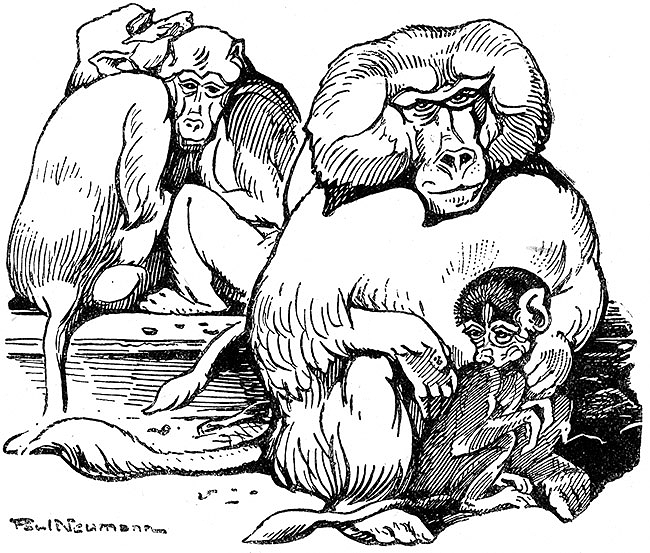
Paviane
Wenn der Fang der großen Paviane so auch seine komischen Seiten hat – für die Fänger ist er keineswegs immer ohne Gefahr. Zwar greift auch das stärkste Pavianmännchen, ohne in die Enge getrieben worden zu sein, kaum einen Menschen an, aber der Umgang mit den frischgefangenen Tieren, deren mächtige Zähne sich mit denen des Leoparden messen können und deren Körperkraft ganz gewaltig ist, geht nicht ohne mancherlei Verwundungen ab. Die halbwilden Basas kümmern sich allerdings nicht sonderlich um die Gefahr: spielt doch der Pavian auf ihrer Speisekarte eine große Rolle. In der »Seriba« (Lager) erhalten die Gefangenen, die sich rasch an das Futter und die Gefangenschaft gewöhnen, nicht selten Besuch; denn die Gefährten draußen in der Freiheit haben sie nicht vergessen. Ganze Herden von Pavianen ziehen nach der mittäglichen Tränke zur Seriba, besteigen die sie umgebenden Dumpalmen und rufen den Gefangenen unverständliche Laute zu. Die antworten darauf mit Klagetönen, und zuletzt artet diese Affentragödie in ein ohrenzerreißendes Konzert aus. Eines Tages sprang ein besonders beherzter Pavian über den Dornverhau in das Lager und eilte auf einen Käfig zu, in dem vielleicht sein Bruder oder sein Vater saß; unsre Leute jagten den Eindringling aber rasch hinaus, während die Zuschauer draußen auf den Bäumen in ein wütendes Geheul ausbrachen.«
Der Schauplatz des Affenfangs verwandelt sich zuweilen aber auch in ein Schlachtfeld, wie ein andrer Fänger Hagenbecks, Ernst Wache, berichtet, zumal wenn es sich um eine Expedition gegen die großen silbergrauen Mantelpaviane handelt. Hier besteht die Falle aus einem fest in den Boden gerammten, sechs Meter langen und vier Meter breiten Flechtwerkkäfig, der auf jeder Seite eine Falltür hat. Dieses zweitürige System hat seinen bestimmten Zweck. Die großen Affenhorden, die sich zwischen den Felsen umhertreiben, zerfallen in einzelne Sippschaften, deren jede von einem Leitaffen geführt wird. Wenn sich eine Schar Mantelpaviane der Falle genähert hat, tritt der Leitaffe nicht mit ein, sondern hält an der Tür Wacht, bis die Lieblingsweibchen und Jungen gefressen haben. Sobald der Leitaffe sich selbst in die Falle begibt, wird er auf seinem Wachtposten von einem andern abgelöst. Da aber die hintere Tür offen und unbewacht ist, schleichen sich durch diese so viele Affen ein, daß der Käfig sich schnell füllt. Plötzlich bricht aus tausend Kehlen ein heiser Schrei, ein Tumult entsteht – die Falltüren haben sich geschlossen! Bei einem solchen Fange stürzte sich einmal eine Schar von annähernd 3000 Mantelpavianen auf die wenigen Jäger, die sich mit Schießwaffen und Knütteln verteidigten, aber trotz aller Tapferkeit zurückgeschlagen wurden und weichen mußten. Die siegenden Affen behaupteten das Feld, öffneten die Falle und befreiten so die Gefangenen. »Im Getümmel des Kampfes,« schildert Wache, »konnte man wahrhaft rührende Szenen beobachten. Ein kleiner Affe, der, durch einen Knüttelschlag betäubt, am Boden lag, wurde von einem großen Männchen gerettet und kühn mitten durch die Feinde hinweg in den Busch getragen. Eine Mutter, die bereits ein Junges auf dem Rücken trug, nahm noch ein zweites auf, dessen Mutter erschossen worden war.«
Die Neugier und Leckerhaftigkeit der Paviane machen sich die Beduinen für den Affenfang auch in andrer Weise dienstbar. Wie der berühmte Afrikareisende Wilhelm Junker erzählt, durchstöbern die Tiere gleich nach Aufbruch der Karawanen deren Lagerplatz nach Resten der Mahlzeit, verstreuten Durrhakörnern und dergleichen. So stellen dann die Araber ihnen Töpfe mit »Merissa« (aus Durrha gebrautem Bier) hin, über die die Paviane sich alsbald hermachen. Sie leeren die Töpfe so rasch als möglich und werden davon schnell berauscht. Die vom Bier trunkenen Affen sind unschwer zu fangen.
Zu den Pavianen oder Hundskopf-Affen ( C?nocephalus, so hat sie schon der griechische Philosoph und Naturforscher Aristoteles genannt) gehören die, wie Brehm urteilt, »häßlichsten, rüdesten, flegelhaftesten und deshalb widerwärtigsten« aller Affen. Der Pavian ist gleichsam der Affe ins Extrem getrieben, ja, in gewissem Sinne, eine Karikatur des Affen. Massiger und in allen Teilen plumper gebaut als die übrigen niederen Schmalnasen ( Catarrhini), sind die Paviane dem Erdleben besonders angepaßt. Die Beine sind kaum länger als die Arme und gestatten daher die weiten Sprünge der Baumaffen nicht, wohl aber ausdauerndes und gewandtes Bergsteigen und Klettern. Der Schwanz ist zumeist kurz und deshalb nicht zum Steuern beim Sprunge und zum Greifen geeignet. Riesige, oft lebhaft gefärbte Gesäßschwielen deuten des weiteren auf das Erdleben hin. Das charakteristischste an ihrer ganzen Erscheinung ist aber der große, plumpe, zu langer, vorn abgestutzer Schnauze ausgezogene Kopf, in dem die kleinen Augen unter dem derben Wall der knöchernen Augenbrauenbogen wie vertieft liegen, »in ihrem Ausdruck das treueste Spiegelbild des ganzen Affen selbst – listig und tückisch ohnegleichen«. Die Ohren sind klein. Die großen Backentaschen und die wulstige oder gefurchte Schnauze sind nicht geeignet, den wahrhaft brutalen Eindruck dieses Gesichtes abzuschwächen. Die muskulösen Arme verraten große Kraft. Die wichtigste Waffe der Paviane aber ist das mächtige Gebiß, dessen Eckzahn zumal raubtiermäßig entwickelt ist; Zell bezeichnet die Hundskopf-Affen daher ganz treffend als »Gebißaffen«.
Von den zahlreichen, durch Afrika, Arabien und Indien verbreiteten Pavianarten seien hier nur einige ihrem Äußeren nach kurz geschildert. Der häufigste Pavian ist wohl der Bâbuin ( C?nocephalus Bâbuin), der etwa siebzig Zentimeter Schulterhöhe erreicht. Er ist ziemlich gleichmäßig dunkel olivengrün gefärbt, auf Brust und Bauch etwas heller; Gesicht und Ohren sind schiefergrau, die Backen weißlich gelb. Der Schwanz ist verhältnismäßig dünn und fast halbmeterlang. Sehr stattlich gibt sich der Mantelpavian oder Hamadr?as ( Cynocephalus Hamadr?as), der in seinem buschhaarigen, grünlich grauen, gescheitelten Kopf einer kecken Professorenkarikatur gleicht, wie er denn auch im alten Ägypten dem Gotte Thoth, dem Genius der Wissenschaften, der Schreibkunst und der Himmelskunde, geweiht war. Wie eine zottige Pelerine hängt dem Männchen der langhaarige Mantel von den Schultern über Rücken und Brust herab, um so stattlicher, je älter das Tier ist. Die Farbe des Pelzes ist ein schmutzig grünliches Grau, von jener Mischung etwa, wie sie graues Menschenhaar zeigt, wenn es künstlich dunkel gefärbt wurde und die künstliche Farbe wieder ausgefahlt ist. Von diesem Grau und Grün sticht der Fleischton des Gesichtes und das brennende Rot des Gesäßes höchst eigenartig ab. Die häßlichsten aller Paviane sind der Drill und der Mandrill, die, ausschließlich in Westafrika heimisch, sich im übrigen von den andern Artgenossen in manchen Punkten ihres Baus nicht unwesentlich unterscheiden. Ihr Körper erscheint im ganzen noch plumper und massiger, ihr Kopf verhältnismäßig noch größer und eckiger, der Schwanz ist ein kurzer Stummel, die Gesäßschwielen breiten sich über das ganze Sitzfleisch aus. Der Drill ( Cynocephalus leucophaeus) wird etwa neunzig Zentimeter lang, ist im allgemeinen olivenbraun, an Brust und Bauch weißlich gefärbt, hat ein schwarzes Gesicht mit derben Wangenwülsten und weißem Backenbart und ein lebhaft rotes Gesäß. Der noch scheußlichere Mandrill ( Cynocephalus maimon) erscheint in seiner Färbung wie ein schlechter Witz, den sich ein lustiger Maler gemacht hat. Der sehr struppige Pelz ist auf dem Rücken dunkelbraun grünlich, an der Brust gelblich, am Bauch weißlich. Ein sträubbarer, steil emporstehender Schopf auf dem Kopfe und ein zitronengelber, breiter Spitzbart schließen das Bild der Behaarung. Gerade auf die Nacktteile aber, Gesicht und Gesäß, scheint, wie Wilhelm Bölsche einmal launig schildert, ein toller Pinsel die grellsten, modernen Farbeneffekte in dicksten Klatschen aufgemalt zu haben. Die Nase ist schreiend blutrot wie eine aufgenagelte Stange Siegellack. Rechts und links wie zwei Flügel die Backenwülste vorgepustet und auf jedem ein Farbklatsch Kobaltblau, fettig dick, daß man ordentlich die Ölfarbe abkratzen möchte. Die gleiche Palette aber ist etwas verschwommener von hinten gegen den Leib dieses Waldschratts gehauen: der After und seine benachbarten Teile in die pure Siegellackröte hinein, die dicken Schwielen des Gesäßes in ein Gemisch aus Rot und Himmelblau. Vom ästhetischen Standpunkt aus einfach scheußlich, und, müssen wir leider hinzufügen, vom Standpunkt europäisch-menschlicher Moral hat für den Mandrill dasselbe harte Urteil Geltung: was wir Scham nennen, kennt er nicht.
Das Freileben der Paviane in Ostafrika hat uns der jüngst verstorbene Afrikaforscher und -jäger Schillings an zwei Arten sehr anschaulich geschildert. Der gelbe Pavian ist ein Steppenbewohner. Nur in der Nacht sucht dieser im engsten gesellschaftlichen Verbande großer Herden lebende Affe seine Schlafbäume auf. Am Tage durchstreift er Steppe, Busch und Uferwälder, um seiner Nahrung nachzugehen. Diese besteht in Gräsern, Baumfrüchten, Blättern, Samen – und, ergänzen wir, in Zwiebelgewächsen, die der Pavian mit den Fingern geschickt auszugraben weiß – in allen möglichen Insekten und niederen Tieren, selbstredend auch aus gelegentlich gefundenen Vogeleiern und jungen Vögeln. Auf Schritt und Tritt folgt den Pavianherden der Leopard, ihr schlimmster Feind, und nach ihm und andern Verfolgern spähen die höchst wachsamen älteren Tiere der Herde stets auf das sorgfältigste aus. »Nichts ist interessanter, als das Treiben einer solchen mehr als hundert Mitglieder zählenden Pavianherde zu beobachten. Auf einem umgestürzten Baumstamme, nur wenige Meter über dem Boden, haben drei oder vier erfahrene Anführer, Umschau haltend, Platz genommen. Unter ihrer Aufsicht fühlt sich die Herde vollkommen sicher. Sowohl die erstaunlich großen alten Männchen, deren Eckzähne an Stärke und Länge die des Leoparden bedeutend übertreffen, wie auch die Weibchen, an die angeklammert wir entweder kleine Junge erblicken, oder denen schon erwachsenere in unmittelbarer Nähe folgen, dann aber auch eine große Anzahl mittelgroßer Tiere – sie alle ergehen sich nun sorglos in der Waldlichtung, fortwährend Grashalme auszupfend, Steine umkehrend, Heuschrecken und andre Insekten erhaschend, oder auch miteinander Kurzweil aller Art treibend … Aber urplötzlich ändert sich das Bild. Irgendeins der Tiere hat mich bemerkt, und wie der Blitz stiebt die Herde staubaufwirbelnd davon. Ein aus nur wenigen quiekenden und knurrenden Tönen bestehendes Warnen hat die Affengesellschaft sofort in Bewegung gesetzt. Die auf dem Baumstamme Wachhaltenden plumpsen herab, sie und die jüngeren Tiere nebst den Weibchen stürmen von dannen. Den Beschluß machen die starken, alten, wehrhaften Familienväter mit gesträubten Rückenmähnen und eigentümlich schief gehaltenen Schwänzen, zwar unter fortwährendem Umschauen, aber im eiligsten Galopp. Auf der Flucht zeigt sich ihre gesellschaftliche Verbindung auf leicht erkennbare Weise. Die älteren Tiere teilen den jüngeren und unerfahreneren rücksichtslos Püffe und Knüffe aus, um sie zu eiliger Flucht zu nötigen. Auf mehrere hundert Schritt sehen wir Mitglieder der Herde blitzschnell hier und da Baumstämme nur einige Fuß hoch erklimmen, um abermals Umschau zu halten, und dann kündet uns eine weit sich dahinziehende Staubwolke, daß die Herde ihr Heil in ferner Flucht sucht.
Ganz anders gestaltet sich das Treiben des grünlich gefärbten, bergbewohnenden Pavians. Die Tiere leben in großen Herden an Bergabhängen. Mit Vorliebe pflegen sie an steilen, höchst unzugänglichen und schroffen Felswänden zu übernachten, sich so tunlichst vor den Nachstellungen der Leoparden sichernd. Fröstelnd in der Kühle des Morgens, hocken sie aneinander gedrängt auf den Felsen, und erst langsam unter dem Einfluß der belebenden Sonnenstrahlen erwacht die Herde zu neuem, regem Leben; denn Paviane sind licht- und sonneliebende Geschöpfe. Mit einem guten Glase kann man das Tun und Treiben dieser Affenherde oft stundenlang verfolgen. Die Bergwände scheinen dann von einem primitiven Menschengeschlecht bewohnt, Gebirgsbewohner, die sich in jene unzugängliche Felsenwelt zurückgezogen haben. Erstaunt musterten mich zuweilen die beträchtlich großen und starken Anführer der Herde, auf vorspringenden Felsen sitzend, während die Weibchen und die jüngeren Tiere sich in großen Mengen weiter in den Hintergrund zurückgezogen hatten. Weithin erklingen innerhalb der Felsen die Warnstimme und die empörten Ausrufe der Affen beim Anblick von Menschen. Unter Umständen wird ihr Schreien und Lärmen sehr laut und durchdringend, namentlich zur Nachtzeit, wenn die Affen sich gegenseitig vor den Leoparden warnen. Wenn plötzlich in dunkler Nacht sich dies angstvolle Schreien, die hohen Fisteltöne der Jungen, das tiefe Brummen und Knurren der alten Affen vernehmen läßt, gefolgt vielleicht für kurze Augenblicke von dem lauten Geknurr des furchtbaren Feindes der Affen, des Leoparden, so wird dies ein nächtliches Konzert, das zweifellos mit zu den eindrucksvollsten Naturlauten afrikanischer Wildnis gehört. Immer wieder läßt sich das angstvolle Aufschreien einzelner Mitglieder der Affenherde vernehmen, und selbst nach langer Zeit noch kündet uns hier und da ein einzelner Warnruf, daß die Führer der Herde auf ihrer Hut sind.«
Von einigen Beobachtern ist berichtet und verbürgt worden, daß die Paviane sich gelegentlich mit Steinwürfen gegen menschliche Angreifer verteidigen oder Geröllsteine auf sie herabrollen. Ein so zuverlässiger Gewährsmann wie Schweinfurth, der verehrungswürdige Nestor der heutigen Afrikaforscher, berichtet, daß er einmal in Eritrea gesehen habe, wie ein Bärenpavian mit einem Steine das außerordentlich dicke und harte Kerngehäuse einer Frucht aufklopfte, um die süß schmeckenden Samen darin zu erlangen. »Die Paviane,« schrieb er mir dazu, »müssen, belehrt durch andre, leichter (etwa mit den Zähnen) aufknackbare Nüsse zu der Schlußfolgerung gekommen sein, daß auch diese Kerne eßbare Samen enthalten könnten, um den mühsamen Versuch zu wagen. Also eine Schlußfolgerung aus Erfahrung.« Viel anders wird der Mensch der Urzeit den Stein auch noch nicht als Waffe und Werkzeug gebraucht haben. Solche zweifellos intelligenten Handlungen stehen mit andern Äußerungen der geistigen Fähigkeiten des Pavians durchaus im Einklang. Er läßt sich in der Gefangenschaft leicht zu allerlei Kunststücken abrichten, und ich erinnere mich aus meinen Kindertagen noch mit Vergnügen der Paviane in Broekmanns berühmtem Affentheater, die ihre Rollen weitaus am besten beherrschten. Ebendiese geistige Begabung, die den Pavian auszeichnet, verlieh ihm das Ansehen, das er als Göttertier im alten Ägypten genoß, und sie war es auch, die in der mohammedanischen Legende aus den Pavianen zur Strafe wegen ihrer Schlechtigkeit verwandelte Menschen schuf.