
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es gibt ein paar wundervolle Porträte vom alten Zieten, dem »Joachim Hans von Zieten, Husarengeneral«; das eine rührt von dem zeitgenössischen Stecher Daniel Berger her, das andre hat uns der unvergleichliche Adolf Menzel gezeichnet. Beide zeigen uns den »Ahnherrn aller Husaren« in seiner so charakteristischen Tracht: mit der riesigen, adlerfittichgeschmückten Zobelfellmütze und dem buntgefleckten, goldsternübersäten Leopardenfell auf der Schulter. Dieser kriegerisch wilde, fremdartige Schmuck, diese prunkende Pantherhaut, sie sind uns nicht nur ein Symbol des kühnen, grimmigen Reiterführers Friedrichs des Großen, sie wirken auf uns wie die Verkörperung kecken Husarengeistes selber. Schon seit ältesten Zeiten war das Pardelfell ein begehrtes Würdezeichen und Schmuck. Im Pharaonenreiche trugen es die Hohenpriester. Panther säugten Dionysos, den Gott des Weins, Panther ziehen seinen Wagen, mit Pantherfellen schmückt sich die wildrasende Mänadenschar. Und wie dem stolzen Karthagerfeldherrn Hannibal die gesprenkelte Leopardenhaut um die Schultern flatterte, so schmücken sich damit als einem Siegeszeichen noch heute die Würdenträger der Negervölker. Ja, bei manchen dieser verlangt es das tyrannische Herkommen, daß der glückliche Leopardenjäger den Stolz seiner Beute, die riesigen Fangzähne der Katze, dem Häuptling überbringe, der sie, zur Schnur aufgereiht, um den Hals trägt, als würdiges Zeichen der Jagdtüchtigkeit und des Mutes der Söhne seines Stammes. Gerade solche Jagdtrophäen sind die ersten Anzeichen des Schmucktriebes beim Menschen. Der kühne Jäger suchte sie, zum Gedächtnis seiner Tat, als Zeugnis bewiesener Tapferkeit und aus Freude an dem seltenen Besitz aufzubewahren, und er wußte keinen besseren und keinen sichreren Aufbewahrungsort dafür als den eigenen Körper, an dem sie der andre neidisch jederzeit sah und bewundern konnte. Man wird deshalb bald allgemein danach getrachtet haben, sich ähnlichen Besitz zu verschaffen, ähnliche Auszeichnung zu erlangen, und damit war die Eitelkeit geweckt, die nach Goethes treffendem Worte »persönliche Ruhmsucht« ist.
Der Leopard ( Fçlis pâ?rdus) oder Panther – einzelne Systematiker wollen die letztere Bezeichnung nur der etwas größeren asiatischen Form des Tieres vorbehalten – ist vielleicht die typischste aller Wildkatzenarten und damit die schönste, diejenige, die körperlich wie geistig die besondern Eigenarten der Katzen am schärfsten hervortreten läßt. Sie ist auch die verbreitetste; denn sie ist in ganz Afrika und ganz Südasien heimisch, zumal in Afrika noch überall so häufig, daß man mit Schillings wohl behaupten darf, der Leopard sei tatsächlich »überall und nirgends«. Der kräftige, gedrungene Körper erreicht eine Länge von fast anderthalb Meter, der Schwanz eine solche von über einem halben Meter. Der ziemlich große, auf kurzem Halse sitzende Kopf mit den grüngelblich leuchtenden Augen ist rundlich wie der des Tigers, die mit langen, derben Schnurrhaaren besetzte Schnauze springt kaum merklich vor; die kräftigen Beine sind mäßig hoch, die Pranken wohlproportioniert. Die Grundfärbung des kurzhaarigen, glänzenden Fells ist ein fahles oder gesättigteres Rotgelb, ein Goldgelb, das auf dem Rücken sich ein wenig bräunt und rötet, an Kehle, Brust, Bauch und Innenseite der Gliedmaßen aber ein leicht gelbliches Weiß. Diese Grundfarben sind nun gleichsam überspritzt von zahllosen, schwarzen Tupfen und rundlichen Flecken, die bald kleiner, bald größer sind, hier wie gesäumt erscheinen, dort etwas auseinanderfließen, hier zu Reihen angeordnet, dort ganz unregelmäßig ausgestreut dünken – ein prachtvoll buntes, scheinbar überaus auffälliges Bild. Und doch ist dieses wildbunte Fell die denkbar beste Schutzfärbung. Die im Käfig anscheinend so grelle und auffallende Färbung des Leoparden, sagt Schillings, verschwimmt in der Freiheit so vollkommen mit der Umgebung, macht ihren Träger derart unsichtbar, daß es dem Leoparden möglich ist, unbemerkt selbst am Tage Menschen in nächster Umgebung an sich vorbeigehen zu lassen. »Einmal trat ich,« so erzählt er, »fast auf einen Leoparden, der auf freier, kahler Steppe, zwischen dürftigen Grasbüscheln ruhend, so dicht vor meinen Füßen flüchtig wurde, daß ich, im Augenblick heftig erschrocken, unwillkürlich einen Schritt zurückfuhr.« Bisweilen findet man auch »Schwärzlinge«, Tiere, die als Grundfärbung ein bräunliches Schwarz, auf dem Rücken dunkler als auf der Unterseite, zeigen, von dem sich die tiefschwarzen »Rosetten« und Tupfen kaum noch abheben. Es ist das ein gewissermaßen krankhafter, durch zu reiche Farbstoffanhäufung (»Pigment«) in der Haut bedingter Zustand. Bei der asiatischen Leopardenform ist die Sprenkelung und Rosettenbildung etwas abweichend, wie übrigens auch bei dem Afrikaner sich kaum zwei Felle in der Zeichnung völlig gleichen. Das Gebiß des Leoparden ist mit dem außerordentlich kräftig entwickelten Eck- oder Fangzahn und dem dreizackigen Reißzahn das typische Katzengebiß. Die scharfen Sichelkrallen können wie bei allen echten Katzen mit dem letzten Zehenglied zum Schutz gegen Abnutzung nach oben geschlagen werden (s. S. 80).
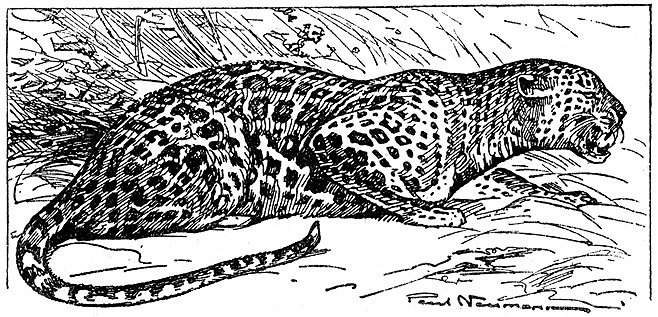
Leopard
Jeden Aufenthaltsort wählend, der ihm genügend Deckung bietet, ein ausgezeichneter Kletterer, der den Tag nicht selten im Schutze einer schattigen Baumkrone verschläft, ein ebenso vorzüglicher Läufer, wenn es sein muß – es ist außerordentlich schwer zu beschreiben, berichtet Schillings aus vielfältiger Erfahrung, mit welcher Blitzesschnelle Leoparden sich fortzubewegen pflegen, sei es im Angriff, sei es, wenn sie vor dem Menschen flüchtig werden –, ebenso gewandt auf Felsen wie auf ebenem Boden, zieht der Leopard meist erst mit Anbruch der Dunkelheit auf Raub aus; aber er scheut sich auch nicht, am hellichten Tage seine Überfälle zu wagen. Alles, was er bewältigen kann, ist ihm erwünschte Beute. An der ostafrikanischen Küste sah ihn Groß Fische verzehren; Pechuel-Loesche beobachtete, wie er die fetten Früchte der Ölpalme verschlang. Nach Schillings geht er mit Gier auch an Aas. Eine Lieblingsbeute sind ihm die Paviane, die aber gelegentlich den Kampf mit ihm aufnehmen, sein Nahen einander durch gellende Warnrufe signalisierend. Auch alle andern Tiere stoßen Warnrufe aus, sobald sie ihn erblicken. Der Leopard selbst läßt sich übrigens nur selten vernehmen. Seinen mehrmals wiederholten, rauhen, von Knurrtönen unterbrochenen Laut, der »hustenartig scharf« hervorgestoßen wird, gibt Pechuel-Loesche mit »hura-ak« wieder. Brehm hat aus Abessinien das Bündnis sämtlichen Getiers gegen den Leoparden einmal sehr lebendig geschildert. Irgendein kleiner Vogel braucht ihn nur zu entdecken, und alsbald erhebt sich ein wahrer Aufruhr unter den geflügelten Scharen. Einer der häufigen Raben wird aufmerksam, kommt herbei, überzeugt sich von dem Vorhandensein des Feindes und stößt nun schreiend von oben herab auf ihn nieder, wenngleich ängstlich bemüht, sich aus dem Bereich der geschickten Tatzen zu halten. Andre Raben hören den wohlbekannten Ruf und kommen in Menge herbei; die ganze Gesellschaft verfolgt den Räuber durch Busch und Hag, setzt sich über ihn auf kahle Baumstämme oder Steine, zieht andre Spötter und Warner herbei: den Honigkuckuck, Blauracken und vor allen die eifrigen Nashornvögel, die die Vögel der ganzen Gegend aufstören und als wohlbekannte Warner von ihnen und selbst den Säugetieren vollkommen verstanden werden. Nachts warnen die Klippdachse, die wohlverborgen in ihren Felsritzen und Höhlungen hocken, durch ihr Grunzen nicht bloß die Antilopen und andre schwächere Säugetiere, sondern auch den Menschen vor der Ankunft des Leoparden.
So wird es also dem Leoparden nicht gerade allzu leicht gemacht, seine Beute zu erlangen. Aber er setzt sich über diese Erschwerung durch seine Verschlagenheit, seine erstaunliche Gewandtheit und eine Kühnheit hinweg, die man schon Unverschämtheit nennen darf. Haustiere raubt er am hellen Tage, und in seiner Mordlust tötet er viel mehr, als er fortschleppen und fressen kann. Hutter erzählt, daß ein Leopard ihm einmal sämtliche Ziegen seines Stalls schlug, ohne daß man des Räubers habhaft werden konnte. Eine deutsche Jagdgesellschaft saß in Ostafrika einmal rauchend in der Nähe ihrer Zelte am Lagerfeuer, als plötzlich der dicht neben einem der Jäger liegende Foxterrier einen schwachen Laut ausstieß und im selben Augenblick verschwunden war: ein Leopard hatte ihn blitzschnell dicht vor den Füßen seines Herrn entführt! Am nächsten Abend raubte vermutlich derselbe Leopard im selben Lager ein junges Negerweib! Daß Leoparden sich an Menschen wagen, ist keine Seltenheit. Wissmann berichtet uns aus dem Gebiet der Wakusu (Zentral-Afrika), daß während eines kurzen Lageraufenthalts seiner Expedition nicht weniger als vier Neger von Leoparden überfallen wurden. Die Eingeborenen sagten aus, daß viele Leoparden schon seit einer Woche die Gegend in Schrecken setzten, daß niemand mehr nach Anbruch der Dunkelheit aus den verrammelten Hütten ginge, bei Tage nur vier bis fünf Menschen zusammen ihren Geschäften obliegen könnten, und daß sie nichts zu tun vermöchten, als Lärmen und Trommeln des Nachts, wenn die Bestien versuchten, in die Hütten einzudringen. Ähnliche Erlebnisse berichten Fonck aus Ostafrika und Junker von den innerafrikanischen A-Sandé. Die Neger am oberen Kongo, die gleichfalls viel von dem Leoparden zu leiden haben, nennen ihn denn auch bezeichnenderweise »Mfum«, d. h. den »Herrn« oder »König«. So ist der Leopard wohl das grimmigst gehaßte Raubtier Afrikas, von Mensch und Tier gleich verabscheut und gefürchtet und überall verfolgt.
Um den Besitz des Weibchens werden von den Männchen oft heftige Kämpfe ausgeführt. Das Weibchen pflegt zwei bis fünf Junge zur Welt zu bringen, die in ihrem spielerischen Wesen sehr an bunte junge Hauskätzchen erinnern. Eine säugende Alte, hebt Brehm hervor, wird zur Geißel für die ganze Gegend; denn sie raubt und mordet mit der allergrößten Kühnheit und ist dabei vorsichtiger als je.
Die Eingeborenen suchen den Räuber gewöhnlich in Fallen zu erlegen. Da der Leopard, schildert Junker, einige Tage nacheinander an den Ort zurückzukehren pflegt, wo er ein Opfer fand, so bauen die A-Sandé, um seiner habhaft zu werden, an der betreffenden Stelle das Gerüst einer Blockhütte, in der ein mächtiger Baumstamm als Fallklotz dient. Wird an der Lockspeise gezerrt, die aus einem Fleischrest, dem Bein oder Arm des tags zuvor getöteten Opfers besteht, so erschlägt der niedergehende Balken das gefräßige Raubtier. In Ostafrika wird der Leopard von den Europäern mit dem Tellereisen gefangen, auch werden oft Selbstschüsse gelegt. Meist wird ein kleiner Stall gebaut, schildert Fonck, mit offener Tür, vor der man die Falle gut verblendet aufstellt. In der kleinen Hütte wird in der Regel eine Ziege angebunden. Trotz aller Sorgfalt und Überlegung aber, mit der man ihn überlisten will, geht der Leopard oft genug am Eisen vorbei und bricht seitlich oder von der Rückwand durch, um sich den Köder zu holen. In andern Gebieten fangen die Neger das Raubtier auch in tiefen, mit spitzen Pfählen bewehrten Gruben. »Ich habe einmal,« schreibt Hutter, »den Fang eines Prachtexemplars in solcher Wildgrube mit angesehen. Speer auf Speer schleuderten die Bali (Nordkamerun) hinunter, wo das Tier bereits schwer verletzt auf einem der spitzen Pfähle hing. Aus zahlreichen, tiefen Wunden floß das Blut, und immer noch krümmte sich der schlanke, geschmeidige Leib des außerordentlich zählebigen Leoparden, peitschte der Schweif die Wände der Grube, fuhr zornfunkelnden Auges der Kopf mit aufgesperrtem Rachen bald an diesen, bald an jenen Speerschaft, und krachend splitterte das Holz unter dem Gebiß.«
Schon die alten Römer zur Kaiserzeit verstanden es, den Leoparden lebendig zu fangen; ließen sie doch bei ihren Zirkusspielen nicht selten Hunderte von Tieren auf einmal in die Arena zur » venâtio« (Tierhetze). Einige Wandgemälde, die man in Rom gefunden hat, veranschaulichen uns den Fang. Da sieht man, wie die Leoparden, rings von Soldaten umstellt, die hinter ihren hohen Stahlschilden geschützt stehen, in Kastenfallen gehen, darin sie in einem Spiegel sich selbst erblicken. Das dürfte aber gewiß nur ein lustiger Malerscherz gewesen sein.