
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
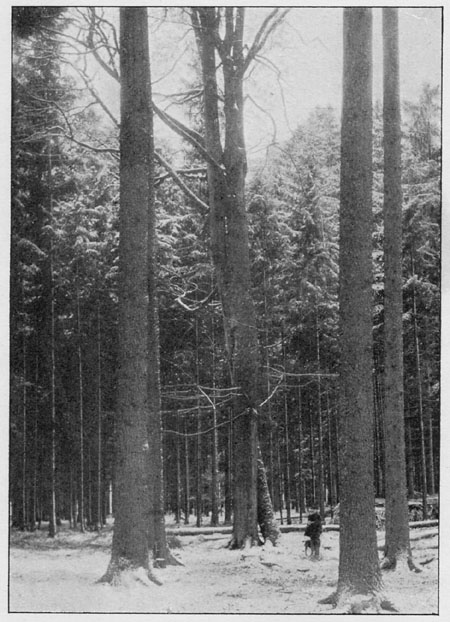
Im Zellwald
Der Sommer schwand, und ich sah mit bangen Ahnungen, wie die Mutter ihren Sammlungen den endgültigen Aufputz vor ihrem Eintritt in die Welt gab. Ich bekam viel weniger freie Zeit, ich mußte Etiketten und Verzeichnisse schreiben, wir pappten Mappen und hatten alle Hände voll zu tun.
Eines Tages kam die Mutter von einer Tagereise zurück und sagte mir mit müder, mutloser Stimme, daß sie sich vergeblich nach einem Aufenthalt für mich umgesehen habe. Die Vorschläge, die man ihr für mich gemacht hätte, wären ihr nicht annehmbar erschienen. Nur in Heynitz beim Lehrer habe man ihr Hoffnung gemacht, mich zu nehmen. Ob ich wohl Lust habe nach Heynitz zu gehen? Es seien viele Kinder da, und sie hätte Angst, daß mir die Arbeit in dem großen Haushalt zu schwer werde.
»Wenn du dazu keinen Mut hast,« sagte die Mutter, »dann hör' dich doch selbst mal um, ob du etwas Besseres findest.«
Ich versuchte, die Mutter zu bewegen, mich mitzunehmen; aber auf dem Ohr war sie taub. Da bat ich dringend, sie möge doch mit mir zum Nossener Pastor gehen und den fragen, ob es keine Möglichkeit gäbe, daß ich noch etwas lernte, in eine Pension käme oder in eine Anstalt, wo ich zur Lehrerin ausgebildet würde. Die Mutter wollte nicht, sie sagte, es sei verlorene Zeit, wenn man kein Geld habe, gäbe es keine Ausbildung.
»Versuch's doch!« bat ich, »vielleicht gibt es Freistellen!«
Die Mutter schüttelte seufzend den Kopf, aber sie tat mir den Willen, ich durfte sogar mitgehen.
Der Pastor hörte die Wünsche der Mutter freundlich an, dann sagte er, dabei könne er durchaus nichts tun. Gewiß, es gäbe solche Anstalten, aber Geld gehöre selbst im günstigsten Falle dazu, ich müsse doch eine Ausrüstung mitbringen, ob die Mutter sich dazu verpflichten könne?
»Nein,« sagte sie, »das kann ich nicht!« –
»Siehst du?« sagte die Mutter, »ich sagte es dir doch! Schlag dir vorläufig diese Gedanken aus dem Sinn, und finde dich mit Geduld in dein Schicksal.«
Ich weinte und bangte. Bei meinen Bekannten hatte ich wieder vorgefragt, und eines Tages hörte ich, daß in Nossen ein Gürtler ein eben konfirmiertes Mädchen suche, um das halbjährige Kind zu warten. Ich wollte viel lieber nach Nossen. Da war mein Pastor, zu dem ich Sonntags in die Kirche gehen konnte, da waren Winklers und die eine und andere Schulbekannte. Die Mutter ging mit mir zu den jungen Leuten. Mut und Lust hatte ich nicht, aber ich hatte keine Wahl, und die Sache schien übersichtlich. Ich sollte im Haushalt helfen und im übrigen das Kind ausfahren und warten. Das Kind lockte mich. Ich stellte mir vor, wie schön es sein müsse, auf dieses welke Gesichtchen ein Lächeln zu locken. Ich wollte es recht in die Sonne fahren, damit die Bäckchen sich röteten. Die Sache wurde abgemacht, und bald danach siedelte ich wieder nach Nossen über. Daß ich damit meinen Lieblingswunsch begraben mußte, das kostete, neben dem Abschied von der Mutter, heiße Tränen und schlaflose Nächte. Der einzige Lichtblick in diesen Tagen schien mir die Nähe des Pastors zu sein. Ich zählte die Tage bis zum Sonntag, und ein paarmal durfte ich auch zur Kirche, dann war's vorbei. Zu meinem großen Schrecken blieben wir nicht in Nossen.
Ich hatte gesehen, daß manchmal ein alter Mann kam, zuerst achtete ich nicht darauf, was gesprochen wurde, ich sah, daß Papiere ausgebreitet wurden, es wurde von Kaufsummen gesprochen, da wurde ich aufmerksam. Als das die Leute merkten, wurde ich mit dem Kinde hinausgeschickt.
Nicht lange danach kam eines Morgens ein Leiterwagen, eine Arbeitsfrau stellte sich ein, und eh' ich mir's versah, wurden alle Sachen auf den Wagen geladen, das Kind in den Kinderwagen gepackt, und fort ging es. Während wir unterwegs waren, setzte starker Regen ein, der uns aber nicht hinderte, unsere Wanderung fortzusetzen. Ich hörte, wir sollten nach Voigtsberg. Nach einstündiger Wanderung kamen wir durch mein Heimatstädtchen, von hier aus hatten wir noch eine Stunde, ehe wir Voigtsberg erreichten. Soviel wir auch auf unsern botanischen Wanderungen herumgekommen waren, gerade hierher war ich nie gekommen, ich hatte nur den Vater erzählen hören, daß er hier öfters Steine gesammelt hatte. Das Dorf samt seiner Umgebung war mir vollständig fremd, mein Herz zog sich zusammen. Als wir die letzte Steigung hinter uns hatten, sah ich vor mir eine kahle Anhöhe, auf der ich allerhand Gebäude sah, die aber nicht Wohnhäuser waren. Trotz des Regens hielt ich Umschau. Eine Kirche entdeckte mein suchender Blick nicht, als wir aber weiter kamen, sah ich, daß am Berge kleine Häuser klebten.
Wir kamen auf einen Hofplatz, auf dem ein schiefergedecktes Häuschen stand, nicht weit davon sah ich eine ziegelgedeckte Scheune.
An dem Abhange, der zum tiefer liegenden Grasgarten führte, bot sich mir ein seltsamer Anblick. Im Grasgarten schnatterte eine Gänseherde und versuchte, den höher gelegenen Hofplatz zu erreichen, aber oben stand eine kleine, alte Frau, die wütend einen kurzen Besenstumpf über ihrem Kopfe schwang und der andrängenden Schar eine Flut von Schimpfworten entgegenschleuderte. Ihre nassen Röcke hatte sie mit einem dicken Strick in die Höhe gerafft, so daß ihre kurzen Beine, die in hohen Männerstiefeln staken, bis zum Knie sichtbar waren. Die formlose Taille umschloß ein schmutziger Schafpelz.
Als sie uns sah, schleuderte sie ihre Waffe kurzerhand unter die schnatternde Schar und wandte uns ein gelbliches, runzliges Gesicht zu, über das in feuchtem Gelock das ergraute Haar fiel. Das Bild war wie aus einem Märchen.
Drinnen war der Hausrat soeben abgeladen, Stroh und Papier lagen umher, das Kind weinte, und ein schwarzer Hund fuhr knurrend auf uns los. Die Alte, die mit uns eingetreten war, gab dem Hunde einen unsanften Tritt, so daß er jaulend das Weite suchte.
»Na, Haubolden,« sagte die Alte mit grimmigem Lachen, »macht's eich kommode! Stellt eich den Schrumpel nor balde zorechte, denn hinte (heute abend) wern de Bergleite schon kummen, um sich de neien Kramerschleite anzusehen. Fer de Dreierbrötchen un de Heringe is heite noch gesorgt.«
Dann fiel ihr unruhiger Blick auf mich, »Wem is'n die?« fragte sie und tippte mich an, »is das erne (etwa) eire Mad?«
»Ihr seht ja, sie gehört zu uns,« sagte die Frau in verdrießlichem Tone.
»Ha!« rief sie, und ihre dunklen Augen funkelten mich feindselig an: »Die! Die werd eich ooch viel helfen!«
Sie spuckte verächtlich aus und sagte höhnisch: »Jechen noch emal, ordentlich Stiefelettchen hat se an? An su e Fähnchen? Marsch, glei gehste un ziehst d'r en derben Kittel un ene Jäcke an, un Banduffeln an de Füße. Du kannst doch hier ni in Stadtkledern gehn, mußt's Vieh beschicken, Wasser holen. Gehste! Glei mußte 's Schweinefutter zurecht machen. Hier sein zwee Schweine, sechs Gänse, Hühner und ene Ziege. Wenn de wieder kommst, mußte Wasser holen, das is salte oben, siehste, bei dem kleenen Heischen mit den blau gemalten Balken, da steht der Trog.«
Sie zeigte durchs Fenster auf die Dorfstraße hinaus. Ich wandte mich gerade zum Gehen, da fragte sie noch: »Wie heeßt denn du?«
»Charitas.«
»Wie?«
Ich wiederholte, da lachte sie laut auf und sagt gönnerhaft: »A–h! Mach'mer doch nischt weis! Su albern heeßen doch keene Mädeln! Karekas, das war e beriehmter Reiberhauptmann. Mei Gottlieb hat mer die Geschichte vorgelesen. Hei! Das war aber ener! Ich hab'n abgebild't gesehn! E scheenes buntes Bild war derbei. Nee, nee, hier heeßen keene Madeln su, hier heeßen se Male, Christel, Moarie. Sul'n mer se Moarie heeßen?«
Die Frau, an die sie die Frage richtete, nickte gleichgültig.
Die Alte hatte mir ohne Umstände alles abgestreift, was mich mit der Vergangenheit verband. Ich kam mir vor wie ein Wechselbalg. Die beiden alten Leute blieben einige Wochen in der Dorfkrämerei. Sie bewohnten die Oberstuben. Der alte Mann erfreute sich einer gewissen Berühmtheit im Branntweinbrennen. Der junge Nachfolger sollte die Kunst beim Alten lernen. Ich stand, solange die Alten noch da waren, unter dem besonderen Regiment der Alten. Sobald früh um fünf Uhr das Glöckchen vom Huthause die Bergleute zur Schicht rief, war es mit meiner Ruhe vorbei. Ich konnte mir nur eben ein Röckchen überwerfen, da stand sie schon scheltend und keifend hinter mir und machte mir klar, daß ich zu allererst hinuntermüsse, um die Asche herauszunehmen, alsdann hätte ich Feuer anzuzünden, damit das liebe Vieh bald beschickt würde. Ich hörte von niemand ein freundliches, teilnehmendes Wort. Wenn ich nach Ansicht der Alten nicht flink genug war, so half sie durch Schubsen und Puffen nach.
Hatte ich gehofft, mir die Liebe des Kindes zu erwerben, so wurde ich auch darin getäuscht. Das welke, kränkliche Jungchen durfte ich höchstens Sonntags zu meiner Erholung warten. Es gab sonst soviel harte und ungewohnte Arbeit für mich, daß ich nur am Abend in die Stube kam.
In der großen, dunklen Küche wurde Branntwein gebrannt. Es wäre ein Motiv für einen holländischen Maler gewesen, zu sehen, wie wir in der rauchgeschwärzten, dunklen Küche arbeiteten. Auf dem offenen Herde loderten die brennenden, großen Holzscheite und warfen düsterroten Schein auf die nächste Umgebung. Bei dieser unruhigen Beleuchtung hantierten wir eifrig mit großen Steinkrügen und hohen Filzbeuteln. Der Alte trug dabei einen zerlumpten, karierten Schlafrock, dessen Länge ihm überall im Wege war. Er sprach mit heiserer Stimme eifrig und mit geheimnisvoller Wichtigtuerei auf Haubold ein und gab mit großer Überlegenheit seinen Rat. Ab und zu fuhr die Alte dazwischen, um mir, wie sie sagte, »Beine« zu machen.
Wenn der widerliche Dunst den düsteren Raum erfüllte, dann fühlte ich mich wie in einer Hexenküche.
Schon nach einigen Tagen wurde ein Handwagen angeschafft, ich wurde davor gespannt und mußte täglich, ausgenommen Sonntags, mit einer kleinen Tonne Branntwein nach Siebenlehn zu den verschiedenen Kaufleuten fahren. Für den Rückweg wurde der Wagen mit Krämerwaren und Dreierbrötchen gefüllt.
Mir schien, daß ich mich noch nie so fremd und einsam gefühlt hatte, wie hier. Unheimlich pfiff der Herbstwind über die kahle, steinige Ebene. Das Kartoffelkraut auf den Feldern war braun und dürr, ach, und wir gingen der schlimmen Jahreszeit entgegen, alles würde noch viel schwerer werden! Krächzend flogen die Raben über öde Stoppelfelder und schrieen mit heiserer Stimme: »Spa–a–r! Sp–a–a–r!« »Ach,« sagte ich fröstelnd, »ich muß wohl sparen, ich hab' ja gar nichts!« Traurig folgte ihnen mein Blick, bis sie in der Ferne verschwanden.
Täglich zog ich den Wagen. Oft mußte ich schon so früh auf die Wanderschaft, daß ich noch beobachten konnte, wenn das zarte Morgenrot am östlichen Himmel stand. Wenn's den Berg hinunter ging, mußte ich alle Kraft aufwenden, um den Wagen zu hemmen, dann konnte ich weder Raben noch Wolken beobachten. Kam ich in die Niederung, da sammelte ich Kräfte für die nächste Steigung. Hier ruhte ich aus. Zu beiden Seiten des Weges waren junge Kirschbäume gepflanzt, fein und dünn waren die Stämmchen, meine Hand konnte sie leicht umspannen. Sinnend betrachtete ich sie: würden sie den kommenden Stürmen widerstehen können? Ja, gewiß, jedes war an einen dicken Pfahl gebunden, o, sie hatten eine feste Stütze. Die hatte ich nicht.
»Vater und Mutter verlassen mich,« so klagte es in mir, darauf kam die leise Antwort: »Der Herr nimmt dich auf!«
Was? – wollte ich klagen? Hatte ich denn nicht erst vor kurzem in dem großen Buch gelesen, was die ersten Christen durchgemacht hatten, und wie mutig waren die bis zuletzt geblieben, in den Tod waren sie gegangen! So Schweres wurde ja gar nicht von mir verlangt. – Mit dem Lesen war es bei Haubolds ganz vorbei, aber ganz ohne ein gutgemeintes Wort konnte ich nicht auskommen. Unter die Branntweintonne hatte ich meinen geliebten »Joseph« geschmuggelt, wenn ich täglich auch nur einen Vers las und lernte, dann hatte ich doch etwas Gutes und Schönes, was mich innerlich den Tag über beschäftigte. Ich zog das Buch aus dem Heu, mein Blick fiel auf die Worte:
Ach, aus des Schmerzes Nebelflor
Hebt sich mein Blick zum Licht empor.
Diese paar Worte genügten mit für den heutigen Tag. Jetzt aber weiter! Ich nahm einen Anlauf, da merkte ich zu meinem Staunen sehr bald, daß es leicht ging, ich drehte mich um und sah, wie ein schmucker, rotbackiger Bursche den Wagen schob. Er rief mir treuherzig ein freundliches: »Glückauf« zu und fragte, ob er nicht ein bißchen schieben dürfe?
»Komm doch lieber mit hierher an die Deichsel und zieh mit, dann können wir uns dabei etwas erzählen,« sagte ich, erfreut, daß ich einem freundlichen Menschen begegnete.
Er fragte nach dem Woher und Wohin, und ich erfuhr von ihm, daß er »Junge« beim Steiger sei und Hermann heiße.
»Beim Steiger?« wiederholte ich.
»Ja, du weißt doch, was ein Steiger ist?«
Ich hatte in Siebenlehn gelegentlich vom Steiger und Schichtmeister sprechen hören, klar war mir aber nicht, was sie zu tun hatten. Der Junge sagte: »Der Steiger ist hier der Erste im Dorf, er wohnt gleich da oben, in dem Hause neben dem Kunstgetriebe.«
»Ist das das sonderbare Haus mit dem hohen Schornstein?« fragte ich.
»Gleich daneben. Im großen ist das Kunstgetriebe und die Anfahrstelle.«
»Die Anfahrstelle!« sagte ich sinnend, »hier im Dorf ist wohl nur Bergbau?«
Der Junge nickte lebhaft und fragte: »Hast du das ganz kleine Haus gesehen, was halb in den Berg hinein gebaut ist? Das ist das Pulverhaus, und das auf dem Hügel, mit den braunen Balken, das ist das Huthaus.«
»Darin werden die Andachten abgehalten, eh' die Bergleute hinunterfahren, sie stellen sich hier erst unter Gottes Hut, siehst du. Hörst du nicht das Singen von euch aus?«
»Ja, ich höre es, und ich höre, wenn früh und abends das Glöckchen läutet, sonst macht es Tag und Nacht: Rrrr–ting! – Rrrr–ting!«
Der Junge lachte und sagte: »Ja, wirklich, so klingt es auch! Aber weißt du, wenn es mal nicht so macht, dann ist in der Grube ein Unglück passiert.«
»Wie heißt eure Grube? Unsere heißt Romanus.«
»Das weiß ich. Unsere heißt: Alte Hoffnung Gottes.«
Unter solchen Gesprächen hatten wir das Städtchen erreicht, und der Junge verließ mich. Ich wanderte mit meinem Wagen von einem zum andern, und als ich gerade aus dem Bäckerladen heraustrat, stand Fanny dicht vor mir.
»Fanny!« rief ich hocherfreut, schüttete die Dreierbrötchen in den Wagen und ging mit ausgestreckter Hand auf sie zu. Ach, wie ich mich freute! Aber – was war das?! Sie drehte sich schweigend um und ging weiter. – Ich verstand es nicht. Sie hatte nicht die ausgestreckte Hand gesehen, sie hatte nicht meine freudig erregte Stimme gehört, sie hatte keinen Blick, kein Wort für mich! Was war das nur? Ich sah ihr nach, dann ging ich schweren Schrittes an den Wagen. Da wurden mir von hinten die Augen zugehalten, und eine neckische Stimme fragte: »Wer bin ich? Rate doch!«
Ich war so traurig, daß es mir unmöglich war, auf den Scherz einzugehen.
»Kennst du denn meine Stimme gar nicht mehr?«
Es war das Größel-Helenchen.
»Willst du denn noch mit mir sprechen?« fragte ich traurig.
»Wir haben doch nichts miteinander gehabt,« sagte sie.
»Sahst du denn nicht eben Fanny?« fragte ich erregt.
»Ich hab' dir doch immer gesagt, wie die ist!«
Lenchen legte sich den Zugriemen über die Brust und sagte auf meinen erstaunten Blick: »Laß mich nur, heute ziehe ich den Wagen den halben Weg nach Voigtsberg, und du gehst nebenher und erzählst mir, wie es dir da geht.«
Und Lenchen zog tapfer den Wagen über den Marktplatz zur Stadt hinaus, und ich schüttete all meine Sehnsucht, mein Heimweh in ihr mitleidiges Herz, so daß ich wieder ganz getröstet wurde.
»Was du für geschwollene Hände hast!« sagte sie teilnehmend, »du bist solche Arbeit ja auch gar nicht gewohnt. Wenn du wieder zur Stadt kommst, so besuch' uns mal, meine Eltern wollen gern mal mit dir sprechen, sie bedauern dich so!«
Sie wischte mir mit ihrem Tuch die Tränen ab, und streichelte mich. Dann nahm sie Abschied, und als ich mich umdrehte, stand sie noch immer und winkte mit dem Tuch.
Auf meinen Wegen nach Siebenlehn hatte ich häufig Gesellschaft. Wer gerade des Weges kam, meist waren es Bergleute, knüpfte ein Gespräch an, das ich nur zu gern weiterspann. Ich lernte auf die Weise die meisten Bewohner des Dörfchens kennen, und umgekehrt war auch ich bald den Leuten keine Fremde mehr.
Einmal aber horchte ich hoch auf, als eine bekannte, schüchterne Stimme neben mir sagte: »Guten Tag, Charitas! Nun, wie geht es dir denn? Wohl nicht gut, scheint mir. Ich mußte doch mal sehen, was du treibst.«
Zu meinem großen Staunen war es Donath.
»Weißt du wohl,« fuhr er fort, »daß du mal gewünscht hast, das Gedicht von Myrtills zerfallener Hütte aufgeschrieben zu besitzen?«
Ich wußte es nicht mehr, aber ich hielt den Wagen an und nahm dankbar die Blätter in Empfang. Ein Blick auf die vielen Verse zeigte mir, mit welcher Sorgfalt sie geschrieben waren, die Schrift war wie gestochen. Jemand hatte sich soviel Mühe meinetwegen gemacht, das trieb mir die Tränen in die Augen. Ich steckte das Gedicht in meinen Joseph.
»Du gehst jeden Tag diesen Weg? Ist das nicht langweilig?«
»Nein, nur sehr beschwerlich, wenn das Wetter recht schlecht ist.«
Donath nickte, dann sprachen wir von Vater und Mutter und vom Forsthof. Dann sagte er, wenn es mir Freude mache, das eine oder andere Gedicht zu besitzen, wenn ich Wünsche hätte, er würde mir gern mehr abschreiben und sie mir auf dieselbe Weise bringen. Ich hatte keine Wünsche, und so nahmen wir vor Siebenlehn herzlichen Abschied.
Auf die Weise fand ich auf den sonst oft mühseligen Wegen doch auch Blumen. Es waren nur Blumen gewöhnlicher, harmloser Art, Giftblumen waren nicht dazwischen, etwa bleiche Hungerblümchen und farbloser Wegebreit, aber doch brachten sie Freude und halfen mir das einsame Grau des Alltags zu ertragen.
Große Not machte mir in Voigtsberg der Wassermangel. Der Trog, den mir die Alte am ersten Tag gezeigt hatte, war von den paar Anwohnern stets belagert, aber der fingerdicke Strahl war nicht imstande, den Bedarf zu befriedigen.
Und wir brauchten soviel Wasser!
Von Silbermanns und Heymanns, den zwei Bauernhöfen, ging die Sage, sie hätten Wasser. Obgleich der Weg weit war, versuchte ich da zu schöpfen, aber ich wurde fortgewiesen. Ich irrte mit meinen leeren Kannen suchend bei den Bergwerksgebäuden umher, da begegnete mir Hermann. Ich klagte ihm meine Not, er lachte und zeigte mit pfiffiger Miene auf ein niedriges, verschlossenes Bretterhaus.
»Da?« sagte ich und trat nahe heran, ich hörte von drinnen ein ganz leises Rauschen.
»Wasser!« rief ich erregt, »aber man kann nicht daran.«
»Ich hab' den Schlüssel!« sagte Hermann, »soll ich?«
»Ja, ja, Hermann, schließ doch auf!«
Und er schloß großmütig auf, der Trog war voll, und ich durfte schöpfen.
Wie dankbar war ich für das Geschenk.
Hermann sagte: »Jeden Tag darfst du nicht kommen, aber wenn du in Not bist, ruf mich nur, ich schließ' dann auf.«
Er hat mir oft aufgeschlossen, und ich war ihm so dankbar!
Abends entfaltete sich in der großen Wohnstube ein ganz eigenartiges Leben. Die Stube füllte sich mit Bergleuten. Wären andere, alltägliche Dorfbewohner gekommen und hätten sich über Tagesereignisse unterhalten, so wäre ich nach der vielen Bewegung in freier Luft und nach der ungewohnten Arbeit sicher eingeschlafen, so aber wurde ich durch das ungewöhnliche, was ich erlebte, hell wach gehalten, ich wollte doch kein Wort von dem verlieren, was hier geredet wurde. Beim dämmernden Schein einer altmodischen, hochbeinigen Blechlampe, die in einfachster Weise mit Öl gespeist wurde, da man Petroleum noch nicht kannte, saß ich mit Tütenpappen, mit Kaffee- oder Rosinenverlesen beschäftigt, mit am großen Tisch und erlebte, wie sich die Stube füllte.
Ich lernte ein eigenartiges Völkchen kennen, das hier nach seiner seltsamen Arbeit in bescheidenen Grenzen seine Erholung suchte. Eine Welt voller Wunder und Poesie brachten die bleichen Gestalten mit sich. Sie gaben sich fromm, abergläubisch, treuherzig, klug in allem, was ihren Beruf anbetraf. Wie wußten sie die nüchterne Stube der Dorfkrämerei mit den haarsträubendsten Geschichten zu beleben. Sie verzehrten ein Dreierbrötchen und einen marinierten Hering, dazu gehörte ein herzhafter Schluck, und den bekamen sie in kleinen Zinngefäßen. Dabei wurde die Kunst des Alten gerühmt. Schlimme Wirkungen von diesen »Schlückchen« habe ich nicht erlebt. Es war für mich eine Zauber- und Märchenwelt, in der sich ihre Reden bewegten. Ich war abends so erregt, es war, als ob dann meine Seele aufwachte. Ich konnte nicht unterscheiden, wo Wirklichkeit und Dichtung ihre Grenzen hatten.
Der Aufenthalt hier war durchaus verschieden von dem in andern Dörfern, wo ich vorübergehend gewesen war. Da hatte man über Wetterverhältnisse, Viehpreise, Ernte, Lustbarkeiten oder über besondere Familienereignisse gesprochen. Das waren alles Dinge, die sich unter uns allen abspielten, von denen wir umgeben waren.
Wie anders hier! Die Bergleute erzählten von schlagenden Wettern, von versoffenen Gruben, von stehendem und hängendem Gestein, von Teufen und Gezeugstrecken. Sie erzählten aber mit demselben Ernst von schlohweißen Frauen, von neckenden Koboldchen und langbärtigen Berggeistern, die ihnen in der Grube zu jeglicher Zeit erschienen und sie ängstigten. Manchmal, so erzählten sie, nahm das Koboldchen auch allerlei Tiergestalt an, bald erschien es als riesenhafter, schwarzer Kater mit tellergroßen, feurigen Augen, bald als häßlich krächzender Vogel oder als harmlos scheinendes Mäuschen. Alle diese Erscheinungen traten auf, wenn es sich um einen reichen, neuen Anbruch handelte. Für ihre Dienste stellten sie nur geringe Forderungen, vor allen Dingen hielten sie auf strenge Verschwiegenheit, nichts dürfe ausgeplaudert werden. Wenn sie ein Ziel zeigten, so verlangten die Geister ein unverrückbares Drauflosgehen, Abschweifen oder gar ein Rückwärtsblicken wurde schwer bestraft. Einer erzählte: »Da geh' ich so in Gedanken den dunklen Gang entlang, plötzlich wird es hell; ein kleines, bärtiges Männchen sitzt vor mir, hat Bergmannszeug an, der weiße Bart reicht ihm bis an die Knie, er sitzt vor einer Backschüssel voll großer Silbermünzen, groß und altmodisch waren die Silberstücke, runde und viereckige Münzen lagen in großen Haufen vor mir. ›Nimm sie,‹ sagte der Geist, ›aber sag keinem Menschen davon!‹ Ich wußte mich vor Freude nicht zu lassen und rief, während ich mich nach meinem Hintermann umsah: ›Sieh doch nur, August!‹ Da war das Licht aus, ein lauter Knall, auch meine Blende war erloschen, und ich kann von Glück sagen, daß ich lebendig ans Tageslicht kam.«
Jeder schien diese Geschichten zu glauben und hatte auch seinerseits etwas Ähnliches zu erzählen. Ich war bei solchen Geschichten ganz aufgeregt. Warum gingen diese einfachen Forderungen der Koboldchen über die Kraft der Bergleute? Warum konnten sie nicht schweigen? Warum konnten sie ihr Ziel nicht ohne Rückwärtsblicken verfolgen, weshalb mußte erst giftiger Odem sie anhauchen? Manchem hatte diese Schwäche sogar das Leben gekostet.
Alle Geschichten endeten tragisch, und ich war innerlich empört, daß diese Männer nicht mehr Gewalt über sich hatten. Wenn ich nur einmal hinunter dürfte! Bange war ich nicht, vielleicht hätte ich Glück, und ein Koboldchen schenkte mir seine Gunst und etwas von seinen Schätzen, ich würde doch nicht so dumm sein und es ausplaudern! Sie erzählten aber auch von tatsächlichen Funden, die hatten sie aber ohne Hilfe von Geistern gemacht. Sie schilderten lebhaft die Silberadern des rotgültigen Erzes. Der eine und andere brachte auch wunderhübsche Steine mit, das waren keine Trugstücke, ich konnte sie mit Händen greifen.
Der Steiger breitete eines Abends eine Karte aus, auf der man die innern Gänge des Schachtes verfolgen konnte. Mit dicken roten und blauen Linien waren da Haupt- und Nebengänge bezeichnet, die wie Straßen einer Stadt sich durchkreuzten und durchquerten.
Diese Gänge bezeichneten sie mit seltsam klingenden Namen. Sie sprachen vom Einigkeiter Morgengange, von dem in Christi Hilfe stehenden, vom Peter- und Andreasgange.
Ach, wie wurde an solchen Abenden meine Phantasie erregt!
Nachts verfolgten mich die Geschichten, sie verwebten sich in meine Träume. Wenn ich im Dunkeln früh herunterkam und die Asche auf den Schutthaufen trug, dann war mir, als träume ich weiter. Wohin ich sah, bewegten sich Bergleute mit ihren Blenden. Wie schwirrende Glühwürmchen leuchteten sie im kalten Dunkel des Wintermorgens. Die über den Hof schritten, riefen treuherzig: »Glück auf, Moarie!«
Bald klang vom nahen Huthaus der fromme Gesang durch das Dunkel des winterlichen Morgens.
Dicht am Brunnen, wie mir die Alte schon gesagt hatte, stand ein Häuschen, weiß gekalkt, mit hellblauen Balken. Während der fadendünne Wasserstrahl in die Kanne lief, spähten meine Blicke nach den kleinen Fenstern. Zwischen den Blumenstöcken zeigte sich häufig ein Gesicht, bald war es ein junges, bald ein altes.
Wie ruhig und friedlich sah es von draußen aus, unwillkürlich beschäftigten sich meine Gedanken mit den Bewohnern.
Eines Tages stand ich wieder und spähte hinter die Blumenstöcke, da tauchte diesmal das alte Gesicht auf. Ich nickte der ältlichen Frau einen Gruß zu, sie hatte es gesehen, ihr Gesicht kam dicht an die Scheiben, sie winkte.
Schnell wechselte ich die Kannen und trat befangen und zaghaft in das Häuschen. Die Alte hielt die Stubentür offen und reichte mir freundlich die Hand. Wie warm, sauber und friedlich war es in dem kleinen dämmerigen Stübchen! Das verschrumpelte, runde Kindergesichtchen sah aus wie ein rotbackiges, welkes Äpfelchen. Die blonden, dünnen Scheitel waren schon leicht ergraut. Alles war leise und gedämpft, nicht nur die Stimme und der Tritt, sondern auch die Farben. Sie ging leise auf Filzschuhen, der faltige, kurze Rock und die weite Jacke waren aus haarigem, dunklem Stoff verfertigt. Trotzdem die Hände krumm und rauh von der Arbeit waren, so war die Berührung, als sie mir sanft über den Scheitel strich, doch lind und zart. Es war etwas echt Mütterliches in ihrer ganzen Art. Mir kamen die Tränen in die Augen, wie lange war es her, daß jemand mich freundlich angesehen hatte: »Du bist ja wohl mit den neuen Kramerschleuten gekommen. Heeßt du nich Moarie?«
Sie wußte schon von mir? Das wunderte mich. Ich schüttelte den Kopf und sagte: »Nein, Charitas.«
»Nu so was! Das is e närrscher Name, aber du läßt dich doch am liebsten so rufen, wie de getooft bist. Mir woll'n dich hier so nennen, wenn de bei uns kimmst.« Sie sprach denselben Dialekt wie die andern auch, und doch wie gemütvoll und herzlich klang er aus ihrem Munde!
»Warum siehste denn egal so traurig aus?« fuhr sie fort, »dich friert's wohl, geh ran an'n Ofen und wärm d'r de Hände! Haste Heemweh?«
Ich nickte. Die Frau seufzte, nickte mir ernst zu und sagte mit verhaltener Stimme: »Ach ja, das Heemweh! Das kann de Menschen reene umbringen! Oben liegt eene, die hatte ooch egal Heemweh, nu wurd' se noch krank derzu, mir dachten aber, se müßt's iberwinden, weil se so e weeches Gemiet hatte. Nu hat se iberwunden, aber andersch, wie mir es dachten. Kumm mal mit nuf, du sollst se doch sehen, s' is 'r doch ooch wie dir gegangen.« Befangen und unsicher folgte ich ihr die kleine Treppe hinan.
Die Kammertür stand offen, und auf sauberem Strohlager ruhte eine Gestalt, die nur wenig älter sein mochte, wie ich selbst. »Siehste, das is unsre Christel!« sagte die Frau und streichelte zärtlich die starren, wachsbleichen Hände, die zwischen den gefalteten Fingern ein Zweiglein Buchsbaum hielten. »Nu haste kee Heemweh mehr, nich wahr, Christel? Gott reicht dir selbst die Palmen in deine rechte Hand, und du singst Freudenpsalmen, dem, der dein Leid gewandt!«
Die Frau trat etwas vom Lager zurück und weinte still vor sich hin, sie zog mich sanft nach sich und sagte: »Komm, komm! Laß ja keene Träne uf die Tote fallen, sunst hat se im Grabe keene Ruhe! Wir derfen uns ooch nich uflehnen, unser Herr Pfarrer sagt:
Er nimmt und gibt,
Weil er uns liebt.
Laßt uns in Demut schweigen,
Und vor dem Herrn uns beugen!«
Ich weinte heftig. Die unerwartete Nähe des Todes, die ärmliche Feierlichkeit, die fromme Ergebung der Frau, meine eigne verlassene Lage, das alles erschütterte meine Seele mächtig. So jung konnte man sterben! Unser Los war ja ein ähnliches gewesen. Freilich, sie hätte es besser haben können, sie hatte ein Heim, und all die Ihren waren beieinander. Sie riß eine Lücke, sie wurde schmerzlich vermißt. Warum hatte Gott sie, und nicht mich gerufen? Ich war ja so überflüssig, keiner brauchte mich. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, und seine Wege sind nicht unsere Wege. Möchte ich wirklich hier an Christels Stelle liegen?!
»Ja, in Freiberg, in der großen, lauten Stadt is se gestorben,« unterbrach die Frau meinen Gedankengang. »Mir wußten ni, wie schlimm es mit ihr stand. Freili, den Nachmittag, wie se starb, hat mich's geahnt. Ich hatte so en häßlichen Drom. Mir wurde unter großen Schmerzen e Zahn ausgezogen. Da wußte ich glei, daß was mit der Christel passiert war, noch dazu, wie nu ooch de Uhr stehen blieb. Ja, ja, 's hat Anzeechen gegeben! Das is su, wenn ener sterbt. Sonntag wull'n mer se in Scherme (Großschirma) begraben. Du tust ihr doch de letzte Ehre an? Komm nur, da lernst de ooch de Gustel und den Fritz kennen. Komm aber ooch sunst zu uns, etwa am Sonntag, wenn de deine Sache gemacht hast. Hier kannst de von derheeme erzählen. Ich denk; dich hat de Christel geschickt. Warte mal, hab' ich denn nischt, womit ich der 'ne kleene Freide machen kann?« Sie kramte in einer Schublade und sagte: »Der Vater hat neilich der Christel das rote Kopftüchel gekooft, das sollst du erben, von uns kann's doch jetzt keener tragen.« Sie händigte mir ein leuchtendes Kopftuch aus, mein Erbe von Christel, die ich nur im Tode kennen lernte. Als ich nach Hause ging, dachte ich an die Worte meiner Mutter: »Gott erweckt dir Nothelfer in guten Menschen.«
Am folgenden Sonntag kam das Begräbnis, woran, wie mir schien, die ganze Gemeinde teilnahm.
Die Bergknappen in ihrer schwarzen, kleidsamen Tracht trugen den Sarg. Der Lehrer kam mit seinen Schülern. Um das Kruzifix wehte der Trauerflor, und die jugendlichen Stimmen sangen:
»Leb' wohl, leb' wohl, du Bergmannskind!
Du hast vollbracht den Lauf.
Treu warest du und gut gesinnt,
Drum rufen wir: Glück auf!
Doch schloß sich auch dein Auge hier,
Dort tut sich's wieder auf.
Wir alle, alle folgen dir
Und grüßen dich: Glück auf!«
Ich saß in der Oberstube, zwischen vielen fremden Gestalten. Vor uns stand der schlichte Sarg, an den Sargenden brannten dünne Wachslichter. Schweigend tranken wir Kaffee unter den Klängen des bekannten Sterbeliedes.
Die Dämmerung brach schon fast herein, als sich der traurige Zug in Bewegung setzte. Sehr lang kam mir der Weg vor, denn wir kamen nur langsam vorwärts, da die Träger öfters stillhielten und einander abwechselten. In dicken Flocken fiel vom dämmernden Himmel der Schnee hernieder, er legte sich weich auf das schwarze Bahrtuch, er legte sich auf die schwarzen Bergmannskittel, und frisch und flockig lag er auch in dem Grabe, wo hinein man jetzt mit Gesang, Grabrede und Gebet die so früh geknickte Menschenblüte bettete.
Im Dunkeln traten wir den Heimweg an. Hand in Hand gingen Gustel und ich. Die trauernden Geschwister erzählten mir mit Liebe von der Heimgegangenen. Mir war der Gang zwischen den vielen dunklen Gestalten auf dem unbekannten Wege, verbunden mit der Erzählung über jemand, den ich nicht gekannt und nie kennen würde, etwas so Traumhaftes und Sonderbares, daß ich den Gang nie vergessen habe. Gustel war ein eben konfirmiertes Kind wie ich auch. Sie hatte ein frisches, rotbackiges Kindergesicht, über welches jetzt die Trauer eine sanfte Wehmut breitete. Beim Scheiden luden mich Bruder und Schwester freundlich zum öfteren Besuch ein.
Lehmann war königlicher Erzwagenbegleiter, ein Titel, der mir mächtig imponierte. Wenn ich Sonntags mit aller Arbeit fertig war, durfte ich zu meinen Freunden gehen. Ich wurde jedesmal mit großer Freude und Herzlichkeit aufgenommen. Wir saßen auf der Ofenbank, und Mutter Lehmann kochte einen unerschöpflichen Kaffee, der mich bald alle Sorgen vergessen ließ. Hier fand ich Liebe in reichem Maße, und ich war so freudehungrig, ich schloß mich mit stürmischer Zärtlichkeit an die alten und jungen Lehmanns an. Bald hieß es: »Erzähl' was,« und danach: »So, nun sing noch ein bißchen.« Und ich erzählte die Geschichte von »Johanna« mit dramatischer Begeisterung. Ich schenkte meinen Zuhörern nichts, jede Stimmung, jede Situationsschilderung wurde in ausführlichster Weise vorgeführt. Ich spielte auch Theater, am liebsten aber sang ich ihnen alle Lieder vor, die ich beim Pastor in der Singstunde gelernt hatte. Gelegentlich sangen wir auch alle zusammen die schönen Bergmannslieder. Ich war an solchen Abenden wie berauscht, ich mußte ja aber auch schnell zugreifen, wenn mir eine Gelegenheit zur Freude geboten wurde, denn eine schwere Woche ohne ein freundliches Wort voll harter Arbeit folgte einem solchen glücklichen Abend.