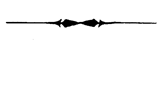|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Endlich kam der Pastor und alle drei machten sich nun auf den Weg. Es war sehr heiß geworden, sie gingen langsam.
»Wie gefällt Ihnen unsere Kirche?« fragte der Pastor nach einer Weile.
»O, sie ist für eine Landkirche sehr zierlich und hübsch. Zumal der Thurm.«
»Wirklich! Finden Sie das?« rief der Onkel erfreut, während Lelia vor sich hin lächelte.
»Sehen Sie, Eichenstamm, als ich hierher kam, da sah meine Kirche gar jämmerlich aus, denn sie war unsauber, verfallen und hatte nicht einmal einen Thurm. Das wurmte mich nicht wenig. Sollte meine Gemeinde wirklich nicht im Stande, oder wohl gar nicht Willens sein, ihr Gotteshaus würdig auszuschmücken, dachte ich. Aber wo das Geld hernehmen, nicht nur für den Bau, sondern auch für alle die Pläne, Vorschläge und Unterlegungen, mit denen uns die mütterliche, hütende Weisheit der Bureaukratie in solchen Fällen bedenkt. Meine Gemeinde ist klein und arm, der Boden, auf dem und von dem sie lebt, ist unfruchtbar, ich selbst habe auch nichts übrig. Aber nun, ich dachte, wenn ein Mann nur etwas recht will und fängt es an mit einem Gebete, so muß es auch gehen, und begann getrost meine Sammlungen, die anfangs nur wenig, dann aber, nachdem es mir gelungen war, ein paar einflußreiche Wirthe für den Bau zu interessiren, mehr einbrachten. Als ich ungefähr ein Viertel der für den Bau nöthigen Summe zusammen hatte, begann ich an die Ausführung zu denken. Aber wo den Plan dazu hernehmen? Da fiel mir ein, daß einer meiner Universitätsfreunde Architekt geworden war und als solcher in der Stadt lebte. Ich fuhr also zu ihm und trug ihm meine Bitte vor. Er fertigte mir den Plan denn auch um Gottes Lohn an, gab mir auch einige praktische Rathschläge mit in den Kauf und so begann ich getrost den Bau. Sehen Sie, ich habe ihn doch richtig zu Stande gebracht und habe nun, so oft ich die Kirche ansehe, die größte Freude an ihr, denn als erst der Thurm da war und die Sonne auf den Blechplatten seines Daches glänzte, da wollten die Bauern selbst auch die Kirche geweißt haben und jetzt sammeln wir gar für ein Altarbild, nachdem wir im vorigen Jahre unsere alte Orgel haben erneuern lassen. Das Komische aber an der Sache ist, daß die Baucommission von alledem gar nichts weiß und die Herren im Schloß sich einbilden, daß ich noch immer in einer schmutzigen, häßlichen Kirche ohne Thurm predige, obgleich aus meinem verwahrlosten Bethaus diese stattliche Kirche geworden ist.«
Der Pastor und Lelia lachten herzlich.
Nichts gefiel Heinz im Pastorat überhaupt so sehr, als die Liebe, die seine Bewohner Allem zuwandten, was sie umgab, es mochte nun Mensch, Thier oder Pflanze sein. Ihnen bot das Leben tausend kleine Freuden und sie erhöhten sie noch, indem sie Alles mit einander theilten. Die Genesung eines kranken Bauern, die Geburt eines Kalbes oder Lämmleins, das Auffinden eines Vogelnestes, das Erblühen einer Blume, das Alles waren Ereignisse, an denen die ganze Familie den lebhaftesten Antheil nahm. Der Eine theilte dem Andern seine Beobachtungen und Erwartungen mit und wenn die Dinge den erhofften Verlauf nahmen, so waren Alle voll Fröhlichkeit.
Damit nicht genug, ein Jeder wußte noch dem Andern eine Extrafreude zu bereiten. Dem Großvater eine besonders feine Decke weben zu lassen, das war ein Wunsch, den man Jahrelang mit sich herumtrug, bis er sich endlich zu gelegener Zeit in Werk setzen ließ. Aber welch' eine Freude verursachte auch solch eine Decke! Wie wurde sie vom Empfänger sorgfältig zwischen Daumen und Zeigefinger geprüft und dann wieder geglättet! Wie lange wurde noch gelegentlich darauf angespielt, daß man sich ja jetzt nicht sonderlich viel aus einem kalten Zimmer zu machen brauche, da man ja die neue warme Decke habe.
Wahrlich, Heinz hatte Recht, das Pastorat war ein Paradies, denn seine Bewohner pflückten Blüthen von jedem Busch und Früchte von jedem Baum.
Am Nachmittage, als der Vater sich zu einem Mittagsschläfchen hingelegt hatte, führten Lelia und die Kinder Heinz zu allen ihren Lieblingsplätzchen und zeigten ihm, was ihnen irgend bemerkenswerth schien. Als sie an den Taubenschlag kamen, mußte Heinz zuerst die Leiter hinaufsteigen und die Thür öffnen. Lelia folgte ihm und da auf der nicht breiten Leiter nur wenig Platz war für Beide, so legte sie unbefangen ihren Arm um seine Taille und hielt sich an ihn.
»Siehst Du die neuen Nestkasten dort, Heinz?« fragte sie, indem sie zu ihm aufsah; »hast Du solche schon gesehen?«
Der Blick, der aus seinen großen, ernsten Augen auf sie fiel, war so freundlich und warm, daß sie vor Vergnügen erröthete.
»Hast Du diese Art Nester schon gesehen?« wiederholte sie verwirrt.
»Nein,« erwiderte er nachdenklich und sah, statt auf die Nestkasten zu blicken, auf die Sprecherin.
Die Sprosse, auf der sie standen, bog sich unter der doppelten Last ein wenig und sie hielt sich fester an ihn.
»Siehst Du,« sagte sie, »die habe ich zu vorigem Weihnachten eigens für Großvater verschrieben.«
»Woher denn?«
»Denke Dir, aus Berlin. Ich hatte in Brehm von ihnen gelesen, es steht dort auch die Adresse des Tischlers, bei dem man sie bekommt, und so verschrieb ich mir eins und ließ dann die andern darnach machen. Ich hätte gar nicht geglaubt, daß das so leicht geht, sich etwas aus Berlin zu verschreiben. Aber nun wollen wir wieder hinuntersteigen.«
Sie stiegen hinab und setzten ihren Umgang fort. Man ging zu den Kälbern, die Lelia entgegengestürzt kamen, sobald sie sich der Koppel näherten, denn sie waren gewohnt, von ihr mit Brod gefüttert und geliebkost zu werden, und begab sich dann zu den Entlein und fütterte auch sie.
Heinz ging überall mit hin. Ihm war sehr traurig und doch auch sehr glücklich zu Muthe, und Lelia ging es nicht viel anders, denn wenn sie sich auch freute, daß der traurig blickende Heinz mitunter so freundlich lächelte, so erkannte sie ihrerseits doch, daß ihn tiefes Herzeleid drückte.
Der folgende Tag war für die Bewohner des Pastorates ein sehr trauriger und aufregender. Die Leiche des Kutschers wurde fortgebracht und Frau Amanda und Madeleine langten an; mit ihnen natürlich viel unnütze, schädliche Unruhe und müßiges Hin- und Herlaufen. Horace's Zustand verschlimmerte sich durch die Aufregung des Wiedersehens und die Aerzte (es wurden ihrer jetzt täglich zwei aus der Stadt geholt) fingen an, bedenkliche Gesichter zu machen. Lelia war von der Wirthschaft stark in Anspruch genommen, aber sie fand doch noch Zeit, ihre Kleinen täglich zu unterrichten. Heinz wachte jetzt fast allnächtlich bei Horace und ließ sich durch kein Zureden davon abbringen. Wenn die Krankenpflege ihn freiließ, dann beobachtete er Lelia voll Bewunderung. Sie leistete fast das Unmögliche und war doch nie ungeduldig. Dabei hatte sie eine wunderbare innere Heiterkeit, die sie nie, auch nicht auf einen Augenblick, verließ. Es gab in den bunten Verhältnissen des Augenblicks so manchen Anlaß zum Verdruß, aber Lelia schien das gar nicht einmal zu empfinden. Die Fremden nahmen das sehr dankbar auf und zumal Madeleine schloß sich ganz an sie. Es ging ihr wie Heinz – sie fanden Beide hier, wonach sie sich so sehr gesehnt hatten, ein warmes, jedem Nächsten offenes Menschenherz, und besonders Madeleine war über die neugeschenkte Freundin sehr glücklich. Heinz und Madeleine sprachen kaum je ein Wort mit einander und Jedes war wie verwandelt, sobald das Andere in's Zimmer trat. Lelia, die das seltsame Verhalten Beider bald bemerkte und die von ihrer Lectüre her wußte, daß die Liebe sich auch wohl als Abneigung verkleidet, war geneigt, auch in diesem Falle an eine solche Maskerade zu glauben, aber Manches, was sie gelegentlich sah, mußte sie doch darin irre machen, und es schien ihr dann wohl, als ob den Vetter tieferes Leid drücke, als verlorene Liebesmühe. An Madeleinens Empfindungen konnte sie übrigens bald nicht mehr zweifeln, denn wenn auch ihr Betragen Heinz gegenüber kalt und gemessen war, so redeten ihre Blicke doch eine, für jede weibliche Beobachterin verständliche Sprache.
Endlich war Horace über jede Gefahr hinaus und Heinz konnte auf ein paar Tage nach Hause fahren. Der Großvater, der Pastor und Lelia begleiteten ihn bis vor die Thür und Lelia sagte, als der Wagen vorfuhr: »Was Du für hübsche Pferde hast!«
Heinz lächelte. »Findest Du?« fragte er. Er versprach bald wiederzukommen und fuhr davon.
Als er zu Hause angekommen und aus dem Wagen gestiegen war, ging er, ehe er in's Zimmer trat, noch zu den Pferden, klopfte sie auf den Hals und streichelte ihre Mähnen glatt. Nach einiger Zeit kam er dann, was er bisher nie gethan hatte, mit einem Stück Brod zu den Thieren in den Stall und fütterte und streichelte sie, so daß Weinthal, der seines Herrn Gewohnheiten genau kannte, große Augen machte. Warum thut er das? dachte Weinthal. Sonst ging er doch immer nur in den Stall, um nachzusehen, ob Alles in Ordnung sei.
Noch größer wurde übrigens seine Verwunderung, als sein Herr jetzt diese Procedur täglich wiederholte und den Pferden eine ganz ungewohnte Aufmerksamkeit zuwendete.
Die trockene Zeit hielt mittlerweile noch immer an und so sehnsüchtig auch die Landwirthe zum Himmel emporblickten, es wollte sich keine Wolke zeigen. Die Folgen der Dürre traten bald aller Orten zu Tage. Schon Anfang Juni war das Gras auf den Wiesen verdorrt und die spärlichen Halme des Wintergetreides begannen eine gelbliche Färbung anzunehmen. Der Wasserstand des Flusses war ein so niedriger, daß eine Menge Steine ihre grauen Häupter über die Oberfläche des Wassers erhoben, welche auch die ältesten Leute nie trocken gesehen hatten und die Fähren eine gute Strecke vom Ufer anhalten mußten, weil sie in Folge der Seichtheit des Wassers nicht näher gebracht werden konnten. Bald verdunkelte sich auch die Sonne, denn aus den Wäldern und Torfmooren stiegen ungeheure Rauchwolken auf, die Zeichen verheerender Waldbrände, und erfüllten die Luft mit ihrem Brandgeruch.
In den Nachmittagsstunden eines dieser Tage saßen Lelia und Madeleine an der hinteren, dem Obstgarten zugekehrten Seite des Hauses und waren damit beschäftigt, Erbsen aus den Schoten zu entfernen (bei uns sagt man »Erbsen zu bolstern«). Der Tag war unerträglich heiß und die Luft von Rauch erfüllt, so daß die Sonne aussah, als ob man sie durch ein geschwärztes Glas betrachte. Der Rauch der Waldbrände im Westen und Norden erfüllte im weiten Umkreise das Land.
Die beiden jungen Mädchen betrieben ihre Arbeit sehr verschieden, denn während Lelia mit den Schoten umging wie eine Hausfrau, der es darauf ankommt, daß ihre Aufgabe möglichst rasch und gut beendet werde, hielt Madeleine ein Paar geleerte Schoten in der Hand, schlug sie langsam gegeneinander und sah vor sich hin.
»Wissen Sie nichts Genaueres darüber?« fragte Lelia weiter.
»Nein, ich bin überzeugt, daß auch mein Bruder nicht mehr weiß. Er hat sie verlassen und sie ist gestorben, – weiter geht auch seine Kenntniß nicht.«
»Ob Ihr Bruder sie gesehen haben mag?«
»Nein.«
Sie schwiegen Beide eine Weile. Lelia bolsterte eifrig. Sie nahm aus einem zu ihrer Rechten stehenden Eimer die Schoten, ließ die Erbsen in eine Schüssel fallen, die in ihrem Schooße ruhte, und warf dann die geleerte Schote in ein Gefäß zu ihrer Linken. Madeleine wickelte sich eine Schote um den kleinen Finger und rollte sie dann wieder auf. Beide sahen sehr nachdenklich aus.
»Einerlei,« rief Lelia endlich sehr entschieden, »was auch immer der Grund der Trennung gewesen sein mag, daß mein Vetter sie nicht ohne Grund verlassen hat, das steht fest.«
»Gewiß,« meinte Madeleine. »Zweifellos hat sie ihm dazu dringende Veranlassung gegeben. Ihr Vetter ist nicht der Mann dazu, ein Mädchen, das er liebt, einfach zu verlassen. Aber warum ist er (Madeleine sprang auf und ließ die Schoten fallen), warum ist er so unleidlich verschlossen! Ich weiß ja sehr wohl, daß er mich nicht liebt, ich weiß auch sehr gut, daß er ein so oberflächliches und unbedeutendes Wesen, wie ich es bin, nicht lieben kann, aber warum will er mir nicht gestatten, ihn zu lieben? Warum soll ich ihm nicht zeigen dürfen, wie sehr ich ihn verehre und liebe? Ach, Lelia, Sie glauben nicht, wie ich ihn liebe! Ich wünschte, er fiele in den Ocean – wohlan, ich verstehe nicht zu schwimmen, aber ich würde ihn doch retten. Bei Gott, ich würde ihn retten oder mit ihm untergehen und das wäre dasselbe. Ich wünschte, er wäre in einem brennenden Walde, ich würde ihn retten oder mich in die Flammen stürzen.«
Lelia blickte verwundert zu der Freundin empor, die ihre Worte mit dem lebhaftesten Geberdenspiel begleitete. Deren Ausdrucksweise erschien ihr sehr fremdartig und übertrieben, aber das Gefühl, aus dem heraus sie stammte, echt und gut.
»Sagen Sie mir, Lelia,« fuhr Madeleine fort, »Sie, die Sie eine Tochter dieses kalten, frostigen Landes sind, sagen Sie mir, wenn Sie es können, warum diese Kälte, dieses Abwehren? Ist es ein Unrecht, daß ich ihn liebe? Kann ihm meine Liebe lästig sein? Ich bin ihm gegenüber so kalt gewesen wie ein Eisberg, während es in mir aussah, wie in einem Vulkan! Warum flieht er mich, warum meidet er unser Haus? Warum kann er mich nicht wenigstens dadurch glücklich machen, nein, glücklich ist nicht das rechte Wort, selig machen, daß er mir erlaubt, neben ihm zu weilen?«
Madeleine brach in Thränen aus. »Bin ich denn so schlecht und verächtlich,« rief sie, »daß er meinetwegen unser Haus meidet, als ob ein Pestkranker darin läge, daß er meinetwegen sich sogar von Horace zurückzieht!«
»Madeleine,« sagte Lelia, »wenn Heinz gemerkt haben sollte, daß Sie ihn lieben und er erwiedert Ihre Neigung nicht, so thut er doch gewiß Recht, wenn er sich von Ihnen fernhält. Es geschieht dann doch nur aus Rücksicht für Sie.«
»O,« rief Madeleine, »o, ich dachte es mir schon, daß Sie so urtheilen würden. Wie kalt Ihr hier seid, wie entsetzlich kalt! Ist es möglich, daß er aus Rücksicht für mich – mich tödtet?«
Lelia, die an eine so excentrische Redeweise ganz und gar nicht gewöhnt war, fühlte, daß die Lachlust, die in reichem Maße in ihr steckte, ihr Mitleid zu überwältigen drohte, aber das kam ihr selbst so schlecht und herzlos vor, daß der Schreck darüber ihr das Lachen vertrieb.
»O, Lelia,« fuhr Madeleine fort, »wie einsam und verlassen bin ich doch! Meine Mama ist eine herrliche Frau, sie ist sehr tugendhaft, sehr fleißig, eine vortreffliche Mutter, aber meine liebe Mama ist nicht ohne Schwächen und manche von diesen sind derart, daß ich mich – die heilige Jungfrau möge mir die Sünde vergeben – mit ihnen durchaus nicht aussöhnen kann. Mein guter Bruder ist auch ein braver Jüngling, voll Gemüth und Herzensgüte, voll Frömmigkeit und Höflichkeit, aber er ist wie ein Rohr im Winde, und ach! ich fürchte, seit Ihr Vetter sich von ihm zurückzieht, in schlechten Händen. Ich kann mich irren, aber es scheint mir, daß Herr von Lehmhof nicht ganz Gentleman ist, und dann ist da ein Herr von Schweinsberg. Ach, das ist ein schrecklicher Mensch! Er ist ein beherzter, muthiger Mann, es ist wahr, und er hat in seinem Blick etwas Kühnes und Festes, aber er ist, wie mir scheint, ohne alle Grundsätze und ohne alle Religion. Dann lügt er auch und ist sehr frech. Mit diesen Beiden und mit ihrer Frau Cousine verkehrt Horace jetzt hauptsächlich und er paßt doch so gar nicht zu ihnen. Sie verhöhnen ihn, glaube ich, und verspotten ihn.«
»Verkehrt mein Vetter auch mit den Herren?« fragte Lelia.
»Nur zum Theil. Mit Herrn von Lehmhof gar nicht und mit Herrn von Schweinsberg wenig. Herr Heinz lebt ja wie ein Eremit. Aber sagen Sie mir doch, Lelia, warum haßt Ihre Cousine Adelheid Ihren Vetter so bitterlich? Sie spricht nur mit Spott von ihm und thut Alles, um meinen Bruder gegen ihn einzunehmen?«
Lelia erröthete. »Ich glaube den Grund zu kennen, aber ich mag ihn lieber nicht nennen.«
»O, ich bin viel offener als Sie!« rief Madeleine unwillig, »aber das thut nichts. Ich bin ja noch nicht zu Ende. Zu den Schwächen meiner guten Mama, deren ich vorhin erwähnte, gehört auch, daß sie eine ganz unsinnige Verehrung für die hiesigen Edelleute hat und ich bin überzeugt, daß sie nur deshalb in dieses Land mit uns zurückkehrte, um uns, wie sie sich ausdrückt, standesgemäß zu verheirathen. Guter Gott! Als ob das nicht auch in Deutschland oder lieber noch in Frankreich hätte geschehen können! Aber das ist einerlei. Jetzt soll nun mein Bruder ein Fräulein Schweinsberg heirathen, ein hübsches und, wie ich glaube, im Grunde auch gutes Mädchen, das aber so apathisch ist, daß sie, wie ich vermuthe, in der Woche höchstens nur drei Worte spricht, und ich soll Herrn von Schweinsberg überliefert werden, der mich nicht liebt, der mich und die Meinigen innerlich verachtet, und der mich nur heirathen will, um seine Lage zu verbessern.«
Lelia sah Madeleine mit großen Augen an. Solche Verhältnisse waren ihr nichts Neues, denn sie hatte Aehnliches unter den Bauern oft genug beobachtet, aber daß solche Dinge auch unter Gebildeten vorkamen, davon hatte sie zwar gelesen, das hatte sie sich aber doch nie recht vorstellen können.
»Sie werden den Baron doch nicht heirathen?« rief sie ganz entsetzt.
»Nein, ich werde ihn nicht heirathen und wenn ich vor ihm bis zu den Sternen fliehen müßte, aber ich werde deshalb einen Kampf auf Leben und Tod mit meiner Mama und mit meinem Bruder und dem guten Herrn Kaskinovitsch zu bestehen haben.«
»Wer ist Herr Kaskinovitsch?«
»Unser guter Geistlicher. Er verlangt, daß ich meiner Mama gehorsam sein soll und mein Bruder verlangt dasselbe. O, ich weiß ja, daß es sehr sündhaft ist, wenn ich ihr nicht gehorche, aber ich werde es trotzdem nicht thun. Lelia, Sie sind ja auch ein frommes Mädchen, antworten Sie mir, was würden Sie in einem solchen Falle thun?«
»Es ist nicht leicht, eine solche Frage zu beantworten,« erwiderte Lelia, »und ich zumal kann mich nur schwer in Ihre Lage versetzen, aber ich denke, daß ich in diesem Falle mich weigern würde. Etwas Anderes wäre es, wenn meine Eltern von mir verlangten, ich sollte eine Ehe nicht eingehen. Dann würde ich ihnen gehorchen, denn ich würde dann durch meinen Gehorsam keinem göttlichen Gebote zu nahe treten und Nichts zum Opfer bringen, als mein eigenes Herz. In Ihrem Falle würde ich gewiß nicht nachgeben, ganz gewiß nicht, denn an eine christliche Ehe ist ohne Liebe doch nicht zu denken.«
Ehe Madeleine antworten konnte, wurden sie unterbrochen, indem Karlchen Maier in den Garten trat. Er war schon ein paar Mal dagewesen, um nach Horace zu sehen und hatte daher seine Bekanntschaft mit Lelia erneuert.
»Guten Tag, meine Damen,« rief er jetzt, »guten Tag!« O, Sie sind wieder fleißig, Fräulein Rechberg und Sie auch, Fräulein Balteville! Natürlich! O, das ist heiß! Das ist erschrecklich heiß! Ich versichere Sie, ich ersticke! Natürlich!«
Karlchen Maier war sehr erhitzt. Schweißtropfen standen ihm auf der Stirn und er schnappte nach Luft, wie ein Fisch auf dem Trockenen.
Die jungen Mädchen legten die Erbsen bei Seite und erhoben sich, um mit dem Gaste nach der Vorderseite des Hauses zu gehen.
»O, also Sie haben noch keinen Besuch! Noch keinen Besuch! Ich dachte natürlich, sie wären schon hier, aber es ist sehr heiß, entsetzlich heiß und die Andern sind später ausgefahren, natürlich!«
»Von wem sprechen Sie?« fragte Lelia.
»Ihre Frau Cousine, Frau von Lehmhof und der Aarburgsche wollten nach Horace sehen und Ihre Gastfreundschaft in Anspruch nehmen. Letzteres natürlich! Ich war heute Morgen in Behrslappen und da wurde es mir mitgetheilt. Aber wie heiß es ist!«
Lelia war von dem Gespräche, das sie eben mit Madeleine geführt hatte, noch sehr erschüttert, und die Nachricht, daß sie noch heute Adelheid wiedersehen sollte, war auch nicht dazu angethan, sie zu beruhigen.
Sie forderte den Doctor auf, Platz zu nehmen und eilte selbst mit Madeleine in's Haus. Madeleine war in der größten Aufregung. »Jetzt verfolgt er mich sogar bis hierher,« rief sie, mit den Thränen kämpfend, »was soll ich thun!«
»Bleiben Sie in Ihrem Zimmer,« erwiderte Lelia rasch. »Sie müssen ihm deutlich zeigen, daß sie ihn nicht mögen.«
»Ach, das weiß er gewiß schon längst; aber er mag mein Geld.«
»Ziehen Sie sich jedenfalls Anfangs noch zurück,« meinte Lelia, »später wollen wir uns schon helfen.«
Madeleine stieg betrübt die Treppe hinauf und Lelia eilte in den Keller hinab und holte für den Doctor eine Flasche Birkwasser. Sie schenkte ihm ein Glas von dem kühlenden Getränke ein und setzte sich dann neben ihn.
»Nicht wahr, Herr Doctor,« sagte sie, »ich habe drei Gäste zu erwarten? Die beiden Behrslappenschen und den Aarburgschen?«
»Drei? Nein, nur zwei. Die Behrslappensche Frau und den Aarburgschen. Lehmhof selbst kommt nicht mit. Natürlich!«
»Wissen Sie ungefähr, wann Ihre Freunde kommen?« fragte Lelia weiter.
»Ich erwarte sie in jedem Augenblicke. Nun, Sie werden auch froh sein, wenn Sie die ganze Bagage los sind, Fräulein Rechberg. Ein Kranker im fremden Hause macht mehr Unruhe als zehn im eigenen. Natürlich! Ich kenne das und ich bedauere Sie. Wahrhaftig, ich bedauere Sie. Ich sprach noch heute Morgen mit Heinz davon. ›Ich kann es gar nicht ansehen, wie sie sich quält,‹ sagte er. Ja, ›quält,‹ das war sein Wort, und da hat er auch ganz Recht, natürlich!«
Lelia lachte. »Wenn Sie ihn wieder sehen, Herr Doctor, so sagen Sie ihm doch nur, daß er deshalb immerhin wiederkommen möge. Unsere Frauenarbeit sieht oft schlimmer aus, als sie ist.«
»Nun das denke ich wohl nicht. Oho, das meine ich wohl gar nicht,« rief der Doctor und blies dazwischen Lindenblätter auf, daß sie knallend zersprangen. »Das ist gar nicht meine Meinung. Im Gegentheil, natürlich!«
Lelia entschuldigte sich nun bei ihm, daß sie ihn allein lassen müsse, um einige Vorbereitungen zum Empfange der Gäste zu treffen, und ging in's Haus. Der Doctor lehnte sich behaglich gegen die Lehne der Bank und dachte darüber nach, daß Fräulein Rechberg doch eigentlich ein reizendes Geschöpf sei und daß, wenn der Weltenlenker es so gefügt hätte, daß sie, statt Paulinchen, seine Frau geworden wäre, das für das arme Mädchen ein Glück und für ihn selbst kein Unglück gewesen sein würde. Aber da das nun nicht mehr ging, warum konnte der Heinz sie nicht glücklich machen? Der ging jetzt wie blind durch die Welt. Er hatte ja Lelia früher geliebt; aber das hatte er offenbar längst vergessen. Nein, Heinz wird nicht heirathen. Er ist auch zu schade für die Weiber, bei Gott! Er ist auch zu schade für die Landwirtschaft. Natürlich!«
Darüber schlief der Doctor fest ein.
Lelia setzte unterdessen die Mägde in Bewegung und bereitete sich auf den Empfang der Gäste vor. Das war nicht ganz leicht, denn das stille Pastorat, in das im Laufe des Jahres nur selten ein Besuch kam, war auf so zahlreiche Gäste nicht eingerichtet und es mußte daher umsichtig gehandelt werden.
Das Wiedersehen mit Adelheid beunruhigte Lelia mehr als sie selbst glaubte. Adelheid lebte in ihrer Erinnerung als ein hochmüthiges und herrschsüchtiges, aber im Grunde edel geartetes Mädchen. Dazu paßte nun freilich durchaus nicht, was sie nachher gelegentlich von ihr gehört hatte; denn von den Eichenstamms war Adelheid ganz und gar aufgegeben und sie sprachen von ihr, ihrer aufrichtigen Ueberzeugung gemäß, nur wie von einer auch sittlich völlig Verlorenen. Lelia kam mit den Eichenstamms zwar nur höchst selten, aber doch hin und wieder zusammen und da hatte man sie denn einmal, als sie Adelheid in Schutz nahm, auf das offenkundige ehebrecherische Verhältniß mit dem Aarburgschen hingewiesen. Lelia hatte auch dann noch nicht recht daran glauben wollen, aber daß jetzt Adelheid ohne ihren Mann und mit demselben Aarburgschen kommen sollte, machte sie stutzig und empörte sie zu gleicher Zeit. Wofür mußte Adelheid das Pastorat halten, daß sie es wagte, es in Gesellschaft ihres Liebhabers zu betreten!
Lelia wußte nicht, wie sie sich verhalten sollte und darum verfuhr sie wie immer, wenn etwas sie verwirrte: sie begab sich zum Großvater. Er schlief noch Mittag und es that ihr leid, ihn zu wecken; aber sie mußte mit sich im Klaren sein, ehe die Gäste kamen, darum beugte sie sich über ihn und küßte ihn leise auf das weiße Haar.
Der Alte öffnete, ohne sich zu rühren, die Augen und blickte sie hell an.
»Was giebt es, mein Kind?« fragte er.
»Großvater,« sagte Lelia und setzte sich auf den Rand des Bettes, »ich muß Dich um Rath fragen.«
Sie erzählte nun, während sie von Zeit zu Zeit eine Fliege abwehrte, die um den Kopf des Alten summte, von dem bevorstehenden Besuche.
Der Alte hörte sie aufmerksam an, wandte sich dann herum, so daß er auf dem Rücken lag, zog den Kopf der Enkelin an sich und küßte sie herzlich auf Mund und Augen. Dann sagte er:
»Ich rathe, mein Kind, zu handeln, als ob wir nichts wüßten, denn es ist nicht unsere Sache, zu untersuchen, ob Adelheid schuldig ist oder nicht. Ist er wirklich ihr Liebhaber, so wird sie es vor Gott zu verantworten haben. Ich glaube übrigens nicht daran. Nasführen mag sie ihn und mit ihm kokettiren, aber daß eine Eichenstamm ihren Mann geradezu hintergehen kann, das glaube ich nicht. Die Race läßt es nicht zu, Lelia; bei den Frauen kommt alles auf die Race an, wie bei den Thieren und den Pflanzen. Die Eichenstamms sind ein reines und edles Geschlecht und ihre Fehler liegen auf ganz anderem Gebiete. Die Adelheid hatte zwar immer etwas Fremdes an sich, aber daß sie das Blut der Familie so weit verleugnen könnte, glaube ich nicht. Jedenfalls ist es nicht unsere Sache, ihr so schwere Sünde zuzutrauen.«
Lelia sah nachdenklich vor sich hin. Das, was der Großvater zuletzt sagte, war ja ganz richtig; aber es war etwas in ihr, das sich gegen die erwarteten Gäste empörte.
»Ach, warum ist Heinz nicht hier!« dachte sie und seufzte. Sie war recht böse auf ihn und nahm sich vor, den Doctor zu fragen, ob Heinz von dem bevorstehenden Besuche etwas gewußt habe.
Der Großvater betrachtete sie aufmerksam. Sie hatte ein ungemein sprechendes Gesicht, und wer sie einigermaßen kannte, konnte so ziemlich errathen, was sie gerade dachte und von welchen Empfindungen sie bewegt wurde.
»Dir ist's nicht recht,« sagte er endlich.
»Nein, Großvater, mir ist so bang und unbehaglich zu Sinn.«
Dann lächelte sie, küßte den Alten noch einmal und ging mit den Worten: »Ich wünschte, sie wären, wo der Pfeffer wächst!« die Treppe hinunter.
Als Lelia aus dem Hause trat, sah sie Frau von Balteville und Horace unter der einen Baumgruppe sitzen, während keine zwanzig Schritte davon der Doctor sanft und fest schlief. Mutter und Sohn wiesen, als sie sich ihnen näherte, lachend auf den Schlafenden und rückten dann zusammen, um ihr Platz zu machen.
»Sie werden nun bald von uns erlöst sein, liebes Fräulein,« begann Frau Amanda und ergriff Lelia's Hand. »Gestehen Sie es nur, Sie sind uns gewiß gründlich überdrüssig.«
Lelia lächelte. »So lange Sie mit unserem bescheidenen Heimwesen vorlieb nehmen, sind Sie uns herzlich willkommen,« erwiderte sie. »Aber Sie dürfen noch nicht an das Scheiden denken, gnädige Frau,« fuhr sie fort und blickte dabei auf Horacens verbundenen Kopf, »Ihr Herr Sohn dürfte schwerlich schon die lange Fahrt vertragen.«
»Ich muß gestehen, Fräulein Rechberg,« begann Horace, indem er sich gegen Lelia verneigte, »daß ich so rücksichtslos bin, zu wünschen, daß mich meine Wunde länger hier festhielte, als es, dem Anscheine nach wenigstens, geschehen wird. Es ist hier bei Ihnen so wunderbar still und friedlich.«
Lelia hatte für Horace eine große Zuneigung gefaßt. Sein bescheidenes, gutherziges Wesen gefiel ihr sehr wohl und sie hatte hinreichende Mühe mit ihm gehabt, um ihn lieb zu gewinnen.
»Sie sind sehr höflich,« erwiderte sie; »aber wie steht es mit der Wahrhaftigkeit?«
»Auf Ehrenwort, Fräulein Rechberg, auf Ehrenwort. Ich rede die lautere Wahrheit.«
»Um so besser für Sie. Ich fürchte aber, daß die Ihrigen diese Empfindungen schwerlich theilen werden.«
»Sie thun uns Unrecht,« rief Frau Amanda, »und Sie scheinen nicht zu ahnen, wie dankbar meine Tochter und ich Ihnen und den lieben Ihrigen für Ihre wahrhaft schrankenlose Gastfreundschaft sind. Sie zumal, mein Fräulein, haben in diesen drei Wochen an meinem Sohne gehandelt wie eine rechte Samariterin, und Ihr Name würde in Parkhof ewig unvergessen sein, auch wenn Sie, was hoffentlich nicht geschehen wird, künftig, wie bisher, unserem Hause fern blieben.«
Horace lauschte den Worten der Mutter mit ganz besonderem Entzücken. Sie drückte sich nur sehr selten so warm und zugleich auch so richtig aus. Er selbst hätte bis an das Ende aller Dinge dableiben mögen, denn er war regelrecht in Lelia verliebt.
Lelia dankte für die Einladung und fügte hinzu, daß der Doctor den Besuch von Frau von Lehmhof und Herrn von Schweinsberg angemeldet habe. Frau von Balteville und ihr Sohn waren über diese Nachricht ganz entzückt. Nachdem sie ihren Empfindungen lebhaften Ausdruck verliehen hatten, sagte Frau von Balteville:
»Wie kommt es eigentlich, mein liebes Fräulein, daß Sie mit Ihrer Cousine gar nicht verkehren? Sie ist eine so vortreffliche junge Dame und wenn die Verhältnisse sie auch zwangen, auf den großen Familienverkehr zu verzichten, so wundert es mich doch, daß sich zwischen Ihnen kein, den Umschwung im Leben Ihrer Cousine überdauerndes Verhältnis hergestellt hat.«
Lelia ärgerte sich innerlich darüber, daß Frau von Balteville die Sachlage so darstellte, als ob Adelheid es gewesen wäre, die den Umgang mit den Verwandten abgebrochen hatte, sie dachte aber an die letzten Worte des Großvaters und begnügte sich damit, zu erwidern:
»Ich bin meiner Cousine seit einer Reihe von Jahren nicht begegnet.«
»Da kann man sich ja auf Ihr heutiges Zusammentreffen recht freuen,« rief Horace harmlos. »O, Sie werden gewiß Freundinnen werden. Frau von Lehmhof ist voll Geist und Feuer.«
»Finden Sie Ihren Vetter nicht sehr verändert?« fragte Frau von Balteville weiter.
»Allerdings,« versetzte Lelia. »Es kommt mir mitunter so vor, als ob er ein ganz anderer Mensch geworden. Früher hatte ich die größte Furcht vor ihm. Ich schämte mich dieser Furcht und suchte mich zu beherrschen, aber es gelang mir nicht; jetzt finde ich ihn sehr liebenswürdig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, daß ich selbst älter und verständiger geworden bin oder daran, daß er sich verändert hat, jetzt ist mir ihm gegenüber so schwesterlich zu Muthe, wie es einem Spielkameraden und Vetter gegenüber natürlich ist.«
Frau Amanda dachte, daß das wohl noch anders werden könne, behielt aber ihre Gedanken für sich und sagte:
»Ich bedaure es lebhaft, daß er sich so ganz zurückzieht. Er verkehrt mit Niemand.«
»Ach ja,« rief Horace, »wie sehr leide ich darunter. Er lebt wie ein Einsiedler und ich fühle sehr wohl, daß auch der Besuch des Freundes ihn unangenehm berührt, aber ich lasse mich dadurch nicht abhalten.«
Horace sagte die letzten Worte mit einem so gutmüthigen und liebenswürdigen Lächeln, daß er Lelia dadurch noch lieber wurde. Er ergoß sich nun, wie er das schon mehrfach gethan hatte, in reiche Lobgesänge auf den Freund und der Doctor, der endlich erwacht war und sich der Gesellschaft, die sich allmälig auch um die übrigen Hausgenossen vermehrte, angeschlossen hatte, unterstützte ihn redlich darin.