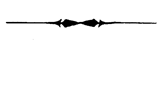|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Das nächste Jahr war ein Nothjahr. Schon im Frühlinge regnete es unaufhörlich und blieb lange empfindlich kalt. Auch als der Sommer endlich herankam, hörte der Regen nicht auf. Täglich kam die Sonne ein wenig zum Vorschein, und die Landwirthe schöpften neue Hoffnung, aber täglich trieb der Westwind wieder neue Regenwolken herauf und der Regen fiel nach wie vor in Strömen. Die Flüsse traten, wie im Frühlinge, weit über ihre Ufer und schwemmten das Heu weg, oder verhinderten gar, daß es gemäht wurde, und zu Anfang August fuhr Heinz zu Boot über sein Gerstenfeld. Was dann der regnichte Sommer noch übrig gelassen hatte, das verdarb der regnichte Herbst. Es blieb Nichts übrig für den Winter und die Landwirthe hatten ungeheure Verluste. Sie mußten nicht nur auf jeden Ertrag verzichten, sondern auch noch die ganze Wirthschaft für baares Geld erhalten. Statt daß im Winter die Fuhren beladen zur Stadt gingen und sie geleert wieder verließen, ging es jetzt den umgekehrten Gang, die Fuhren gingen leer hin und kamen beladen zurück.
Die Bauern am Flusse litten auch große Noth und da es bald bekannt wurde, daß der Arrendator von Endhof eine offene Hand hatte nicht nur für die eigenen Leute, sondern auch für die Nachbarn, so strömten die Hungrigen bald dorthin und keiner wurde zurückgewiesen. Das war gut für Heinzens Herz, aber schlecht für seinen Beutel. Weinthal mahnte vergeblich zur Sparsamkeit. Heinz war selbst unglücklich, wie sollte er sich nicht der Unglücklichen erbarmen, und er hatte es ja auch mit wirklicher Noth zu thun.
Unseren übrigen Bekannten ging es nicht anders, sie halfen nach Kräften, zum Theil auch über ihre Kräfte hinaus. Der Behrslappensche war freilich für den Winter mit Weib und Kind hinausgereist, theils weil sein Lebrecht in ein wärmeres Klima gebracht werden mußte, theils aber auch, um eben der Noth aus dem Wege zu gehen. Otto Schweinsberg war ihnen gefolgt, doch sandte er große Summen an Markhausen zur Vertheilung unter die bedürftigen Knechte und ordnete ohne alle Rücksicht auf seine zerrütteten Vermögensverhältnisse an, daß den Wirthen die halbe Pacht erlassen werde. Nicht weniger hülfreich waren die Zurückgebliebenen. Frau Amanda (Horace verbrachte einen Theil des Winters auf Wunsch seiner Mutter in Petersburg, um dort die Verbindungen seines Vaters wieder anzuknüpfen), der Adel und die Geistlichkeit der Umgegend, vor Allem die Bachhöf'schen Schweinsbergs, thaten, was in ihren Kräften stand und die letzteren noch viel mehr. Markhausen zumal sorgte dafür, daß eine Art Organisation in die Wohlthätigkeit kam, und er beeinflußte und leitete die Männer, wie Frau von Schweinsberg die Frauen. Diese Thätigkeit brachte Markhausen und Heinz mitunter zusammen und sie fingen an, einander zu gefallen. Markhausen hatte studirt und war ein sehr fein gebildeter Mann, aber die Liebe zur Landwirthschaft hatte ihn daran verhindert, sein Fach zum Brodstudium zu benutzen. Er war mit Leib und Seele Landwirth, aber er arbeitete im Winter, wo es draußen wenig zu thun gab, gern an seiner Wissenschaft fort und ohne irgendwie productiv zu sein, wußte er sich doch, vermöge einer vortrefflichen Bibliothek (nach dieser Richtung hin sparte der sonst so sparsame Mann kein Geld) in seiner Wissenschaft – er hatte, wie Heinz, Geschichte studirt – auf dem Laufenden zu erhalten.
Er hatte sich Anfangs Heinz gegenüber sehr mißtrauisch gezeigt und war durchaus geneigt gewesen, ihn für einen Thunichtgut zu halten, der zur Landwirthschaft griff, weil er eben zu nichts Anderem taugte. Bald aber hatte er einen gewissen Respect vor dem Dilettanten bekommen, und als er bemerkte, daß Heinz die Sache ernst nahm; als er sah, daß Heinz auf dem Felde war, er mochte noch so oft vorüber reiten, da fing er an, den Nachbar mit Interesse zu beobachten und das um so mehr, als der Pastor, der Heinz jetzt auch immer günstiger beurtheilte, ihm gelegentlich einmal von der bewußten Medaille erzählte. Der Baron fühlte sich in wissenschaftlicher Beziehung denn doch zu sehr vereinsamt, um nicht mit einigem Behagen an die Möglichkeit zu denken, in so naher Nachbarschaft einen ehemaligen Fachgenossen zu finden, und so knüpfte er denn in seiner Weise die Bekanntschaft ganz allmälig an.
Heinz seinerseits hatte vor dem Baron als Landwirth und als Mensch die größte Achtung. Wenn er ihm trotzdem nicht nahe trat, so geschah das, weil ihn die Erfahrungen der ersten Zeit völlig kopfscheu gemacht hatten, so daß er sich keinem Menschen nähern mochte.
Eines Tages kam der Baron zugleich mit dem Doctor in einer zum Theil geschäftlichen Angelegenheit zu Heinz und nahm, als er aufgefordert wurde, dort zu frühstücken, die Einladung an. Wirth und Gast gefielen sich, und als sie sich trennten, wurde verabredet, künftighin gute Nachbarschaft zu halten. Man besuchte sich nun, Anfangs selten, dann immer häufiger. Sie waren Beide den ganzen Tag über praktisch beschäftigt gewesen, es war daher natürlich, daß sie sich, wenn sie am Abend zusammentrafen, mit Vorliebe wissenschaftlichen Gesprächen zuwandten und Heinz fühlte, zu seiner eigenen Verwunderung, zwar noch nicht den alten Wissenstrieb, aber doch wieder ein lebhaftes Interesse für die Bücherwelt in sich erwachen.
Als sie ein Dutzend Mal zusammen gewesen waren, sagte der Baron, indem er sich nach seiner Gewohnheit mit den Fingern durch die Locken fuhr: »Was meinen Sie, Eichenstamm, sollten wir nicht zusammen einen alten Chronisten durcharbeiten? Ich denke, das würde uns Beiden nach all' den Sorgen um Brod, Hafer und Heu wohl thun!«
Heinz erklärte sich bereit dazu, es wurden die Namen einer Anzahl hervorragender Chronisten auf Zettelchen geschrieben, zusammengerollt und in eine leere Zuckerdose geworfen, dann mußte Heinz einen dieser Zettel ziehen. Er zog Adams von Bremen Hamburgische Kirchengeschichte, und sie waren damit wohl zufrieden. Man verabredete noch, sich den betreffenden Abschnitt vorher etwas anzusehen, um rascher vorwärts zu kommen und ging dann zu einem anderen Gesprächsthema über.
Nun bemerkte Heinz bald, daß er es mit keinem zu verachtenden Gegner zu thun hatte (eine gewisse Gegnerschaft oder richtiger, ein gewisser Wettkampf bildet sich in solchen Fällen ganz von selbst), denn der Baron hatte in Dorpat zu einer Zeit studirt, wo man dort zwar nicht arbeiten lernte, wohl aber sich ein bedeutendes Maß von positiven Kenntnissen aneignete, und da er sich auch nachher immer viel mit dem Mittelalter beschäftigt hatte, so wußte er Mancherlei vorzubringen.
Andererseits bekam der Baron bald gehörigen Respect vor Heinzens mehr in die Tiefe, als in die Breite gehendem Wissen und zumal vor seiner peinlichen, auch das Kleinste und scheinbar Unbedeutendste berücksichtigenden Methode. Wenn nun der Baron trotzdem mitunter die Geduld verlor und das Verfahren der neuen historischen Schule als kleinlich bezeichnete, so machte es sich ganz von selbst, daß Heinz sie vertheidigte und sich so ihrer Bedeutung allmälig wieder bewußt wurde.
Da sich Heinz für jede Zusammenkunft sorgfältig vorbereitete, so geschah es, daß er bald ein dringendes Bedürfniß nach Hilfsmitteln empfand. So knüpfte er denn wieder mit den Buchhändlern an und es erwies sich, daß der Adam von Bremen gleichsam nur ein Pionier gewesen war, eine Art Hinterwäldler, dem ein ganzer Troß Farmer nachfolgte.
Heinz versicherte nun zwar sowohl dem Baron, als auch sich selbst bei jeder Gelegenheit, daß an eine Wiederaufnahme seiner Studien gar nicht zu denken sei, aber er saß doch jeden Abend über seinen Büchern und zwar nicht mehr über landwirtschaftlichen, sondern über historischen. Als Weihnachten vorüber war, konnte er über die Auslegung einer kontroversen Stelle so hitzig streiten, daß der Baron innerlich seine rechte Freude daran hatte, denn er hegte den lebhaften Wunsch, daß Heinz seine reichen Kenntnisse und seine reiche Begabung auf demjenigen Felde an den Tag legte, zu dessen Bestellung er durch seine Studien vorbereitet war. Er hütete sich aber wohl, diesen Wunsch auszusprechen.
Dieser Winter brachte Heinz mit vielen Menschen zusammen, denen er mit offener Hand reiche Unterstützung darbot. Dabei sagte er sich selbst und Markhausen wiederholte ihm das auch immer, daß es in solchen Nothzeiten vor Allem darauf ankomme, die wirklich Nothleidenden herauszufinden und sie von Denjenigen zu trennen, welche aus selbstsüchtiger Aengstlichkeit oder gar nur aus Faulheit die Hilfe der Wohlhabenden in Anspruch nähmen. Er fuhr daher viel selbst in die Gesinde und traf in ihnen wohl auch mit seinem Onkel, dem Pastor, zusammen. Dieser hatte, wie gesagt, Heinzens Fleiß und Umsicht auf landwirthschaftlichem Gebiete wohl bemerkt und seine Beobachtungen mit großer Freude, denn er liebte Heinz wirklich, Frau Irenen und dem Doctor Konrad mitgetheilt, so daß Heinz in der Meinung der Familie mit jedem Monate wieder stieg. Da man ihn nun jetzt so ausdauernd fleißig wußte, so lag der Gedanke nahe, daß es am Ende mit der bewußten, mehrfach besprochenen Medaille doch seine Richtigkeit haben könnte.
Traf übrigens Heinz mit dem Onkel zusammen, so blieben sie doch, obgleich der gemeinsame Anblick menschlicher Noth die Herzen einander zu nähern pflegt, äußerlich kalt, denn Jeder von ihnen meinte, daß der Andere ihn seinerzeit rücksichtslos behandelt habe. Sie fühlten sehr wohl, daß sie sich beide im Unrechte befanden, aber da sie beide Eichenstamms waren, wenn auch ein paar sehr verschiedene, so mochte keiner den ersten Schritt zur Verständigung thun.
Heinz lernte in dieser Zeit den Onkel persönlich erst recht schätzen, denn er sah, daß derselbe, trotz seines unbändigen Jähzorns und seines mitunter hochfahrenden und rechthaberischen Wesens, ein sehr wohlmeinender, pflichttreuer Mann war. Wie zeigte er sich jetzt unermüdlich, um in der schweren Zeit seiner Gemeinde glücklich durchzuhelfen, und wenn das auch oft in recht herrischer Weise geschah, so ließen es sich die Leute doch gern gefallen.
Von der größten Bedeutung für Heinz waren aber die Nothleidenden selbst. Er hatte, wo sein Hochmuth und seine Leidenschaft nicht in's Spiel kamen, ein weiches Gemüth, und der Anblick der Noth schnitt ihm in's Herz. In ihm, als dem Sohne eines alten Predigergeschlechts, war die Liebe zu den untern Volksklassen, eine Liebe, die man in den oberen gebildeten Volksschichten unserer Heimath vielleicht öfter findet, als sonst irgendwo, gewissermaßen erblich, und so hing er denn sein Herz bald an ein altes, weißhaariges Mütterchen, das in irgend einer Badestube Zuflucht gesucht hatte vor den Stürmen des Lebens, bald an ein armes, krankes Kind, oder an irgend einen Krüppel, der auch in guten Zeiten Nichts hatte erwerben können und nun der Noth der Zeit wehrlos gegenüber stand.
Gab auch der Anblick so vielen Elends der Schwermuth, die ihn ohnehin gefangen hielt, neue Nahrung, so gewann er jetzt doch wieder Menschen lieb, ihm bisher ganz fremde, kranke, verwahrloste Menschen, zu denen ihn Nichts zog, als daß sie eben leidende Menschen waren. Zugleich wurde ihm diese Thätigkeit besonders lieb, weil ja auch Anna sich der Armen so fleißig angenommen hatte, und wenn er einmal aus der Hütte irgend eines einsamen Gesindes trat und die Leute geleiteten ihn, mit Dankesthränen in den Augen, dann fühlte er wohl, daß er jetzt fortwirke in Anna's Sinne.
Eines Tages, es war im Monat April und die ersten Frühlingswinde wehten schon durch das Land, fuhr Heinz aus, um einen Armen zu besuchen, an den er am Tage zuvor zufällig erinnert worden war. Der Mann war Markhausen als sehr fleißig und thätig bekannt und er hatte ihm daher erlaubt, sich im Walde anzusiedeln. Markhausen that das mehrfach. Er gab den Leuten reichlich Land, unterstützte sie noch ein wenig vom Hofe aus und sah so eine Anzahl neuer Gesinde entstehen. Dem Manne freilich, von dem hier die Rede ist, ging es herzlich schlecht. Heinz hatte seine Bekanntschaft gemacht, als er im ersten Sommer einmal auf der Birkhühnerjagd war und Jener ihm half, die geschossenen Hähne nach Aarburg tragen. Schon damals hatte er bemerkt, daß der Flachs, den der Ansiedler in das Neuland, welches sich rings um das Häuschen hinzog, gesäet hatte, jämmerlich stand und als er ihn darauf aufmerksam machte, hatte dieser, indem er die Achseln zuckte und zu Boden sah, erwidert, daß er nichts dafür könne und daß er es an Fleiß und Mühe nicht habe fehlen lassen. Im folgenden Herbste war Heinz dann auf der Rehjagd mit dem Aarburg'schen an dem Häuschen vorübergesprengt und hatte, da er sich für den Mann interessirte, wieder nach dessen Feldern gesehen, die zwar vergrößert waren, aber eben so schlechtes Getreide trugen, als im Vorjahre. Er hatte nachher dahin zurückkehren wollen, aber man hatte ihm gesagt, daß die Leute von Bachhof aus unterstützt würden, und so hatte er sich weiter nicht um sie gekümmert. Jetzt erst war ein Aarburg'scher Buschwächter zu ihm gekommen und hatte von der großen Noth erzählt, die dort herrsche. So ließ denn Heinz ein Säckchen mit Lebensmitteln füllen und machte sich auf den Weg, um sich von der Lage der Dinge zu überzeugen.
Der Schnee war im Schmelzen begriffen und als Heinz über den Fluß fuhr, mußte er auf beiden Seiten durch tiefes Aufwasser, weiterhin aber, im Walde, war der Weg wie eine Eisbahn und er konnte rasch zufahren. Der Wald war Anfangs gemischt, obgleich die Birken vorherrschten, dann fuhr man in reinem Föhrenwalde dahin.
Die Hütte des Ansiedlers lag auf einer kleinen Anhöhe, deren allmälig aufsteigender Abhang mit dichtem, ein paar Fuß hohem Nachwuchse besetzt war. Der Weg wand sich in zahlreichen Krümmungen hinauf und konnte nur langsam befahren werden, denn die Stobben der Bäume, die früher hier gestanden hatten, waren nicht ausgerodet worden, sondern nur überwachsen. An einem derselben verletzte sich Heinz nicht unbedeutend den Fuß, den er, nach Landessitte, hinaushielt, um das kleine Schlittchen, in dem er saß, nöthigenfalls vor dem Umfallen zu schützen. Der Fuß schmerzte heftig, aber Heinz fuhr, nachdem er sich überzeugt hatte, daß er nicht gebrochen war, weiter. Als er vor dem Häuschen hielt, sah er den Ansiedler vor der Thür sitzen. Der Mann, der eine alte, zerrissene Pelzjacke anhatte, saß mit unbedecktem Haupte auf einer kleinen Bank unter dem einzigen Fenster und flocht Matten. Obgleich er nun Heinzens Glocke und sein Kommen längst bemerkt haben mußte, so stand er doch weder auf, noch blickte er auch nur nach ihm hin, sondern arbeitete, indem er ein paar lange Fäden der Matte zwischen den Zähnen hielt und das finstere, gelbe Gesicht, in welchem nur ein Auge war – das andere hatte ihm einmal ein zurückschnellender Ast ausgeschlagen – auf die Arbeit niederbeugte, weiter, ohne sich irgend um seinen Gast zu bekümmern. Heinz, der den Mann zwar schon von früher her als mürrisch und verschlossen kannte, war trotzdem durch diesen seltsamen Empfang eigenthümlich berührt und indem er aus dem Schlitten stieg und dem Pferde die Leine über den Rücken warf, rief er dem Manne ein lautes: »Gott helf!« zu, ohne daß sich dieser dadurch veranlaßt gesehen hätte, es mit dem üblichen »Danke!« zu erwidern.
Heinz, in dem der Gedanke aufstieg, der Mann sei am Ende geisteskrank, ließ sich dadurch nicht abschrecken. Er setzte sich vielmehr neben den »Häusler,« wie man bei uns in manchen Gegenden die Ansiedler nennt, nieder und ergriff seine Hand. Der Mann ließ sie ihm ruhig und blickte ihm nun auch in's Auge. Heinz bemerkte mit Entsetzen, wie elend und verkommen der Mensch aussah.
»Guter Freund,« begann er und drückte ihm herzlich die Hand, »guter Freund, Ihr habt gewiß große Noth gelitten. Warum seid Ihr nicht zu mir gekommen?«
Der Mann schüttelte den Kopf und sah Heinz nach wie vor so seltsam starr an.
»Ich habe,« fuhr dieser fort, indem er sich vorbeugte, um den Mann besser betrachten zu können, »geglaubt, daß Ihr von Bachhof aus unterstützt würdet, und habe daher nicht weiter für Euch gesorgt. Ich habe erst heute durch den Buschwächter von Eurem Elende gehört und bin gekommen, um Euch zu helfen.«
Der Häusler nickte ein paar Mal mechanisch mit dem Kopfe und wollte dann wieder zu seiner Arbeit greifen, allein Heinz, der jetzt irgend eine schreckliche Aufklärung dieses seltsamen Benehmens ahnte, ließ das nicht zu.
»Wo ist Euer Weib?« fragte er.
Der Mann schlug beide Hände vor's Gesicht. »Erbarmt Euch!« stöhnte er.
»Was ist's mit ihr?« fragte Heinz überlaut und schüttelte den Mann heftig. »Was ist's mit Eurem Weibe?«
Da er aber keine Antwort von ihm erhielt, so ließ er ihn fahren und ging selbst in das Häuschen. Der hohe Mann mußte sich tief bücken, um überhaupt nur hineinzukommen und er mußte auch darin gebückt bleiben. Das Zimmer war kalt und sonst ohne Hausrath; in dem Bett aber, das in der einen Ecke stand, lag die Frau des Häuslers und an ihrer hagern Brust ein kleines Kind.
Heinz erkannte auf den ersten Blick, daß Beide todt waren. Um sich zu überzeugen, ob nicht ihrem Leben ein gewaltsames Ende gemacht war, beugte er sich auf sie nieder und betrachtete sie prüfend; aber es schien ihm, als ob sie eines natürlichen Todes gestorben wären. Als er sich umwendete, sah er den Mann an der Thür stehen und ihn mit trotzigen und doch auch zugleich ängstlichen Blicken betrachten.
Heinz athmete schwer. In welch ein entsetzliches Elend blickte er hier hinein und es hatte sich nicht irgendwo in der Ferne abgespielt, sondern kaum zwei Meilen weit von Endhof.
Heinz erkannte, daß es vor Allem darauf ankam, dem Manne, der offenbar halb verhungert war, Speise einzuflößen und ihn zum Sprechen zu bringen. Er legte also zuerst einige Stücke Holz, die er vor der Thür fand, auf den kalten Heerd, und als sie nicht recht brennen wollten, nahm er die Matten, die der Häusler draußen hatte liegen lassen und warf sie in das Feuer. Der Mann griff schweigend und wie ein Blödsinniger nach den Matten, ließ sich aber gutwillig zurückhalten, stand nun still da und sah in's Feuer. Es gelang Heinz, ein Kesselchen aufzutreiben, das bald mit Wasser gefüllt auf dem Feuer stand. Als es kochte, schüttete Heinz ein wenig von dem Thee, welchen er mitgebracht hatte, hinein und füllte das heiße Getränk in ein irdenes Schüsselchen, das er auf dem Tische fand. Es kostete ihn große Mühe, den Mann dazu zu bewegen, daß er etwas von dem Thee und den Zwiebacken genoß; aber als er erst angefangen hatte, schlürfte er in ein paar Zügen die ganze Portion hinunter und verlangte nach mehr.
Das warme Getränk und die Ofenwärme – Heinz hatte auch im Ofen ein Feuer angemacht – brachten ihn nach und nach zu sich und er erzählte nun die schreckliche Geschichte seiner Leiden. Er war bei allem Fleiße immer mehr zurück gekommen, denn seine Wirthschaft hatte von vornherein auf so schwachen Füßen gestanden, daß sie kein Mißwachsjahr überdauern konnte. Als nun das erste Jahr ihn so völlig in seinen Erwartungen getäuscht, da hatte er alle Hoffnung auf das nächste gesetzt. Er und seine Frau hatten ihre Bedürfnisse auf das Aeußerste eingeschränkt und die Verwandten der Frau – er selbst war ein uneheliches Kind und stand ganz allein in der Welt – hatten ihn mitleidig und weil sie sahen, daß er es an Fleiß nicht fehlen ließ, mit Saat und dem nöthigen Futter für die Kuh und das Pferd unterstützt. Als aber nun auch im zweiten Jahre so gar nichts wuchs, da hatten sie bald erkannt, daß sie verloren seien, denn auch die Verwandten, selbst von völligem Mißwachs heimgesucht, konnten ihnen nichts mehr geben.
Sie mußten nun Pferd und Kuh verkaufen; weil aber in dem Nothjahre so viele Arme ihre Habe auf den Markt brachten, so hatten sie gar wenig dafür erhalten. Sie wußten zwar sehr wohl, daß man auf den Gütern nicht vergebens bat; aber sie konnten sich zum Betteln nicht entschließen und so wurde die Noth immer größer. Er selbst, der Mann, war in die Stadt gegangen, um dort womöglich Arbeit zu finden, aber umsonst – es war auch dort an Arbeit Suchenden Ueberfluß.
Als er dann, todtmüde und völlig verzagt, nach Hause zurückgekehrt war, da erkrankte ihm zuerst sein Kindchen und gleich darauf auch seine Frau und nach ein paar Tagen starben sie. Da hatte er gedacht, nun sei doch Alles aus und hatte weder Speise noch Trank zu sich genommen, obgleich er noch ein paar Loof Kartoffeln und ein Garniz Grütze besaß.
»Das Schrecklichste aber ist,« so schloß der Häusler seine Erzählung, »daß ich sie nicht einmal begraben kann, denn ich habe nichts, keinen Schlitten, kein Pferd, um sie wegzuführen, und keine Sachen, um sie mit Ehren in den Sarg zu legen.«
»Armer Mann,« sagte Heinz und sah zu Boden, damit der Häusler die Thränen nicht sähe, die ihm das Auge füllten, »armer Mann! Seid unbesorgt, wir wollen ihnen ein Begräbniß schaffen, an dem nichts fehlen soll. Litt Eure arme Frau sehr?«
Der Mann, der dankbar Heinzens Hand geküßt hatte, zuckte die Achseln.
»So äußerlich war nichts zu bemerken,« antwortete er; »aber Ihr wißt ja, wie die Weiber sind: sie sterben vor Schmerz, ohne eine Miene zu verziehen.«
Heinz verlangte nun, daß der Häusler ihn begleite; aber er stand davon ab, als dieser ihn fragte, ob er denn die todten Seinigen so mitten im Walde allein lassen solle. Er fuhr dann nach Hause und obgleich ihm der verrenkte Fuß arg weh that, so sorgte er doch mit solchem Eifer für das Begräbniß der Häuslerin, als ob sie eine verstorbene Fürstin und er ihr Hofmarschall gewesen wäre.
Er schickte zum Tischler nach Parkhof und ließ ein paar Särge bestellen; er beauftragte Emma, ihre alte Kunstfertigkeit wieder hervorzuholen, und kaufte, da gerade ein wandernder Krämer in Endhof vorsprach, alles nöthige Material in bester Qualität ein; ein Todtengräber mußte das Grab besorgen.
Als es dunkelte, fuhr er selbst wieder zu dem Häusler und durchwachte mit ihm die lange Nacht.
Die Beerdigung fand darauf mit großer Feierlichkeit statt und Heinz, der dem Häusler nicht von der Seite ging, sah mit innerster Rührung, wie wohl es dem armen, gebrochenen Manne that, daß die Seinigen, die es im Leben so schwer gehabt hatten, nun ein so anständiges Begräbniß fanden. Und anständig war es, so anständig, wie es nur die wohlhabendsten Wirthinnen haben konnten. Die Todten lagen in den besten Todtenhemden da, die Särge waren blau angestrichen; zwei herrschaftliche Pferde brachten sie auf den Kirchhof, auf dem das Grab an hervorragender Stelle, nicht weit vom Eingange, gegraben war. Sogar der Pastor fehlte nicht und hielt eine schöne Grabrede. Heinz und Weinthal trugen schwarze Kleider.
Heinz nahm den Wittwer zu sich und behielt ihn als Knecht auf seinem Hofe. Das Ereigniß war bald in aller Leute Munde und obgleich Heinz nur dem Zuge seines Herzens gefolgt war und natürlich nicht daran gedacht hatte, daß seine Handlung bekannt werden könnte, so trug sie doch nicht wenig dazu bei, daß die öffentliche Meinung über ihn, in Hof und Gesinden, fortan eine sehr günstige wurde. Ihn freilich berührte das wenig, denn er kümmerte sich um das Urtheil der Nachbarn ganz und gar nicht; aber Weinthal war unsäglich stolz auf seinen Herrn.
In Bachhof ging der Winter in eitel Sorge und Herzeleid hin. Zwar war im Sommer das Schulhaus fertig gestellt und feierlich mit Fahnenschmuck, Reden und Toasten eingeweiht worden, denn der Behrslappensche hatte ja schließlich das Geld auch ohne Obligation hergegeben; aber dafür war doch eine Obligation, und zwar eine sehr gewichtige, auf das Gut ausgestellt worden, denn Frau Eleonore sah ein, daß es sich in diesem Nothjahre nicht umgehen ließ. Sie war aber natürlich voll schwerer Sorge, denn ihr Wohlstand ging mit reißenden Schritten rückwärts und die stolze, energische Frau stand der drohenden Zukunft machtlos gegenüber. Zwar ganz verarmen konnte sie nicht, denn ihre Brüder waren sehr reiche Leute; aber es war ihrem Stolze unerträglich, daß ihre Söhne einmal auf die Unterstützung ihrer Onkel angewiesen sein sollten. Immer fester wurde in ihr der Entschluß, Duding jedenfalls allen Eventualitäten zu entziehen, indem sie dieselbe an Horace verheirathete. Horace war Frau von Schweinsberg gerade recht. Sein zartes, mädchenhaftes Betragen, seine ganze zierliche und liebenswürdige Art hatten für die energische und ein wenig männliche Frau etwas sehr Bestechendes und so vergab sie ihm die Mutter. Das Gefallen war gegenseitig. Auch Horace hatte Frau von Schweinsberg lieb gewonnen und war im Herbste oft dort gewesen. Als er nach Petersburg reiste, hatte sie, was sie nur höchst selten that, ihm Empfehlungsbriefe an ihre Brüder mitgegeben und sie freute sich, als ihr einer der Grafen schrieb, daß ihr junger Schützling allgemein gefalle.
Während die Mutter so im Geiste über ihre Tochter disponirte, litt diese nach wie vor die alten Qualen, und sie wurden nach und nach so unerträglich, daß Duding endlich selbst halb und halb bereit war, den ersten besten Mann zu heirathen, der sich um ihre Hand bewerbe, um durch eine solche Verbindung dem steten Kampfe gegen ihre Liebe zum Vetter ein Ende zu machen.
Mit den Zugvögeln kehrten auch die Reisenden allmälig zurück. Zuerst kam Horace. Er hatte eine sehr schöne Zeit verlebt und war sehr munter und frisch. Er erzählte viel von dem angenehmen Petersburger Leben und wußte namentlich die Freundlichkeit, mit welcher ihm die Brüder von Frau Eleonore entgegen gekommen waren, nicht genug zu preisen.
Später kehrten auch die Behrslappenschen zurück. Lehmhof selbst war über die große Summe, die der Aufenthalt in Florenz gekostet und über die Langeweile, die er dort empfunden hatte, außer sich; Lebrecht war so krank, verdrießlich und stumm wie früher; Adelheid sah den Aufenthalt daheim nur an wie eine Station. Sie und Otto hatten sich in Italien in ihrer Art trefflich amüsirt und Adelheid war fest entschlossen, Lebrecht für den Schluß des Jahres einen Winteraufenthalt in Neapel zu verordnen.
Endlich kehrte auch der Aarburgsche, der die Behrslappenschen in Wien verlassen hatte, zurück. Er war diesmal weder so sorglos, noch so selbstzufrieden wie sonst, denn Adelheid hatte ihn dazu beredet, nun endlich Ernst zu machen und Madeleine zu heirathen. Er meinte selbst einzusehen, daß er nicht anders könne, aber er war trotzdem voll Unruhe und ging nur mit dem größten Widerstreben daran, Madeleine wenigstens einigermaßen für sich zu gewinnen.