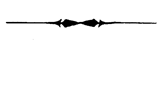|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Als die Gäste fort waren, wurde Adelheid gebeten, noch ein wenig Klavier zu spielen. Der Baron legte im Kaminzimmer Patience aus und richtete bei dieser Gelegenheit die stille Frage an's Schicksal, ob seine Gemahlin wohl auf das Verlangen Lehmhofs eingehen werde. Adelheid machte im Nebenzimmer ihren stürmischen Gefühlen in rauschenden Accorden Luft, die Baronin und ihre Tochter gingen langsam auf und ab, indem sie bald durch das hell erleuchtete Kaminzimmer oder das halbdunkele Klavierzimmer, bald durch das dunkele Kuppelzimmer, welches an das letztere stieß, schritten.
»War der Otto heute nicht wieder unerträglich roh und frech?« fragte die Baronin leise, als sie eben wieder einmal das dunkele Zimmer betraten.
»Ja,« erwiderte die Tochter.
»Könntest Du Dich,« fuhr die Mutter fort, »wohl je entschließen, die Frau eines solchen Mannes zu werden?«
»Nein, Mama, wie kommst Du auf diese Frage?«
»Nun, er ist doch immerhin eine blendende Erscheinung und er könnte andern Mädchen wohl gefährlich werden. Es freut mich, daß ich bei Dir sicher davor bin.«
»Ganz sicher, Mama.«
Sie schwiegen eine Weile. Dann fuhr die Mutter fort: »Es ist mir unbegreiflich, daß seine Verhältnisse noch immer nicht über ihn zusammengebrochen sind. Seit Jahr und Tag führt er das tollste Verschwenderleben, das je erhört gewesen, seine Schulden müssen daher wahrhaft colossal sein. Ich mag ihn nicht sehen. Ein solcher Mensch erscheint mir wie ein häßliches Ungeziefer, das in kein anständiges, reinliches Haus gehört. Wäre er nicht unser Neffe, ich duldete es nicht, daß er noch ferner unser Haus betritt; daß ein Mensch wie er, ein Mensch, der sich in jedem Schlamme gewälzt, den die Kultur oder die Rohheit zu Tage gefördert hat, Deine reine Hand in die seinige nimmt. Er ist darum ein so überaus gefährlicher Mensch, weil er, der Wüstling und Bösewicht, die anständigen Leute verachtet, indem er sich einredet, daß sie nur deshalb anders sind als er, weil es ihnen an Kraft fehlt, seine abscheulichen Pfade zu wandeln. Solche Menschen sind gesellschaftlich amüsant, weil es einen gewissen Reiz ausübt, mit Personen zusammen zu sein, welche die hergebrachten Begriffe von Anstand und Sittlichkeit auf den Kopf stellen, welche der Tugend offen den Rücken kehren, die Religion frech verspotten und als eine Angelegenheit verlachen, welche nur Schwachköpfe interessiren kann. Völlig inhaltlos, wie sie sind, fehlt es diesen Leuten gewöhnlich nicht an einem gewissen Muthe, der sie in einem ganz unverdienten ritterlichen Lichte erscheinen läßt. Sie, denen das verfehlte Leben eine schwere Last ist, sind natürlich in jedem Augenblicke bereit, einem Jeden mit Degen und Pistole entgegen zu treten, der sich ihr freches Gebahren nicht gefallen lassen will. Als ich noch in der großen Welt lebte, sind mir nicht wenige solcher Männer vorgekommen, Männer, an die ich ebensowenig ohne den innersten Abscheu denken kann, wie an Otto. Du kannst ihm gegenüber gar nicht zurückhaltend und abweisend genug sein, Duding. Vermeide es wo möglich, ihm die Hand zu reichen.«
Die Baronin schüttelte sich.
»Die Hand kann ich ihm doch nicht vorenthalten, Mama.«
»Nun, das geht allerdings kaum, aber richte es so ein, daß Du wenigstens einen Handschuh anhast. Solche Männer sind wie Aussätzige.«
Sie schwiegen wieder eine Weile, dann sagte die Mutter: »Bemerktest Du, in welche Aufregung Fräulein Eichenstamm gerieth, als mitgetheilt wurde, daß ihr Vetter zurückgekehrt sei?«
»Nein, Mama.«
»Hat sie Dir einmal von ihm erzählt? Ob sie nicht verlobt sind?«
»Nein, sie hat, so viel ich mich entsinne, nie von ihm gesprochen.«
»So? Das wundert mich. Ich meinte schon den Schlüssel zu ihrem merkwürdigen Entschlusse, als Gouvernante in unser Haus zu kommen, gefunden zu haben.«
Der Baron, dessen Patience bejahend ausgefallen war, und der das Eisen schmieden wollte, so lange in seiner Brust noch die eben gewonnene Siegeszuversicht frisch war, mahnte zum Aufbruche. Adelheid hörte auf zu spielen und ging mit Duding hinauf, der Baron und seine Gemahlin begaben sich in ihre Zimmer.
»Wenn es Dir recht ist, Eleonore,« sagte der Baron, »so komme ich nachher noch auf einen Augenblick zu Dir. Ich möchte mir gern Deinen Rath erbitten.«
»Komm,« erwiderte die Baronin kurz.
Der Baron begab sich zuerst in sein Arbeitszimmer und durchmaß es mit großen Schritten. »Fatal,« murmelte er von Zeit zu Zeit, »außerordentlich fatal! Wenn ich es irgend ändern könnte!«
Nachdem er eine halbe Stunde lang auf und ab gegangen war, begab er sich zu seiner Frau. Ihm war ganz so zu Muthe, wie früher, vor langen Jahren, wenn er zum Hauslehrer ging, um irgend einen unbesonnenen Streich einzugestehen.
Er fand die Baronin in einen schneeweißen Pudermantel gehüllt, auf einem kleinen Sopha sitzend und lesend. Ohne hinzusehen, wußte der Baron, was seine Frau las – es war die Bibel und zwar irgend eine Stelle aus dem alten Testamente, für welches sie eine heutzutage durchaus ungewöhnliche und dem Baron ganz unbegreifliche Vorliebe hatte.
Der Baron zauderte einen Augenblick in der Thüre.
»Störe ich nicht, meine Liebe?« fragte er.
Die Baronin schob das Lesepult, auf welchem die Bibel lag, ein wenig bei Seite, als wollte sie damit seine Frage verneinen und lud ihn durch eine Handbewegung ein, neben ihr Platz zu nehmen. Der Baron umschlang sie und drückte einen Kuß auf ihre Schulter. Dann stützte er den Kopf auf ihre Brust.
Diese Position hat unter Umständen ihre Annehmlichkeiten, denn die Betreffende kann uns dann nicht in's Auge sehen. Der Baron wußte das aus Erfahrung. Just diese Position hatte er in ähnlichen Fällen als Knabe der Mutter gegenüber eingenommen.
»Meine liebe, gute Eleonore,« sagte er zärtlich. Die Frau ließ ihn gewähren, schwieg aber und erwies ihm keinerlei Zärtlichkeit. Das war bei der seligen Mutter anders gewesen.
»Hast Du mich recht lieb?«
Die Baronin seufzte erst, als ob ihr sein Kopf die Luft benahm, dann sagte sie trocken:
»Was wolltest Du, Gustav? Du wolltest mich um einen Rath bitten.«
»Hast Du mich recht lieb, mein Frauchen?«
Die Baronin machte eine ungeduldige Bewegung. »Nimm's mir nicht übel, Gustav,« sagte sie endlich, »aber Dein Kopf ist wirklich nicht ganz leicht und ich huste ein wenig.«
Das war fatal! Der Baron richtete sich auf, ergriff aber nun mit beiden Händen die Linke seiner Frau und drückte einen Kuß auf sie. »Pardon, mein Täubchen,« sagte er. »Ich hätte daran denken sollen. Vergieb mir.«
»Was willst Du eigentlich, Gustav?« fragte die Baronin jetzt grade heraus. »Ich denke, Du wolltest mit mir über irgend eine Angelegenheit sprechen, aber Du thust ja, als ob es auf eine Schäferstunde abgesehen sei.«
Der Baron hielt sich die Hand vor den Mund und hüstelte eine ganze Weile, mehr aus Verlegenheit, als aus irgend einem anderen Grunde. Darum ließ sich für ihn so schlecht mit seiner Frau verhandeln, weil sie immer so nackt und dürr mit der Sprache herauskam, und weil sie nie auch nur auf einen Augenblick das Ziel, das sie verfolgte, aus den Augen ließ. Dabei hatte ihre Stimme in solchen Fällen einen unbeschreiblich kurzen, trockenen Tonfall.
»Ich wollte,« sagte der Baron schüchtern und sah vor sich nieder, »Dich allerdings um Deinen Rath bitten. Ich weiß, daß ich mich an Niemand wenden könnte, der mehr geeignet wäre, mir auch in schwierigen Fällen guten Rath ertheilen zu können, als Du.«
»Schön.«
»So ist sie,« dachte der Baron. »So ist sie ganz und gar. Sie hätte doch jetzt fragen können: Was ist es denn? oder – was ist geschehen? oder sonst etwas, aber nein, sie sagt ›schön.‹ Wie soll ich nun an dies verdammte ›schön‹ anknüpfen!«
Der Baron wußte, ohne daß er hinsah, daß seiner Frau große, dunkelgraue Augen ihn augenblicklich ungemein fest und ruhig anblickten und daß ihr Gesicht einen außerordentlich kalten und entschlossenen Ausdruck zeigte. Sollte er seine Bitte nicht lieber verschieben?
Die Baronin wartete einen Augenblick, dann zog sie die schönen Augenbrauen ein wenig in die Höhe, zuckte leicht mit den Achseln, stellte, indem sie ihre Linke wieder frei machte, das Lesepult vor sich hin und nahm ihre Lectüre wieder auf.
Der Baron rollte eine Weile seinen langen Schnurrbart zwischen den flachen Händen, dann sagte er plötzlich:
»Hättest Du etwas dagegen, liebe Frau, wenn ich mir eine Cigarre anzündete?«
Die Baronin warf erst einen Blick auf ihr Bett, dann einen zweiten auf ihre Gardinen, sagte dann aber »bitte« und las weiter.
Der Baron rauchte aus Leibeskräften an seiner Cigarre und warf von Zeit zu Zeit einen Blick auf seine Frau, die unbeweglich da saß und nur dann und wann die Querstange des Lesepultes aufhob und das Blatt umwendete. Frau Eleonore war gewiß nie neugierig gewesen.
Der Baron schwankte rathlos hin und her. Endlich entschloß er sich, sein Schicksal den Knöpfen seiner Weste anzuvertrauen und zählte sie leise. Es waren ihrer sechs, also eine gerade Zahl, die eine bejahende Antwort repräsentirte.
»Ich bin in großer Geldverlegenheit, Eleonore,« begann er.
»Nun?« Die Baronin schob das Pult weg.
»Du weißt, Eleonore, daß das Schulhaus mir viel Geld gekostet hat, Du weißt auch, daß es nothwendig in diesem Jahre weitergebaut werden muß, und doch habe ich kein Geld dazu.«
»Du hast wieder gespielt.«
»Wahrhaftig nicht, Eleonore, bei Gott nicht.«
»Wo sind denn die 500 Rubel, die Du neulich von Lehmhof liehest?«
»Wie, neulich? Ich habe ›neulich‹ gar nichts von ihm geliehen.«
»Du hast doch vor etwa drei Monaten bei Lehmhof 500 Rubel geliehen,« wiederholte die Baronin in sehr bestimmtem Tone.
»Nun ja, aber das ist doch nicht ›neulich‹.«
»Wie Du fragen kannst, Eleonore! Wie Du merkwürdig fragen kannst. Jetzt, bei der Knechtswirthschaft sind 500 Rubel kein Geld. Das ist nicht mehr wie früher, wo 500 Rubel eine große Summe repräsentirten. Bei der Knechtswirthschaft sind 500 Rubel ein Tropfen auf einen heißen Stein. Weiter nichts, Eleonore.«
»Schön, aber wohin ist dieser Tropfen gefallen?«
»Nun, in die Wirthschaft, meine Liebe, natürlich in die Wirthschaft. Ich mußte den Leuten den Lohn auszahlen, es mußte dies und das angeschafft werden.«
Die Baronin schüttelte den Kopf. »Du redest nicht die Wahrheit,« sagte sie streng, »ich sehe es Dir an. Du hast weder Lohn ausgezahlt, noch irgend etwas angeschafft. Du hast das Geld verspielt.«
Der Baron brauste auf. »Ich verbitte mir das, Eleonore,« rief er, »ich verbitte mir das. Ich sagte Dir schon, daß ich nicht gespielt habe.«
»Kannst Du mir Dein Ehrenwort geben, daß Du nicht gespielt hast, seit Du von Lehmhof das letzte Mal das Geld erhieltest?«
»Aber, liebe Eleonore, das ist so lange her.«
»Gieb mir Dein Wort.«
»Das kann ich nicht. Es ist so lange her, daß es nicht unmöglich ist, daß ich ein Jeuchen gemacht habe. Aber gespielt habe ich nicht, wahrhaftig nicht.«
Es war nicht recht klar, was der Baron hier für einen Unterschied machte, aber der Baronin lag auch nichts an den Worten.
»An wen hast Du verloren?« fragte sie.
»Ich weiß nicht, mein Herzchen, ich weiß nicht. Es war jedenfalls eine ganz unbedeutende Summe, eine wahre Bagatelle, es lohnte sich nicht der Mühe, sie auch nur anzuschreiben.«
»Schön, an wen verlorst Du diese Bagatelle?«
»Ich erinnere mich nicht genau, aber ich denke, es war an Lehmhof und an Otto.«
»Wann spieltet Ihr?«
»Ich entsinne mich nicht, aber ich denke, es muß auf der Entenjagd in Behrslappen gewesen sein.«
»Also gleich, nachdem Du das Geld erhalten hattest?«
»Nicht lange darauf. Aber beunruhige Dich nicht, mein Täubchen, es war ein ganz unbedeutendes Geldstück. Man schämt sich, davon zu sprechen.«
»Du brauchst also wieder Geld?«
»Ja, mein Liebchen, ich brauche Geld für das Schulhaus. Wir müssen uns damit beeilen, wenn es noch in diesem Winter bezogen werden soll, und das ist doch sehr wünschenswerth. Ich habe schon darüber nachgedacht, wer die Einweihungsrede halten soll. Du wirst mir zugeben, daß in diesem Falle die Wahl des Redners von großer Wichtigkeit ist, denn es wird darauf ankommen, daß man es den Bauern recht an's Herz legt, daß sie ihre Kinder nur dann zu wahrhaft tüchtigen Wirthen machen können, wenn sie ihnen die Möglichkeit geboten haben, sich unterrichten zu lassen. Was die Fahnen anbetrifft, so werden diejenigen, welche noch von Dudings Konfirmation her vorhanden sein müssen, genügen. Oder meinst Du vielleicht, daß man neue machen lassen sollte?«
»Wo hoffst Du das Geld zu erhalten?« fragte die Baronin, als ob sie die Fahnenfrage gar nicht gehört hätte.
»O, das macht keine Schwierigkeiten. Lehmhof will es mir borgen.«
»Nun, dann nimm es.«
Der Baron räusperte sich. »Die Sache hat noch einen Haken,« sagte er.
»Welchen?«
»Mein liebes Herzchen, ich muß da etwas weiter ausholen. Du weißt, daß wir in den letzten Jahren nur sehr mittelmäßige Ernten gehabt haben, und Du weißt ebenfalls, daß die Einführung der leidigen Knechtswirthschaft große Kapitalien verschlungen hat. Das Geld ist zwar nicht verloren, denn es steckt ja im Inventar, aber es ist immerhin gebunden. Du weißt auch, daß das erhöhte Bankdarlehen so großen Ansprüchen gegenüber nicht genügte, nicht genügen konnte und ich daher gezwungen war, mir anderweitig die Summe zu verschaffen, deren ich zur Bestreitung der kleineren Ausgaben bedurfte. Wie Du ferner weißt, mein Vögelchen, verschaffte ich mir das Geld großentheils von Lehmhof, der mir nach und nach gegen 6000 Rubel lieh, wenn ich nämlich die 500 Rubel, die er mir jetzt geben will, mitrechne. Nun hat er mir bis jetzt das Geld, so zu sagen, auf mein ehrliches Gesicht geborgt. Das ist außerordentlich anständig von ihm, sehr ehrenhaft. Findest Du das nicht auch, mein Herzchen?«
»Nun, und jetzt wünscht er eine Hypothek darüber, nicht wahr?«
»Nicht gerade eine Hypothek, mein liebes Mäuschen, nicht gerade eine Hypothek. Er würde es natürlich gern sehen, wenn wir ihm eine Obligation ausstellten.«
»Das heißt, er will Dir nur unter dieser Bedingung fernerhin leihen?«
»Nein, das hat er nicht gesagt, wenigstens nicht ausdrücklich.«
»Gustav, das hat er doch gewiß ganz ausdrücklich zur Bedingung gemacht?«
»Nun, und wenn er das gethan hätte, wer könnte ihm das übelnehmen? Es ist am Ende doch nur ein natürlicher Wunsch, daß er seine Forderung gegen alle Wechselfälle sicher gestellt sehen will. Er ist ja auch nicht reich, und ich bin ein alter Mann und kann alle Tage sterben.«
»Er ist sehr reich und wird alle Tage noch reicher. Ich will Dir was sagen, Gustav – die verlangte Obligation werde ich nie und nimmer ausstellen. Es ist mir lange ganz gleichgültig erschienen, ob Bachhof Dir oder mir gehört, aber jetzt kann ich mich nicht genug darüber freuen, daß ich die Besitzerin bin und, verlasse Dich darauf, es bleiben werde. In den zwanzig Jahren, die wir verheirathet sind, ist unser Wohlstand beständig rückwärts gegangen. Du bist nicht nur mit Deinem eigenen Vermögen fertig geworden, sondern hast auch das meinige auf ein Drittheil reducirt. Wir sind jetzt selbst für Landedelleute arm geworden, und wir würden Bettler werden, wenn ich Deiner unseligen Leidenschaft noch ferner nachgeben wollte. Ich werde die Obligation nicht ausstellen. Ich werde an unsere Kinder denken und ihnen die Möglichkeit erhalten, einmal etwas Anderes zu werden, als jagende und spielende Landjunker.«
»Aber, liebe Frau,« unterbrach sie der Baron, »Du siehst zu schwarz. Auch wenn wir die 6000 Rubel auf Bachhof eintragen lassen, werden unsere Söhne immer noch genug haben, um einmal studiren und sich selbst ihr Brod erwerben zu können.«
»Nein, das ist nicht genug,« erwiderte Frau Eleonore. »Es würde mir auch nicht genügen, wenn meine Söhne einmal Oberhauptleute oder Oberräthe würden. Sollen sie die Connexionen, die ich selbst noch von früher her habe, sollen sie die hohen Stellungen, die meine Brüder einnehmen, einmal ausnutzen können, und das muß geschehen, so müssen unsere Söhne auch hinreichend vermögend sein, um ein paar Jahre in der großen Welt leben zu können, ohne sich um des lieben Brodes willen nach der ersten besten Stelle umsehen zu müssen. Wir haben vier Söhne, Gustav. Angenommen auch, daß Duding so heirathet, daß sie ihr Erbtheil den Brüdern zuwenden kann, so bleibt für die Knaben immerhin wenig nach. Es wird mir schwer genug, mich an den Gedanken zu gewöhnen, arme Edelleute geboren zu haben, ich will wenigstens nicht, daß unsere Kinder wie Bettler in die Welt treten. Ich weiß, was es heißt, ein armer Edelmann sein. Während der mit großem Vermögen ausgerüstete Adel ganz geeignet ist, die feinste Blüthe der Menschheit zu erziehen, die edelsten Empfindungen, die ehrenhaftesten, sittenstrengsten Charaktere auszubilden, ist die vornehme Geburt für den Armen nichts als eine fast unüberwindliche Versuchung, mit den Ahnen zu renommiren und sich mit dem Wappenschilde die Augen zu verdecken gegen alles Schöne und Gute, gegen jeden Fortschritt, gegen jedes Hinausgreifen über den Kreis der täglichen, gemeinen Wirklichkeit.«
»Du übertreibst, Eleonore. Wir sind doch auch ganz wackere Leute.«
»Schön, das seid Ihr zum Theil, und wenn ich meinen Kindern einmal große Güter hinterlassen könnte, deren Bewirthschaftung das Leben auch eines gebildeten, tüchtigen Mannes ausfüllen und befriedigen kann, so würde ich sie für dieses Land und für diesen Beruf erziehen, aber da ich das nicht kann, so sollen sie mir hinaus in die weite Welt, wo ihnen ihr Name und ihr Stand wohl ein Sporn sein kann, sich auch die Mittel zu erwerben, die nun einmal zu ihm gehören. Sie sollen nicht auf Kosten anderer, tüchtigerer Leute ein träges, anspruchloses, allen höheren Zielen abgewendetes Leben führen. Du sagst, Ihr wäret hier ganz wackere Leute. Schön! Du bist ein wackerer Mann, aber ist es Lehmhof auch? Du glaubst ihn zu kennen, Gustav, aber Du täuschest Dich. Ich durchschaue diesen Mann vollkommen. Er ist ein gewissenloser, kaltberechnender Schuft, der nichts anderes im Sinne hat, als Euch Alle hier um Euer Hab und Gut zu bringen und sich selbst Eurer Güter zu bemächtigen. Er reizt Euch zum Spiele, er begünstigt jedes Eurer Laster und leiht Euch dann bereitwillig Geld, das er Euch doch wieder abnimmt, bis Ihr ihm endlich so viel schuldig sein werdet, daß er die Maske abwerfen kann.«
»Aber, Frau, wie kannst Du so von Lehmhof sprechen, er ist doch immerhin ein Edelmann!«
»Warum nicht? Hast Du nie einen Edelmann gesehen, der ein Schuft war? Wenn Fräulein Eichenstamm hier wäre, so würde ich es auch nicht sagen; aber warum sollen wir hier mit einander Komödie spielen. Seelenadel und Geburtsadel, das sind zwei Dinge, die zwar manches mit einander gemein haben, die sich aber keineswegs decken. Ich durchschaue den Mann vollständig, er ist ein regelrechter Schurke.«
»Frau,« rief der Baron eifrig und sprang auf, »das darfst Du nicht wieder sagen. Das will ich von dem Manne, mit dem ich eben an demselben Tische gegessen habe, das will ich von Lehmhof nicht hören. Ein Schweinsberg verkehrt nicht mit Schurken.«
Die Baronin lächelte verächtlich. »Natürlich,« sagte sie spöttisch, »wenn einer Schweinsberg heißt, so ist er auch ein Ehrenmann.«
»Donnerwetter, ja,« brauste der Baron auf. »Ja, wer Schweinsberg heißt, ist ein Ehrenmann und wird es auch allezeit bleiben.«
Die Baronin erhob sich. »Ich glaube, es wäre gut, wenn Du jetzt gingest,« sagte sie kalt. »Ich bin nicht daran gewöhnt, daß man in diesem Tone zu mir spricht, und ich beabsichtige auch nicht, mich künftig daran zu gewöhnen.«
Der ruhige Ton ihrer Sprache brachte den Mann sogleich wieder zu sich und er war wirklich innerlichst zerknirscht. Er bat so lange für seine Heftigkeit um Vergebung, bis sie ihm zu Theil wurde.
»Das, was Du von der angeborenen Ehrenhaftigkeit der Schweinsberg sagtest,« fuhr die Baronin unbeirrt fort, als Beide wieder Platz genommen hatten, »sind nichtssagende Phrasen, mit denen die Leute sich selbst betrügen. Es giebt kein Geschlecht, das im Laufe der Zeit nicht auch schlechte Subjekte hervorgebracht hätte, und die Schweinsbergs machen davon keine Ausnahme. Hältst Du zum Beispiel Otto für einen ehrenhaften Menschen?«
»Gewiß, Eleonore, gewiß. Otto ist ein wilder, ausgelassener Mensch, aber ein tadelloser Ehrenmann.«
»Würdest Du Dich wohl dazu entschließen können, diesem tadellosen Ehrenmanne Deine Tochter zu geben?«
»Wie? Duding?«
»Ja, Duding.«
»Aber wie kommst Du nur auf den Einfall?«
»Nun, es wäre jedenfalls doch nicht ganz unmöglich, daß er auf den Einfall käme, um sie anzuhalten, und ich wünsche zu wissen, was Du in diesem Falle zu thun gedenkst.«
»Duding will er haben? Nein, die bekommt er nicht.«
»Willst Du mir Dein Ehrenwort darauf geben, daß Du sie ihm nicht giebst?«
»Aber Frau, was willst Du nur damit? Er spricht ja kaum einmal mit ihr.«
»Einerlei. Gieb mir Dein Wort.«
»Ja, das will ich. Da hast Du es (der Baron reichte seiner Frau die Rechte), da hast Du mein Ehrenwort. Otto ist ein tadelloser Ehrenmann, wie alle Schweinsbergs, aber Duding? Nein, die Traube hängt für solche Gesellen zu hoch.«
»Das ist auch meine Meinung. Hoffentlich wirst Du nicht in die Lage kommen, an Dein heute gegebenes Wort denken zu müssen.«
Die Baronin beugte sich vor, um nach der Uhr zu sehen, und diese Bewegung erinnerte den Baron an den Zweck seines Kommens.
»Liebe Frau,« sagte er, »bedenke Dir noch die Angelegenheit mit den 6000 Rubeln, meine Ehre ist dabei gewissermaßen verpfändet.«
»Hast Du ihm denn, als Du das Geld nahmst, eine Obligation versprochen?«
»Nein, wie konnte ich das?«
»Nun, dann hat er Dir also das Geld auf Dein ehrliches Gesicht geliehen und so mag es denn auch bleiben!«
»Aber wie wird es mit dem Schulhause?« fragte der Baron kleinlaut.
»Nun, das muß eben stehen, wie es ist, bis wir die Mittel haben, es auszubauen. Wir dürfen nicht mit fremdem Gelde großmüthig und wohlthätig sein. Es ist spät, Gustav.«
Der Baron verabschiedete sich zärtlich und ging. Er hatte ganz und gar nichts erreicht, aber er war voll Bewunderung für seine Frau. Der eigentümliche, ideale Zug, der ihm an ihr, trotz ihrer anderweitigen Nüchternheit entgegentrat, ihre gerade, offene Art, ihr überlegener Verstand, vor allem ihre unzerstörbare Ruhe hatten für ihn, den leichtsinnigen, gutmüthigen aber oberflächlichen Lebemann, etwas unendlich Imponirendes. So war sie schon als ganz junges Mädchen gewesen, da er als Gardeoffizier die allzujugendliche Hofdame kennen lernte und sich leidenschaftlich in sie verliebte. Was aber die junge Gräfin bewogen hatte, ihn zu lieben, sie, die reiche Erbin, deren Brüder glänzende Carriere in der diplomatischen Laufbahn machten, hatte der gute Baron nie begriffen. Er vergalt ihr diesen Entschluß übrigens durch die größte Liebe und Hochachtung, ließ sich aber freilich dadurch nicht abhalten, ihr in einem Punkte nicht zu gehorchen – im Punkte des Spieles, dem er leidenschaftlich ergeben war. Ihn von dieser Leidenschaft abzuhalten vermochte selbst Frau Eleonore nicht.
Während unten der Baron gezwungenermaßen beichtete, wurden auch oben Bekenntnisse abgelegt.
Als Adelheid und Duding auf ihre Zimmer gegangen waren, trat letztere nach ihrer Gewohnheit ein wenig zu Adelheid ein, um noch ein Plauderstündchen abzuhalten. Die Beiden setzten sich an's Fenster und schauten hinaus auf die Baumwipfel im Garten, auf die der Vollmond sein mildes Licht warf.
»Adelheid,« sagte Duding plötzlich und legte ihre Hand auf das Knie der Gefährtin, »lieben Sie Ihren Vetter?«
Adelheid lachte laut auf. Sie lachte bei jeder Gelegenheit, aber ihr Lachen klang nur sehr selten wirklich fröhlich, gewöhnlich glich es mehr einem Geschrei, als einem Gelächter.
»Du liebe Seele,« rief sie, »wie kommen Sie auf diesen Einfall?«
»Sie errötheten heute, als erzählt wurde, daß Ihr Vetter zurückgekehrt sei.«
»Wirklich? War es sehr bemerklich?«
»Aufrichtig gesagt, Adelheid, ich habe es nicht selbst gesehen, aber Mama sagte es mir.«
Adelheid lehnte den Ellenbogen auf das Fensterbrett, stützte den Kopf in die flache Hand und sagte dann:
»Warum soll ich es Ihnen übrigens nicht sagen, Duding. Ja, ich liebe meinen Vetter und was noch mehr werth ist, er liebt mich auch.«
»Und deshalb wurden Sie bei uns Gouvernante?«
Adelheid nickte. »Ja, er sollte mich hier finden, wenn er zurückkehrte.«
Duding schwieg eine Weile und sah nachdenklich vor sich hin. Dann fragte sie:
»Sind Sie verlobt, Adelheid?«
»Ja und nein,« erwiderte diese. »Da ich gerade in der Stimmung bin, will ich Ihnen den Hergang erzählen.«
»Ich wurde, wie Sie wissen, seinerzeit zu Verwandten hierher in's Land geschickt, um meine Schulbildung zu vollenden. Damals lernte ich meinen Vetter kennen, der in der Stadt das Gymnasium besuchte. Wir zogen uns gegenseitig an, wie der Magnet das Eisen, denn wir sind wie für einander geschaffen, und wir gewannen uns binnen Kurzem so lieb, wie nur immer zwei leidenschaftliche und groß angelegte Naturen sich lieb haben können. Wir waren bald unzertrennliche Kameraden, die im Winter zusammen Schlittschuh liefen, im Sommer zusammen zu Boot fuhren und die so wenig ohne einander sein konnten, wie ein Paar Inséparables. Nun war ich damals im Hause meines Onkels, des Oberlehrers Eichenstamm, und meine Tante war und ist eine unerträglich pedantische, prüde Person. Diese entdeckte durch einen Zufall unser Verhältniß und hielt es für angemessen, darüber Allarm zu schlagen, ja, sie ging so weit, mich ohne Weiteres einzupacken und einfach meinen Eltern wieder zuzuschicken, ohne daß ich auch nur Zeit gehabt hätte, meinen Vetter noch einmal zu sehen. Zu Hause, wo sie Heinz nicht kannten, war man Anfangs natürlich Feuer und Flammen und bewachte mich mit Argusaugen. Ich hatte aber das schon vorhergesehen und meinem Vetter geschrieben, daß wir keine Briefe miteinander wechseln, uns aber jedenfalls treu bleiben wollten bis in den Tod. Da wir uns gegenseitig verstehen, so ist er denn auch auf meinen Wunsch eingegangen, und ich habe, seit wir damals so plötzlich getrennt wurden, kein Sterbenswörtchen direct von ihm gehört. Später, als ich nun ganz erwachsen war und mir bei den Eltern die Freiheit durchgesetzt hatte, zu thun und zu lassen, was ich wollte, habe ich wohl mitunter daran gedacht, an ihn zu schreiben und überhaupt mit ihm in Correspondenz zu treten, aber jetzt freut es mich doch, daß es nicht geschehen ist. Es hätte wie Mißtrauen in die Kraft und Dauer seiner Gefühle ausgesehen, und hätte ihn, der ungemein stolz und reizbar ist, vielleicht verletzt. Wenn Menschen unseres Schlages sich lieben, so bedarf es keiner Correspondenz, jeder Herzschlag des Einen gehört ohnehin dem Andern. Ich bin hübsch und meine Eltern sind angesehene und wohlhabende Leute, da hat es mir nicht an Bewerbern gefehlt, aber sobald ich ihre Absicht bemerkte, habe ich ihnen immer offen den Widerwillen gezeigt, den sie mir von Stund an einflößten.«
»Aber warum verließen Sie Ihr Elternhaus?« fragte Duding. »Ihr Vetter konnte Sie doch auch dort aufsuchen.«
»Ja wohl, aber einmal trieb es mich, ihn da wiederzufinden, wo ich ihn verlassen hatte, dann hoffte ich auch, hier mehr von ihm zu hören, als zu Hause. Es kamen auch noch andere Umstände hinzu. Durch die paar Jahre, die ich hier verlebt hatte, war ich für die Heimath verdorben, denn ich hatte andere Menschen kennen gelernt, als die ich dort fand, und ich konnte mich in das fade Treiben der halbpolnischen Gesellschaft nicht mehr finden. Ein Mädchen, das meinen Vetter liebte, konnte keine Freude daran haben, mit Polinnen zu plaudern oder sich von jungen Offizieren den Hof machen zu lassen. Ich kann nicht unthätig sein, Duding. Ich hatte hier arbeiten gelernt und konnte mich an den geschäftigen Müßiggang daheim nicht gewöhnen. Meine Mutter ist eine überaus thätige, energische Frau, die Alles thut, was in der Wirthschaft irgend zu thun ist, das ganze Haus ist so voll von Dienstboten, daß der Eine über den Andern stolpert, für mich blieb auch nicht die geringste Beschäftigung übrig. Ich wollte Stunden geben, aber mein Vater meinte, daß es sich für das einzige Kind eines Gymnasialdirectors nicht schicke, für Geld Unterricht zu ertheilen und verbot es mir. Nun versuchte ich es mit einer wohltätigen Anstalt, aber ich sah bald ein, daß es da doch nur auf eine Spielerei hinauslief, und daß eine solche Thätigkeit mir keine Befriedigung gewähren konnte. Dazu bin ich, wie Ihnen wohl bekannt ist, ein überaus unliebenswürdiger Charakter und vertrug mich daher nicht mit den Meinigen. So faßte ich denn den Entschluß, den Knoten, den ich nicht lösen konnte, zu zerhauen und führte ihn auch trotz alles Zetergeschreis der lieben Meinigen aus.«
»Sie Glückliche,« sagte Duding und seufzte.
»Ja, Duding, ich bin wohl sehr glücklich. Sie kennen Heinz nicht, er ist ein herrlicher Mensch, ein Mensch, wie von Stahl. Was der einmal beschlossen hat, das führt er auch, es möge sich ihm in den Weg stellen, was da wolle, aus. Nun, Sie werden ihn kennen lernen. Er ist eben so schön von Antlitz und Gestalt, wie voll Geist und Willenskraft. Ihr Vetter Otto erinnert mich vielfach an ihn, und darum bin ich mit ihm so gern zusammen. So wäre Heinz vermuthlich, wenn er roh und ungebildet wäre. Aber Pardon,« unterbrach sich Adelheid plötzlich und lachte hell auf, »das hätte ich eigentlich nicht sagen dürfen.«
»Warum nicht?«
»Nun, Duding, mir machen Sie nichts vor. Ich spreche mit der künftigen Frau von Schweinsberg.«
»Nein Adelheid,« sagte Duding, indem sie aufstand und sich abwandte, sehr ernst, »nein Adelheid, Sie haben recht, er ist roh und ungebildet, Sie hätten auch noch hinzufügen können: Er ist frech und unverschämt und eben darum wird man mich nie so nennen. Nie, Adelheid, nie!«
Mit diesen Worten ergriff Duding ein Licht und ging, ohne sich nach Adelheid umzuwenden, in ihr Zimmer. Adelheid folgte ihr nicht. So selbstsüchtig und rücksichtslos sie auch war, so fühlte sie doch, wie aus Dudings Worten ein so tiefer Schmerz sprach, daß sie ihre unvorsichtigen Worte aufrichtig bereute und Duding in die Einsamkeit gehen ließ, in der allein solche Wunden heilen.