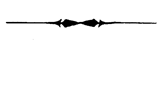|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Am folgenden Morgen fuhr Heinz zur Stadt, um Onkel Konrad aufzusuchen. Er war, während er in der Stille der Nacht in seinem Zimmer unruhig auf und nieder ging, zu dem Entschlusse gekommen, unter jeder Bedingung bei seinem Vorhaben zu bleiben und sich durch keine Erwägung davon abbringen zu lassen. Sein Widerwille gegen sein Fach, die unseren Landsleuten eigene, unaustilgbare Sehnsucht nach dem Landleben, sein Eigenwille und sein Stolz – Alles vereinigte sich dazu, seinen Entschluß zu einem unerschütterlichen zu machen. Heinz Eichenstamm ist nicht der Mann, der seine Absicht aufgiebt, weil sich ihrer Verwirklichung Schwierigkeiten in den Weg stellen. Damit schloß er seine Betrachtungen, allein er blieb unruhig und aufgeregt, denn die letzten Jahre, mehr noch die letzten Tage, hatten mächtig an seinem Selbstgefühle gerüttelt, und wenn er es auch noch nicht klar erkannte, so begann er es doch instinctiv zu fühlen, daß er sich in Bezug auf seine Person und in Bezug auf die Stellung, welche dieselbe in der Welt einnehme, bisher seltsamen Illusionen hingegeben hatte. Vorläufig wollte er freilich selbst nichts davon wissen, aber die Fluthen des Lebens hatten bereits begonnen, das Erdreich unter dem Thurme, der bis zum Himmel emporreichen sollte, wegzuspülen und von Zeit zu Zeit erzitterte der ganze Bau.
Der Empfang, den Heinz bei Onkel Konrad fand, war ein sehr herzlicher. Der Doctor war einmal von Natur geschmeidiger als der Pastor und konnte sich leichter in andere Menschen hineinversetzen als dieser, außerdem hatte er auch von allen Familiengliedern von jeher noch am meisten persönliche Beziehung zu Heinz gehabt. Aber auch Heinz war unter dem demüthigenden Eindrucke seiner Lage ihm gegenüber zugänglicher, als es sonst wohl in seiner Art lag.
Als Heinz dem Onkel seine Absicht mittheilte, wollte dieser davon ebensowenig hören als der Pastor, und er bot seine ganze Beredtsamkeit auf, um den Neffen, den er lieb hatte, zu einer Aenderung seines Entschlusses zu bringen. Natürlich ganz vergeblich. Obgleich Heinz die Berechtigung alles Dessen, was der Doctor vorbrachte, innerlich anerkennen mußte, so blieb er doch trotzig bei seinem Willen.
Der Doctor war in großer Aufregung. Er hatte es schon einmal ansehen müssen, daß sein Mündel (er und der Pastor waren Heinzens Vormünder) einen Schritt that, der ihm das künftige Leben ungemein erschweren mußte, jetzt sollte er gar erleben, daß Heinz sich sein Lebensglück vollständig zerstörte, ohne es ändern zu können. Er sah mit mathematischer Gewißheit voraus, daß die Landwirthschaft, die Heinz jetzt so ohne alle praktische Vorkenntnisse ergriff, denselben um sein Vermögen bringen würde; er sah voraus, daß der Neffe in ihr, unter so ungünstigen Umständen, keinerlei Befriedigung finden könne; er sah endlich voraus, daß der Weg, den der reich begabte, geistvolle Jüngling einzuschlagen im Begriffe war, auf ein verfehltes Leben hinausführen mußte. Auf der anderen Seite kannte er den störrischen Eigensinn und Trotz des ganzen Geschlechts, kannte er speciell Heinzens unbeugsamen, hochmüthigen Sinn.
Der Doctor war im Grunde eine ebenso kalte und doch auch leidenschaftliche Natur wie die Andern; aber die letztere Eigenschaft bewirkte eben, daß er seinen Gefühlen, wenn sie einmal erregt waren, einen heftigen und darum ungemein wirksamen Ausdruck verlieh.
»Lieber Heinz,« sagte er, indem er beide Hände schwer auf des Neffen Schultern legte, mit leise bebender Stimme, »lieber Heinz, achte ein Mal, nur dieses einzige Mal auf meinen, auf unseren Rath. Versperre Dir nicht selbst muthwillig jeden Weg zu einem befriedigenden Dasein. Erkenne nur ein Mal, nur dieses Mal die Ueberlegenheit an, die Alter und reife Erfahrung verleihen, und füge Dich unserem Willen. Willst Du aber durchaus bei Deinem Entschlusse beharren, nun, so mache wenigstens vorher Dein Examen und werde dann erst Landwirth. Du wirst dann die Möglichkeit haben, Dir, wenn Deine Landwirthschaft zusammenbricht, eine anderweitige Existenz zu begründen, ohne Dich wieder auf die Schulbank setzen zu müssen. Gieb nach, gieb wenigstens darin nach, Heinz. Wenn Du das nicht thust – Heinz, ich kenne Dich seit frühester Jugend und dies ist nicht die Stunde um zu scherzen – wenn Du das nicht thust, so wirst Du einmal als Selbstmörder zu Grunde gehen. Denke an Deine Mutter, Heinz, denke an Deine selige Mutter. Mache, daß Du einmal zu ihr kommen kannst, wenn Deine Lebensuhr abgelaufen ist. Du bist bisher nie glücklich gewesen, Heinz, ich weiß es sehr wohl, und Du wirst auch nie glücklich sein, denn Du bist, wie Dein Vater war, und gab es je einen innerlich unglücklicheren Mann Zeit seines Lebens, so war er es – nun, sorge wenigstens dafür, daß Du Dich einst mit Der vereinigen kannst, die Dich so tief geliebt hat.«
Der Doctor ließ Heinz los und ging mit großen Schritten im Zimmer auf und ab.
»Nein,« sagte er, indem er wieder vor Heinz stehen blieb, »nein, für uns Eichenstamms giebt es auf Erden kein wahres Glück, denn wir sind selbstsüchtig und hochmüthig. Sieh Dich um in unserem Geschlechte, wo findest Du bei uns jene zarte Rücksicht der Blutsverwandten gegen einander, jene liebevolle Pietät der Jungen gegen die Alten, wie in anderen Familien? Trotzig und eigenwillig geht Jeder von uns seinen Weg und thut dabei nach außen, als ob er so glücklich wäre, wie man es nur sein kann, und doch sind wir innerlich zerrissen und unglücklich und sehnen den Tag herbei, da das Ganze ein Ende hat.
»Ich bin selbst nicht besser, Heinz. Ich sehe es ein, woran es liegt, aber ich kann es nicht ändern. Wenn ich den Mangel vielleicht mehr fühle als die Andern, so liegt es daran, daß ich schweres Leid erfahren habe, schweres Seelenleid. Dir kann ich es ja sagen, was nie ein anderer Mensch erfahren hat, noch erfahren wird – die, um deretwillen ich dies Leid erfuhr, war dieselbe, bei deren uns Beiden unvergeßlichem Bilde ich Dich jetzt beschwöre, meine Bitte zu erfüllen. Du bist ihr Sohn, Heinz. Was soll ich ihr sagen, wenn sie Dich einst vergeblich erwartet, weil Du Dich selbst für ewig von ihr getrennt hast? Und das wird geschehen, Heinz, das muß geschehen, wenn Du dabei bleibst, Dir selbst jede befriedigende Thätigkeit unmöglich zu machen. Glaube mir, Heinz, hätte ich damals, als ich so Schweres erdulden mußte, nicht meinen Beruf gehabt, dem ich ergeben war, in dem ich mir die Ruhe erarbeiten konnte, deren der Mensch bedarf – man hätte mich eines Tages mit zerschmettertem Schädel an meinem Schreibtische gefunden.«
Als der Doctor so sprach, da blitzten in seinen Augen Thränen, Thränen eines weichen Gefühls. Es geschah nicht oft, daß sich Thränen in ein Eichenstamm'sches Auge verirrten und sie hätten auf jeden Andern einen überwältigenden Eindruck gemacht; aber der, welcher sie sah, war ja selbst ein Eichenstamm, ein trotziger, eigensinniger, hochmüthiger Eichenstamm, der nicht lernen wollte aus den Erfahrungen Anderer, aus den Leiden Anderer, der selbst Alles durchmachen mußte, was das Leben an Leid und Schmerz bewahrt für den, der allein seines Weges gehen will, der vielleicht erst dann erkennt, daß der Mensch ein hinfällig und gebrechlich Wesen ist ohne den starken Herrn der Heerschaaren und die liebevolle Hülfe des Nächsten – wenn es zu spät ist, zu spät wenigstens für jene Spanne Zeit, die man ein »Menschenleben« nennt.
»Nein,« knirschte Heinz zwischen den Zähnen hervor, »nein. Ich bleibe bei meinem Entschlusse.«
»Nun, wie Du willst,« sagte der Onkel. Er sagte das ganz ruhig, mit jenem schlaffen, müden Gesichtsausdrucke, wie man ihn bei sehr leidenschaftlichen Menschen nach einem heftigen Ausbruche ihres Gefühls wahrnimmt.
»Komm, setze Dich her,« fuhr der Onkel fort. Auch seine Stimme klang müde und matt.
»Hast Du schon mit Onkel Konrad gesprochen?« fragte er.
»Ja, und ich habe mich mit ihm überworfen,« erwiderte Heinz.
Es lag in seiner Art, so etwas ganz nackt und dürr hinzustellen. Der Onkel zuckte die Achseln.
»Du hast Dir dadurch den besten Rathgeber geraubt,« sagte er, »den Du für Deine Landwirthschaft hättest haben können. Aber es ist ja doch einerlei!«
»Du verfügst,« fuhr der Doctor fort, »Alles in Allem über 22,327 Rubel 15 Kopeken. Davon sind je 10,000 in Obligationen auf P… und K… angelegt, das Uebrige habe ich in Papieren und baarem Gelde. Du wirst die Obligationen leicht zu Geld machen können, denn sie sind das erste Geld und tragen sechs Procent. Wenn Du es wünschest, werde ich Dir bei dem Verkaufe behülflich sein.«
»Ich danke Dir, lieber Onkel, für alle die Güte, die Du mir immer erwiesen,« rief Heinz in überströmendem Gefühl und ergriff die Hand des Onkels.
Der Doctor stieß ihn rauh zurück.
»Ich denke, wir sprechen jetzt von Geschäften,« sagte er. »Wirst Du, bis Du etwas gefunden hast, bei den Baltevilles bleiben?«
»Ja, für's Erste.«
»Wird der junge Balteville auch Landwirth?«
»Ja, er wird vorläufig den großen Hof bewirthschaften. Markhausen behält die Oberaufsicht.«
»Bist Du mit der Tochter verlobt, Heinz?«
»Nein, Onkel. Ich werde es auch nie sein.«
»Nicht? Nun, das freut mich.«
Heinz erhob sich. »Lebe wohl, Onkel,« sagte er und seufzte unwillkürlich.
»Adieu, mein Junge. Wenn Du etwas gefunden hast und Dein Geld brauchst, so schreibe an mich und Du hast es in vierzehn Tagen. Brauchst Du nicht vielleicht augenblicklich Geld?«
»Nein, lieber Onkel; ich hatte ja eben meinen Wechsel erhalten, als ich Deutschland verließ.«
»Nun, es freut mich, daß Du dort keine Schulden gemacht hast.«
Der Doctor war äußerlich wieder ganz der ruhige, kühle Geschäftsmann. Dem Neffen, der jünger war, fiel die Selbstbeherrschung schwerer.
»Noch eins,« sagte der Onkel, indem er Heinz bis an die Thür begleitete, »mache doch bei Onkel Friedrich einen Besuch. Du bleibst dann doch wenigstens mit der Schwester Deines Vaters in Verbindung.«
Der Doctor sagte auch das im leichten Conversationstone, aber seine Mundwinkel zuckten.
Heinz drückte ihm die Hand und verließ das Haus.
Der Tag war einer jener warmen, nebeligen Herbsttage, wie sie dem Eintritte des Spätherbstes vorherzugehen pflegen. Es regnete nicht gerade, aber hin und wieder fielen einzelne Tropfen und von den Dächern tröpfelte es.
Heinz schritt langsam die Straße hinauf. Wie groß war ihm diese früher vorgekommen, jetzt erschien sie ihm als eine häßliche Gasse, an der sich schmutzige, verfallende Häuser erhoben und in der nicht weniger schmutzige Juden, in langen, schmutzigen Kaftans oder auch im deutschen Rocke, von Bude zu Bude eilten oder mit den Bauern um die Mützen, die sie in der Hand, oder um die alten Kleider, die sie auf dem Arme trugen, feilschten.
Hin und wieder begegneten ihm auch ein paar schlanke Edelfräulein, an Gesicht und Gestalt gleich als solche erkennbar, oder ein breitschulteriger Literat wand sich, die Actenmappe unter dem Arme, durch das Gedränge und wanderte zur Behörde, oder eine Hausfrau kehrte, die Köchin hinter sich, vom Markte heim. Das Ganze machte einen recht unerfreulichen Eindruck. Unsere eigentliche, unsere liebe, grüne, luftige Heimath, die muß man auf dem Lande suchen, in Wald und Wiese, in Busch und Brache.
Bei Frau Irene wiederholte sich die Scene vom Pastorate, nur mit dem Unterschiede, daß Heinz diesmal ruhig blieb, obgleich er hier noch viel mehr zu hören bekam, als dort. Er hielt sogar an sich, als die Tante die Unterredung mit den heftigen Worten abbrach:
»Kurz und gut, ich sage Dir, Du wirst nicht Landwirth. Ich werde es nun und nimmermehr dulden, daß ein Eichenstamm Arrendator wird und zwar nicht als Landwirth von Fach, das ginge noch allenfalls an, sondern als verpfuschter Student. Diese Pläne schlage Dir einfach aus dem Sinne – ich sage Dir, daraus wird nun und nimmer mehr etwas.«
Heinz schwieg. War doch die Sprecherin die einzige Schwester seines Vaters. Des Doctors Worte waren doch nicht auf ganz steinichtes Erdreich gefallen.
Zum Mittagessen kamen auch die beiden Söhne des Pastors, die bereits ausstudirt hatten und von denen der eine Oberlehrer am Gymnasium war, während der Andere sich als Hauslehrer (er war Theologe) bei einem Grafen aufhielt.
Natürlich fragten sie vor Allem, ob Heinz schon bei ihrem Vater gewesen sei. Als er erzählte, daß er sich mit dem Onkel überworfen habe, machten sie ihm darüber Vorstellungen und fragten nach der Ursache des Streites. Als sie bei dieser Gelegenheit von Heinzens Plänen hörten, widersprachen sie ihnen auf's Eifrigste und wurden natürlich von dem mittlerweile nach Hause zurückgekehrten Onkel Friedrich unterstützt. Was sie vorbrachten, lief natürlich immer wieder auf den »verpfuschten Studenten« hinaus, und wenn sie es auch nicht geradezu sagten, so blickte die Meinung, daß Heinzens Plan nur dadurch zu erklären sei, daß er nicht im Stande wäre, das Examen zu machen, immer mehr oder weniger deutlich durch. Das war ebenso natürlich wie ungerecht und machte eben deshalb Heinz nur noch störrischer. Hätte er Zeit gefunden, die Gründe, die von allen Seiten gegen seine Pläne in's Feld geführt wurden, ruhig und kaltblütig zu überlegen, er hätte vielleicht doch noch nachgegeben, so aber, da Alle auf ihn losschlugen, mußte sein Entschluß immer fester werden.
Nach dem Essen machten die Vettern Heinz den Vorschlag, mit ihnen eine Conditorei zu besuchen, in welcher sich die jungen Literaten der Stadt um diese Stunde zu versammeln pflegten. Man las dort die Zeitungen, plauderte und ließ jenem eigentümlichen Humor die Zügel schießen, der sich unter der gebildeten Jugend kleiner Städte auszubilden pflegt, der für den betreffenden Kreis recht ergötzlich ist, mit dem der Fremde aber, da es sich wesentlich um Neckereien persönlicher Art handelt, nichts anzufangen weiß.
Als Heinz in den Kreis trat, wurde er von allen Seiten sehr herzlich begrüßt; aber seine kalte und verschlossene Art übte bald auch hier eine zurückstoßende Wirkung aus.
Wie natürlich, kam das Gespräch bald auf die deutschen Hochschulen und ihr Verhältniß zur einheimischen Universität. Da die Freunde die ersteren entweder gar nicht oder doch nur aus einem sehr flüchtigen Besuche kannten, und da der Umstand, daß bei uns fast Alle, die überhaupt studirt haben, ihre Bildung auf derselben Universität empfangen, wenig geeignet war, den Gesichtskreis der jungen Leute nach dieser Richtung hin sonderlich zu erweitern, so traten bald eine Reihe jener wunderlichen Anschauungen in Bezug auf die deutschen Universitäten zu Tage, wie sie bei uns in den betreffenden Kreisen nicht selten sind. Heinz, der weder alt noch erfahren genug war, um sich sagen zu können, daß es sich hier um sehr natürliche und überaus tief eingewurzelte Vorurtheile handelte und daß sich solche durch Worte nicht zerstreuen lassen, nahm sich der deutschen Hochschulen eifrig an und ging auch seinerseits zum Angriffe über. Nun pflegt aber unsere Universität ihren ehemaligen Schülern so sehr an's Herz gewachsen zu sein, daß selbst alte und besonnene Männer in Leidenschaft zu gerathen pflegen, sobald sie ihre geliebte alma mater angegriffen glauben, und so war es nur natürlich, wenn die Unterhaltung in diesem Falle, wo Heinz auch die wirklichen Vorzüge derselben nicht gelten lassen wollte, einen sehr gereizten Charakter annahm.
»Unsere Studentenverhältnisse,« sagte Robert Steinheil, der auch unter den jungen Leuten war, »sind die besten von der Welt und sie könnten allen deutschen Universitäten zum Muster dienen. Bei uns bildet die Studentenschaft nicht einen von allen Seiten zusammengelaufenen Haufen von jungen Leuten, die nichts mit einander zu thun haben, als daß sie dieselben Hörsäle besuchen, sondern sie bildet einen geschlossenen Körper, ein organisches Ganzes. Ein Jeder, der die Universität bezieht, muß den »allgemeinen Comment« garantiren, d. h. er muß sich verpflichten, sich den bestehenden, frei aus der Studentenschaft hervorgegangenen Ordnungen und Organen zu fügen. Thut er das nicht, so schließt er sich eben damit selbst aus unserem Kreise aus und ist gesellschaftlich vogelfrei. Garantirt er dagegen den Comment, so steht es ihm auch wieder frei, sich entweder einfach auf sein Studium zu beschränken, in welchem Falle der Comment sich nur insoweit auf ihn bezieht, als er zu einem ehrenhaften Verhalten verpflichtet ist oder aber, sich einer der vier bestehenden Landsmannschaften anzuschließen. Zieht er das Letztere vor, so erwirbt er damit das Recht, sich an der Wahl des Chargirten-Convents, der höchsten studentischen Behörde, und an der Zusammensetzung des Ehrengerichts zu betheiligen und selbst Zutritt zu diesen Ehrenämtern zu haben. Der Chargirten-Convent seinerseits ist nicht, wie etwa Euer S. C., nur ein Ausschuß einer Anzahl freier Verbindungen, sondern das von der Obrigkeit anerkannte Organ der Studentenschaft als solcher, ein Körper, der mit den Universitätsbehörden auf fast gleichem Fuße verhandelt. Du wirst zugeben müssen, Heinz, daß diese ganze Organisation eine vortreffliche ist und außerdem eine ganz deutsche, denn es ist den Deutschen mehr als andern Völkern eigen, daß sich die Arbeitsgenossen zu festen Vereinigungen zusammenthun und den selbstgegebenen Gesetzen gern gehorchen.«
Das war nun ganz richtig und noch dazu verhältnißmäßig sehr gemäßigt gesprochen, denn der Sprecher war innerlich sehr erregt, aber Heinz war nicht in der Stimmung, das zuzugeben.
»Das ist eine Sclaverei,« rief er, »wie sie eben nur noch bei uns möglich ist, denn der deutsche Student würde sich einen solchen unerhörten Zwang nie gefallen lassen. Wie? Ich beziehe die Universität, um zu studiren, und da soll ich mich Gesetzen beugen, wohlverstanden, mich Gesetzen beugen müssen, die mit dem Studium absolut nichts zu thun haben? Man soll das Recht haben, mich in Verruf zu thun und somit zu beschimpfen, blos weil ich sage: ›Bleibt mir mit Eurem Chargirten-Convent vom Leibe! Ich habe mit ihm nichts zu schaffen und will von ihm nichts wissen.‹ Welch' einen Mangel an Selbstgefühl, an Freiheitsliebe setzt das voraus!«
»Sage ›Zuchtlosigkeit‹,« rief einer aus dem Kreise.
»Durchaus nicht! Das, was Ihr so preiset, ist einfach ein barbarischer Zustand, denn er hat völligen Indifferentismus in Bezug auf die höheren Lebensziele zur Voraussetzung. Sobald sich bei Euch wirkliche Parteien bilden werden, Parteien, die sich nicht nach der zufälligen Herkunft, sondern nach leitenden Ideen zusammenthun, so ist an ein solches Zusammenhalten nicht mehr zu denken.«
»Ach, geh' doch, Heinz,« rief Willi Schultz, »davon verstehst Du ja ganz und gar nichts.«
»Unter diesen Umständen läßt sich freilich nicht weiter streiten.«
»Nein. Davon verstehst Du nichts. Du bist ja auch gar nicht bei uns gewesen. Das, was Du da sagst, ist ja reines Blech.«
Heinz stand zornig auf. »Du wirst das zu verantworten haben!« rief er.
»Ja wohl. Davon verstehst Du ja nichts. Du sprichst reinen Unsinn!«
Die Vettern legten sich nun in's Mittel und suchten eine Aussöhnung zu Stande zu bringen, was denn auch nach einiger Zeit gelang; aber das Verhältniß Heinzens zu den alten Schulfreunden bekam von Stund' an einen Riß, und das umsomehr, als man so thöricht war, das Gespräch noch weiter fortzuführen.
Wenn auch Robert Steinheil sich darauf beschränkte, den Nachweis zu führen, daß die Freiheit des Einzelnen nicht mehr beschränkt werde, als es im Interesse der Gesammtheit dringend geboten sei und als Beweis für seine Behauptung die vernünftige Stellung anführte, welche unsere Studentenschaft zum Duelle einnimmt, so fehlte es doch von Seiten der übrigen Debattirenden keineswegs an spöttischen und nichtachtenden Seitenhieben auf die deutschen Hochschulen, und Heinz erregte seinerseits durch die Bemerkung, es ließe sich schon a priori nicht annehmen, daß sich die normalsten Verhältnisse gerade auf diesem halbvergessenen Vorposten deutscher Bildung finden sollten, eitel böses Blut. Man brachte zur Entgegnung darauf allerlei sehr gewagte Behauptungen vor, die ihm nun wieder wie lichter Unsinn erschienen, und so war man gegenseitig froh, als man sich trennte.
Als Heinz wieder im Wagen saß und Parkhof zufuhr, stürmte es heftig in ihm. Er hatte sich so fest vorgenommen, mit seinen Verwandten in Eintracht zu leben und – er hatte sich mit fast allen überworfen; er hatte durchaus mit den Schulkameraden treu zusammenhalten wollen und – er hatte diesen Verkehr von vornherein unmöglich gemacht.
»Ich bin nicht, wie ich sein sollte,« sagte er sich. »Ich war heute selbst daran schuld, daß unser Gespräch so verlief, denn ich ließ mich wieder von meiner Heftigkeit hinreißen. Sie hatten in Allem Unrecht und ich hatte Recht; aber ich hätte dem Rechnung tragen müssen, daß sie das Bessere eben nicht kennen. Ich will mich künftig mehr mäßigen, mehr beherrschen. Wenn ich erst in der Arbeit sein werde, so recht in der Arbeit, dann wird mir das auch leichter sein. Ich habe es nöthig, daß ich alle meine Kräfte zusammenfasse, denn meine Lage ist eine verzweifelte. Sie halten mich hier Alle für einen verpfuschten Studenten. Wohlan, ich will ihnen beweisen, daß sie sich irren. Meine Thaten, die Resultate meiner Thaten sollen ihnen die Achtung abzwingen, die sie mir verweigern wollen. Du hast Recht, alter Onkel, ich war nie glücklich und werde es nie sein, aber ein Eichenstamm wird nicht mißachtet. Nein. Ich will sie lehren, mich mißachten! Nein, Anna, Du irrtest, wenn Du meintest, daß es nun bergab mit mir gehe. Du zweifeltest an mir, darum warst Du nicht die Frau, die ich brauche. Steh' ich dann so allein, wie einst mein Vater, wohlan, ich will dafür sorgen, daß ich auch so geachtet dastehe wie er!«
Als Heinz in Parkhof auf sein Zimmer ging, fand er auf seinem Tische einen Brief vor. Er sah an dem Poststempel, daß er aus Fischersbach war, und er erkannte die Handschrift des Pfarrers. Mit heftigem Herzklopfen erbrach er das Schreiben, aber das Herz stand ihm still vor Schreck und Entsetzen, als er las:
Mein Herr!
Das Trauerspiel, das Sie in meinem Hause zur Aufführung brachten, ist zu Ende. Anna ist nicht mehr unter den Lebenden. Möge der allbarmherzige Gott Ihnen verzeihen und möge er bewirken, daß meine unglückliche Tochter das letzte Opfer bleibe, das Ihre Selbstsucht fordert. Das wünscht
Johannes Werde.
Heinz legte den Brief auf den Tisch und lehnte sich schwer zurück in den Stuhl. Es war ein Gefühl tödtlicher Angst, das ihn überkam, einer Angst, wie sie keine Gefahr ihm hätte einjagen können. Von wildem Entsetzen ergriffen, sprang er auf, als ob er flüchten müsse vor den Furien, die ihn verfolgten.
Ach, wohin will er fliehen! Trägt er sie doch mit sich, wohin auch immer sein flüchtiger Fuß ihn bringt, trägt er sie doch mit sich in der eigenen Brust!
Als die Parkhöfschen am folgenden Morgen erwachten, erfuhren sie, daß ihr Gast schon früh Morgens zur Stadt gefahren sei und daß er ein Briefchen an Horace zurückgelassen habe. Dieses war mit sehr deutlicher, fester Hand geschrieben und lautete wie folgt:
Ich muß auf einige Wochen in's Ausland. Mich hat schweres Leid getroffen. Sorge dafür, daß mich nach meiner Rückkehr Niemand nach meiner Reise fragt.