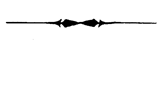|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der Frühling des folgenden Jahres kam früh und blieb lange. Er brachte wundervolle Tage mit sich. Die Städter erfreuten sich an ihnen und strömten bei dem herrlichen Wetter zu allen Thoren hinaus in die freie Natur, aber die Landleute schüttelten den Kopf und machten bedenkliche Gesichter. Sie hielten sich an den alten Spruch: »Mai kalt und naß, füllt Keller und Faß,« und es wollte ihnen gar nicht gefallen, daß ein Tag nach dem andern dahin ging und immer die Sonne vom wolkenlosen, tiefblauen Himmel herablachte. Ende Mai lag bereits Sorge auf allen Gesichtern: man wußte schon, daß eine neue Mißernte bevorstand, und daß es sich nur noch um den Umfang derselben handeln konnte. Das vorige Jahr hatte bereits alle Vorräthe aufgezehrt, was sollte daraus werden, wenn auch dieses statt der Erträge nur Verluste brachte?
Am Nachmittage eines herrlichen Julitages hielt Horacens Wagen vor Heinzens Thür. Sie hatten eine gemeinsame Geschäftsfahrt nach Riga verabredet und Horace war gekommen, um den Freund abzuholen. Die Equipage machte einen sehr eleganten Eindruck, der Wagen war eines jener hübschen, modernen Fuhrwerke, bei denen der Kutschersitz hinten angebracht ist, die Pferde waren vier prachtvolle Rappen, die Otto Schweinsberg erst vor wenigen Wochen im Auftrage des Freundes für denselben gekauft hatte. Es waren leicht gebaute, wilde Thiere, denen das reichlich mit Silber beschlagene englische Geschirr vortrefflich stand, und Weinthal beobachtete sie mit leuchtenden Augen, während er vor der Thür auf das Heraustreten der Herren wartete.
»Kann denn Euer Herr mit ihnen fertig werden?« fragte er endlich den Kutscher, der mit über die Brust gekreuzten Armen dasaß und zur Sonne emporblinzelte.
Der Angeredete verzog sein Gesicht zu einem breiten Grinsen.
»Wie sollte er wohl?« erwiderte er. »Seht Euch doch nur seine Händchen an.«
»Aber er kutschirt doch selbst?«
»Nun, es ist auch darnach. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir bei dieser Gelegenheit einmal den Hals brechen sollten. Solche Pferde sind gut für den Aarburgschen oder für Euren Herrn, wir können sie nicht brauchen.«
Weinthal schüttelte nachdenklich den Kopf. Er überzeugte sich indessen, daß die Enden der Leinen am Kutschersitze befestigt waren, der Kutscher daher im schlimmsten Falle immer noch eingreifen konnte, und beruhigte sich einigermaßen.
Schon als die Herren einstiegen, war es nicht leicht, die durch das lange Stehen nur noch unruhiger gewordenen Thiere zu bändigen, aber es gelang doch und man fuhr im Schritt ab. Heinz bemerkte zwar sehr bald, daß sein Freund diesen Pferden nicht gewachsen war, aber er scheute sich, Horace den Vorschlag zu machen, die Leinen seiner Hand zu übergeben, weil dieser auf sein Gespann sichtlich sehr stolz war und sich auf seine Geschicklichkeit im Kutschiren viel zu gute that.
Als man bei Aarburg das steile Ufer hinunter fuhr, hätte es beinahe ein Unglück gegeben, denn die Pferde hielten schlecht vom Berge und hätten die Fähre verfehlt, wenn der alte Jahne es nicht zur rechten Zeit bemerkt und sich ihnen in den Weg gestellt hätte. Während der Alte am Tau hinging, betrachtete er kopfschüttelnd den kutschenden Horace und das ganze Fuhrwerk. Horace, der, während die Thiere hinabdrängten, kreidebleich geworden und dem noch jetzt sehr ängstlich zu Muthe war, bemerkte das und verlor alles Selbstvertrauen, aber er war zu stolz, die Leinen dem neben ihm sitzenden Freunde anzuvertrauen. Er stieg jedoch auf der Fähre, unter dem Vorwande, sich eine Cigarre anzuzünden, aus, denn es war doch gar zu ängstlich, im Wagen, den die immer unruhiger werdenden Thiere von Zeit zu Zeit gegen den Schlagbaum stießen, zu bleiben. Auch der Kutscher stieg ab, nur Heinz blieb ruhig sitzen.
»Steige doch aus, Heinz,« bat Horace ängstlich. »Wenn der Schlagbaum bricht, bist Du verloren.«
Heinz lächelte. »Er wird nicht brechen,« sagte er.
»Wie kannst Du das wissen,« rief Horace eifrig. »Er kann in jedem Augenblicke brechen, und dann stürzest Du rücklings in den Fluß.«
Jetzt lächelte auch der alte Jahne. »Gnädiger Herr,« sagte er, »wenn wir hier nicht starke Schlagbäume hätten, so wäre unser eigener Baron längst ertrunken.«
Das beruhigte Horace und er stieg wieder ein, aber er war unsicher geworden und hielt deshalb, als sie das andere Ufer hinauffuhren, um ihren Weg fortzusetzen, aus Furcht die Pferde so scharf im Zügel, daß sie mit jedem Augenblicke wilder wurden. Der Wagen blieb eine Zeit lang auf der großen Heerstraße, die auf dem rechten Ufer stromabwärts lief, und bog dann rechts auf eine kleinere Landstraße ab. Diese führte durch die weiten Wälder, welche nach Norden die Semgaller Ebene abschließen, um an der livländischen Grenze häßlichen Morästen Platz zu machen, die sich zwischen den beiden baltischen Schwesterstädten hinziehen und den Fremden einen so unvortheilhaften Begriff vom Gottesländchen beibringen. Der Weg, auf dem die Freunde dahinfuhren, war sehr sandig und die Thiere mußten daher im Schritt gehen. Dann hörten die Freunde den Buntspecht seiner geräuschvollen Jagd nachgehen, während der Häher sein mißtöniges Geschrei erhob und die zierlichen Eichkätzchen von Baum zu Baum huschten.
Tiefer sank die Sonne und die leichten Wölkchen im Zenith kleideten sich in zartes Rosa. Die Freunde passirten ein paar Mal kleine Flüßchen, die mit blumenreichen Wiesen an den Ufern die Föhreneinsamkeit unterbrachen. Auf den Wiesen standen da und dort kleine Gruppen von Birkenbäumen, während dort, wo der Hochwald an die Wiese stieß, ein Rudel Rehe von der Aesung aufsah und, den schlanken Leib weit vorgestreckt, nach dem Wagen hinüberlugte.
Jetzt mußte die Sonne hinter dem Horizonte verschwunden sein, denn gluthroth, wie von einer ungeheuren Feuersbrunst, färbte sich der Himmel, wie Feuerflammen lief das rothe Licht an den schlanken Säulen der riesigen Föhren hinauf, die dort an der Waldecke sich so scharf abzeichneten, noch einmal ward der Wald tageshell. Dann sanken tiefe Schatten auf ihn herab und verhüllten ihn mehr und mehr.
Die Freunde waren zuletzt schweigend dahingefahren. Heinz hatte den Sonnenuntergang in stiller Waldeinsamkeit in seiner ganzen Schönheit auf sich wirken lassen. »Wie schön!« sagte er und blickte zu den nun in zartem Lila erglühenden Lämmerwölkchen auf. Horace achtete nur auf die Pferde und er hatte allen Grund dazu, denn sie witterten ängstlich, spitzten die Ohren und warfen sich im Geschirre hin und her.
»Sieh doch, Heinz, was ist nur den Thieren,« sagte er, aber in demselben Augenblicke gingen die Pferde auch bereits durch. Heinz griff mit aller Kraft in die Zügel und es wäre ihm wohl auch gelungen, die Thiere aufzuhalten, wenn Horace ihm nicht, laut um Hilfe rufend, in die Zügel gefallen wäre und ihm so jede Leitung der Pferde unmöglich gemacht hätte. Der Kutscher erkannte, wie nachtheilig Horacens Einmischung sein mußte, und ergriff von hinten dessen Arme, trug aber so nur dazu bei, die Katastrophe zu beschleunigen. Nach einigen unsäglich ängstlichen Augenblicken schwenkten Rosse und Wagen vom Wege ab und letzterer zerschellte an einem Baume, während die ersteren in einem wirren Knäuel übereinanderkugelten.
Heinz, der beim Anprallen des Wagens in weitem Bogen herausgeschleudert worden war, stand zuerst wieder auf den Beinen, denn sein gutes Glück hatte es gewollt, daß er in eine Tannenschonung gefallen war, die, nachgebend, den Sturz gemildert hatte. Er sprang auf und sah nach den Andern. Der Kutscher lag mit zerschmettertem Haupte an einer Föhre, Horace lag regungslos da, aber als Heinz ihn aufrichtete, sah er, daß er noch lebte, obgleich auch ihm das Blut aus einer tiefen Wunde über das bleiche Gesicht herabströmte und er so regungslos dalag, wie der Todte neben ihm. Es war eine verzweifelte Situation: der schwer verletzte, vielleicht sterbende Freund, die sich wild durch einander zerrenden Pferde, die von Zeit zu Zeit einen Mark und Bein durchdringenden Schrei ausstießen und rings umher die tiefe Einsamkeit des Waldes. Heinz war diesen Weg noch nie gefahren, er wußte daher nicht, ob irgend ein Krug oder ein Gesinde in der Nähe war. Er durfte es kaum hoffen, denn er befand sich in einer Waldregion und auf einer im Sommer wenig befahrenen Straße. Zugleich wurde es in jedem Augenblicke dunkler. Heinz wand sein Taschentuch um des Freundes Kopf und band es so fest, als er irgend konnte; dann lehnte er ihn an einen Baum und näherte sich den Pferden, von denen das eine mittlerweile in der Koppel erstickt war, während die andern mit weit vorgestreckten Hälsen dalagen. Es dauerte eine Weile, bis es Heinz gelang, mit seinem Taschenmesser das ineinandergeschlungene Riemenzeug zu durchschneiden und das eine Pferd frei zu machen. Dann schwang er sich hinauf und jagte vorwärts. Er ritt eine gute Strecke, wie es ihm in der Aufregung schien, Meilen weit, obgleich es nur einige Werst waren, ohne daß er auf eine menschliche Behausung traf, und schon dachte er daran, umzukehren, um zum Freunde zurück zu eilen, als er in einiger Entfernung vor sich eine menschliche Gestalt erblickte, die über den Graben am Wege sprang. Er warf mit Mühe das Pferd herum, hielt und suchte mit den Augen die Dunkelheit zu durchdringen. »Kommt und helft,« rief er in lettischer Sprache, »mein Freund liegt im Sterben.«
»Wo?« fragte eine Frauenstimme. »Aber einerlei, eilt in's Pastorat.«
Die Stimme klang Heinz bekannt, aber es war nicht der Augenblick, darnach zu forschen, wer zu ihm sprach.
»Ich bin hier fremd,« sagte er, »wo liegt das Pastorat? Am Wege?«
»Nein, gleich hinter dem ersten Werstpfosten kehrt rechts ein. Dann seid Ihr in einem Augenblicke da. Wo ist der Kranke?«
»Weit zurück, Ihr könnt ihm nicht helfen.«
Heinz schlug dem Pferde die Absätze der Stiefeln in die Weichen und jagte vorwärts, daß die Funken hinter ihm herstoben. Hinter dem nächsten Werstpfosten, hatte die Frau gesagt, ja, aber wo war der? Vergeblich blickte er nach der dunkeln Wand des Waldes, der Pfosten ließ sich nicht erkennen. Doch da – endlich – da bog ein Weg rechts ab und Heinz jagte auf ihm fort, bis er auf eine Lichtung kam. Er sah einzelne dunkele Gebäude, eine Baumgruppe, endlich die Veranda des Wohnhauses.
»Was giebt's?« fragte eine Männerstimme und ein Mann trat aus dem Schatten der Veranda, während ein großer Hund in wilden Sprüngen neben Heinz herlief und laut bellte.
»Verzeihen Sie, mein Herr, wenn ich Sie vielleicht erschrecke,« rief Heinz, »allein die Pferde gingen uns durch, der Kutscher ist erschlagen und mein Freund, wie ich fürchte, schwer verletzt. Helfen Sie uns um Gotteswillen!«
Auf der Veranda entstand eine lebhafte Bewegung und noch ein paar Herren traten rasch aus ihr hervor.
»Wo liegt der Kranke?« fragte eine Stimme, die Heinz wieder so merkwürdig bekannt vorkam.
»Ich weiß es nicht,« rief Heinz, »ich habe die Werste nicht gezählt, aber es muß ein gut Stück rückwärts sein, in der Richtung nach Aarburg hin. Wenn Ihr könnt, kommt uns zu Hilfe.«
Damit wandte er das Pferd und sprengte zurück. Unterwegs beugte er sich vor und blickte aufmerksam nach der Frau von vorhin, aber er sah sie nirgend. Endlich war er wieder bei Horace, der noch immer bewußtlos dalag. Ihm war vorläufig nicht zu helfen und so begab sich Heinz zunächst zu den Pferden, befreite sie aus ihrer unnatürlichen Lage und band die lebenden an einen Baum. Dann setzte er sich neben Horace und lauschte ungeduldig, ob nicht bald ein Wagen aus dem Pastorate heranrasseln würde.
»Seltsam,« dachte er, »daß mir die Stimme dort so bekannt vorkam.« Plötzlich sprang er auf. »Natürlich, wie sollte es anders sein. Das Pastorat mußte ja Waldhof sein, in welchem Onkel Josephs Bruder Pastor war!« Heinz hatte mit dem Großvater gesprochen und am Ende gar mit Lelia. Mit Lelia! Das liebliche Gesichtchen der einstigen Jugendgeliebten stieg in seiner ganzen, reizvollen Frische vor ihm auf und mit ihm all die Qualen, die er um ihretwillen einst erduldet. Heinz mußte, trotz der Aufregung, in der er sich befand, lächeln. Welch ein seltsames Zusammentreffen! Er hatte wohl einmal daran gedacht, die ihm einst so lieben Menschen aufzusuchen, aber er hatte es doch nicht gethan. Was sollte er bei ihnen? Hätten sie noch ihr eigenes Haus gehabt, so aber – sie aufsuchen unter fremden Menschen, nein, wozu? »Nun,« dachte er, »Gottlob übrigens, daß es so gekommen ist, Horace wird in guten Händen sein.«
Er beugte sich über den Bewußtlosen und wischte ihm das Blut aus dem Gesichte, dann blickte er zu der Leiche hinüber und seufzte. »Du Glücklicher,« dachte er, »Du hast ausgelitten! In einem Augenblicke erlosch Dein Leben, wie ein Funke, auf den man den Fuß setzt, und für Dich giebt es kein Leid mehr. Ach, warum konnte nicht ich an Deiner Stelle sein! Du lebtest gewiß gern, Du mußtest sterben – während ich – ich lebe!«
Er stand auf und erhob die Hand des Todten. Als er sie fahren ließ, fiel sie schwer nieder. Der Glückliche! Für ihn gab es kein Gewissen mehr, das ihn quälte, keine Sehnsucht nach Liebe und Glück, still stand das vielleicht auch oft in Kleinmuth bewegte Herz. Für ihn gab es keine Vergangenheit mehr, ihm schritt nicht mehr die freudlose Zukunft zögernd entgegen. Ach, der Mann aus dem Volke war vielleicht glücklich gewesen in seines Sinnes Beschränktheit, war sich nie bewußt geworden des elenden Looses der Menschheit, hatte vielleicht nie der Schuld in's schreckliche Antlitz gesehen. Das war es. Darum lag er jetzt hier so still und ruhig auf dem duftenden Waldboden, unter den grünen Bäumen, in den weichen Armen der Sommernacht, während Heinz neben ihm stand, die Brust voll Kummer und Sehnsucht nach dem Frieden des Todes. Leben – das war die Sühne! Ein verfehltes Leben fortleben, das war die Sühne für die Schuld der Jugend!
Sie kamen noch immer nicht. Heinz beugte sich vor und lauschte gespannt, aber kein Laut ließ sich hören, als hin und wieder die nächtlichen Stimmen des Waldes.
»Er wird auch sterben, ehe sie herbeikommen,« murmelte Heinz. »Vielleicht ist es gut so! Wer weiß, was für schweren Leiden ihn das Schicksal sonst noch entgegengeführt hätte.«
Da, endlich, dort klingt es wie Wagengerassel. Heinz horcht gespannt. Nein, doch nicht, er muß sich geirrt haben. Oder doch? Ja, das ist das Rollen eines rasch daherfahrenden Wagens. Sie sind es. Schon schimmern Kienfackeln durch das Waldesdickicht, bald hält der Wagen.
Heinz hatte sich nicht geirrt. Das junge Mädchen, das mit den Herren kam, war wirklich Lelia, wie er im ersten Augenblick erkannte. Auch sie erkannte ihn beim Lichte der Fackeln, so verändert er auch war und so verwildert und blutig er auch jetzt aussah.
»Heinz!« rief sie und blieb stehen, »Du bist es?«
»Ja, Lelia,« sagte er und drückte ihr herzlich die Hand, »ich bin es und der dort ist mein armer Freund Balteville.«
Lelia und die Herren eilten nun zu Horace. Man wusch ihm mit mitgebrachtem Spiritus die Schläfen und es gelang, ihn einigermaßen zu sich zu bringen, obgleich er irre redete. Lelia reinigte vorläufig die Wunde und legte mit Hilfe der Herren einen Verband an, dann wurde er in den Wagen gehoben und während der Pastor mit seinen Gefährten bei dem Todten und den Pferden blieben, setzte sich Lelia mit in den Wagen und nahm den Kopf des Kranken in ihren Schooß. Heinz schwang sich auf den Bock und lenkte die Pferde langsam dem Pastorate zu.
»Du wirst Dir Dein Kleid ganz verderben,« sagte Heinz, als sie eine Strecke weit gefahren waren, und wandte sich um. Es war eine einfältige Bemerkung, aber sie kam ihm gerade in den Sinn.
»Was liegt daran,« erwiderte Lelia. »Bist Du nicht auch verletzt, Heinz?«
»Nein, oder jedenfalls nur unbedeutend.«
Sie schwiegen wieder eine Weile.
»Redete ich Dich vorhin an?«
»Ja.«
Nach einer Pause fragte Lelia:
»Warum bist Du nicht zu uns gekommen, Heinz?«
»Das läßt sich so in der Kürze nicht sagen. Jetzt, da uns das Schicksal zusammengeführt hat, sage ich es Dir wohl noch einmal. Hast Du mich denn erwartet?«
»Gewiß, Heinz. Großvater und ich haben immer gehofft, Du würdest die alten Freunde nicht ganz vergessen.«
»Ich verkehre mit Niemandem, Lelia.«
»Das hat man uns gesagt. Du bist Landwirth geworden, Heinz.«
»Ja.«
»Bist Du durch Deine Thätigkeit befriedigt?«
Ehe Heinz antworten konnte, rief ihm Lelia zu, einen Augenblick anzuhalten. Sie brachte mit Heinzens Hilfe den Kranken, der schwer stöhnte, in eine andere Lage, dann fuhren sie weiter.
»Die Wunde ist nicht gefährlich,« erklärte Lelia, »Dein Freund wird in ein paar Wochen hergestellt sein. Da wir hier in der Gegend keinen Doctor haben, so bin ich der Arzt und habe schon manche Wunde heilen sehen.«
»Du glaubst nicht, wie froh mich Deine Worte machen, Lelia.«
»Nur der Blutverlust ist groß, Du hattest ihn außerordentlich ungeschickt verbunden, Heinz.«
Heinz lächelte.
»Ja, ja,« versetzte er, »ich verstehe von solchen Dingen Nichts.«
»Hast Du Deinen Freund sehr lieb, Heinz?«
Heinz erzählte nun von Horace und gab seinen Gefühlen einen sehr warmen Ausdruck.
»Das ist hübsch,« sagte Lelia nachdenklich, ohne näher zu bezeichnen, was sie hübsch fand.
Der Wagen hielt endlich vor der Thür des Pastorats; Horace wurde herausgehoben und zu Bett gebracht. Später kam auch Lelia herein. Sie hatte ihr weißes, mit Blut beflecktes Kleid mit einem grauen Kleidchen vertauscht und eine lange Schürze vorgebunden. Sie brachte einen Schwamm, Pflaster und ein Stück alte Leinwand mit und gab die letztere Heinz, damit er sie zu Charpie zerzupfe. Während sie ihn darin unterwies, betrachtete Heinz sie mit Wohlgefallen. Sie war ganz so anmuthig und liebreizend, wie als Kind. Sie hatte auch jetzt noch in ihrem ganzen Wesen etwas Kindliches.
Als die Charpie fertig war, mußte Heinz den Kopf des Kranken halten, während Lelia den Verband entfernte, die Wunde mit einer Pincette von den eingedrungenen Haaren reinigte und sie dann mit dem Schwamme sorgfältig auswusch.
»Siehst Du,« sagte sie, indem sie die Wunde ein wenig auseinander bog, »der Knochen ist ganz unverletzt.«
Heinz blickte sie verwundert an. »Sind Dir Wunden etwas so Vertrautes?« fragte er erstaunt. »Du gehst mit ihnen so gleichmüthig um, wie ein Arzt.«
Lelia legte erst den Verband an und befestigte ihn gehörig, dann sagte sie, indem sie den Schwamm in der Schüssel, welche ihr ein Dienstmädchen hinhielt, ausdrückte, leise: »Ich bin es gewohnt, Heinz. Die Leute beschädigen sich hier oft beim Holzfällen und dann kann sich Niemand entschließen, die Wunden zu waschen. Anfangs war es auch mir schrecklich, aber ich sagte mir, daß es gehen müsse und da ging es. Jetzt bin ich daran gewöhnt.«
Der Kranke lag bewegungslos da und athmete schwer.
»Höre Heinz,« sagte Lelia, »vielleicht ist Dein Freund auch noch an einer andern Stelle verwundet. Das Blut, welches das Laken färbt, kann unmöglich aus der Kopfwunde kommen. Ich werde mich umwenden, untersuche Du ihn und falls Du eine Wunde findest, werde ich Dir sagen, was Du zu thun hast.«
Sie schickte das Mädchen hinaus, wandte dem Kranken den Rücken zu, reichte Heinz rückwärts das Licht und wartete ruhig.
Heinz schlug die Decke zurück und wandte den Kranken um. Lelia hatte richtig vermuthet, an der Seite klaffte eine noch größere Wunde. Heinz theilte ihr seine Entdeckung mit und beschrieb ihr die Wunde so gut er konnte.
»Untersuche ihn genau,« sagte sie, »ob er nicht sonst noch verwundet ist.«
»Nein, Lelia, sonst kann ich keine Wunde entdecken,« sagte er nach einer Weile.
»Dann gehe jetzt hinaus und schicke mir die Magd wieder herein,« sagte sie, ohne sich umzuwenden. »Du wirst mit der Wunde nicht fertig werden.«
Heinz ging und schickte das Mädchen hinein. Er ging hinaus auf den Hof, wo eben der Pastor mit der Leiche anlangte und die Menschen unruhig hin- und herliefen.
»Was macht der Patient?« fragte der Pastor und drückte Heinzens Hand mit beiden Händen.
Heinz sagte, daß Lelia ihn verbinde und stellte sich vor.
»Also gewissermaßen ein Verwandter!« rief der Pastor. »Wie wird mein Vater sich freuen, Sie zu sehen. Er hat oft von Ihnen gesprochen, Eichenstamm, und immer mit großer Liebe.«
Endlich kam auch der Großvater. Er küßte Heinz mit alter Herzlichkeit.
»Du bist nur durch einen Zufall in unser Haus gekommen,« sagte er, »und vielleicht gegen Deinen Willen, aber ich freue mich doch, Dich zu sehen.«
»Großvater,« sagte Heinz, wie in alten Tagen, »zürne mir nicht. Ich bin ein schlechter Gesellschafter geworden; da ist es besser, daß ich den Menschen fern bleibe.«
Man ging nun in's Haus, Lichter wurden gebracht und der Großvater führte Heinz in sein Zimmer, damit er sich von Blut und Staub säubern könne. Man brachte Heinzens Koffer und der Großvater sah ihm zu, wie er sich umkleidete.
»Du gleichst Deiner Mutter wenig,« sagte er, »Du bist ganz der Vater, obgleich die Beiden einander sich ja auch ähnlich sahen.«
Heinz seufzte. »Ja,« erwiderte er, »ich mag dem Vater wohl ähnlich sehen. Wandle ich doch auch seine Pfade.«
Der Großvater erhob sich von dem Stuhle, auf welchem er bisher gesessen hatte, faßte Heinzens Arm und sah ihn mit seinen klaren, blauen Augen traurig an. »Warum das, Heinz? Warum das?«
»Ach, Großvater,« erwiderte Heinz, »warum in Wunden wühlen, die sich doch nicht heilen lassen.«
»Mein lieber Heinz,« sagte der Großvater, »ich habe mehr von Dir gehört, als Du wohl glaubst und ich habe viel Sorge um Dich getragen. Du ziehst wie ein Adler Deine Kreise, einsam und stolz, aber auch verlassen und unglücklich.«
»Nicht wie ein Adler, Großvater, nicht wie ein Adler, oder wenn Du bei Deinem Bilde bleiben willst, so bin ich wenigstens nur ein Adler, dem die Kugel die Schwingen zerschoß und der nun auf dem Wipfel der einsamen Eiche sitzt, den Kopf unter die Flügel geborgen, des Augenblicks harrend, da er todt hinabstürzen wird.«
Der Alte sah Heinz prüfend in's Gesicht.
»Du bist ein besonderer Geist,« begann er wieder, »und Du willst mit anderem Maße gemessen sein als wir Andern.«
»Nicht doch, Großvater,« fiel ihm Heinz in's Wort, »Du täuschest Dich, wie ich mich früher täuschte. Ich bin kein besonderer Geist, der einen anderen Maßstab verlangt als die Anderen, ich bin ein armer, sündiger Mensch wie die Anderen auch und wenn ich mich von ihnen unterscheide, so ist es vielleicht, weil ich thörichter, verblendeter und sündhafter bin, als sie. Großvater, als Ihr mich kanntet, da war mir die Welt noch groß und herrlich und der Wunder voll. Ich glaubte nur die Hand ausstrecken zu dürfen, nach all' ihren Schätzen, – jetzt, da Du mich wiedersiehst, erscheint sie mir wie sie ist, wie ein elendes Jammerthal und ich selbst bin nicht werth, die wenigen Blümlein zu pflücken, die an seinem Rande blühen.«
Der Großvater erschrak. »Heinz,« rief er, »wie Du jetzt, spricht man als Jüngling nur, wenn man schwere Schuld auf sich geladen hat.«
»Das habe ich, Großvater, schwere Schuld, aber ich büße sie, – denn ich lebe.«
Heinz wußte selbst nicht, warum er so offen sprach, aber es war, als ob die Gegenwart des Alten ihm das Herz aufgeschlossen hätte und er ihm zeigen müßte, wie es darinnen aussah.
»Warte einen Augenblick,« sagte der Großvater und ging hinaus. Nach einiger Zeit kehrte er zurück und setzte sich wieder. »Ich habe ihnen mitgetheilt, daß Du oben bleiben wirst,« sagte er und legte seine Hand auf Heinzens Schulter.
Heinz nickte ihm dankbar zu.
Unten saßen der Pastor und Lelia an Horacens Bett und wachten bei dem Kranken, der jetzt ruhig schlief.
»Dein Vetter sieht entsetzlich hochmüthig aus,« sagte der Pastor. »Kalt und hochmüthig.«
»Ich fürchte, daß er das auch ist,« sagte sie und sah vor sich nieder.
Dann schickte der Pastor die Nichte zu Bett und übernahm es, die Eisumschläge zu machen, die Lelia für nöthig hielt. Er legte sich selbst in dem Zimmer, neben Horace, auf's Sopha.
Lelia ihrerseits begab sich in ihr Gemach, in welchem auch ihre kleinen Pflegebefohlenen, die Kinder des Pastors, bei denen sie Mutterstelle vertrat, schliefen, küßte eines nach dem andern, sprach ihr Gebet und legte sich dann auch nieder.
Bald wachten außer dem Pastor nur noch die Beiden dort oben. Heinz erzählte mit leiser Stimme dem Großvater die Geschichte seiner Verirrungen.