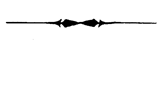|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der folgende Tag, einer der letzten des Monats, war ein so schöner Septembertag, wie sie bei uns nicht eben häufig sind. Es war schon recht kalt, aber die Luft doch angenehm und prächtig frisch, und Heinz, der neben Madeleine und ihrem Bruder durch den weitläufigen Park ging, sog mit jedem Athemzuge jenes kräftige Behagen ein, mit dem ein solches Wetter uns erfüllt. Es waren schon ein paar tüchtige Nachtfröste vorgekommen, so daß das Laub welk an den Aesten hing und der Fuß der Spaziergänger die herabgefallenen Blätter raschelnd niederdrückte, aber der Park machte bei dem hellen Sonnenscheine trotzdem keinen melancholischen Eindruck.
»Nun, Fräulein Madeleine,« wandte sich Heinz zu dem jungen Mädchen, »ist es nicht doch ganz erträglich auf dem Lande?«
»Abscheulich finde ich es,« war die Antwort, »wahrhaft affreux. Schämen Sie sich, Herr Eichenstamm, meiner in diesem Elende noch zu spotten.«
»Du wirst Dich einleben, Madeleine, Du wirst Dich einleben,« tröstete der Bruder, aber er goß nur Oel in's Feuer.
»Nie,« rief Madeleine, »niemals. Ich bin wohl auf dem Lande, aber nicht für's Land geboren. Du auch nicht, Horace. Du auch nicht. Sie finden so etwas hübsch, Herr Eichenstamm, Sie können sich für diese Wildniß begeistern? Was finden Sie da eigentlich hübsch? Können Sie mir das sagen? Sie werden antworten: ›Nun, die Bäume.‹ Ich erwidere darauf, daß Sie in jeder Bildergallerie viel hübschere Bäume finden, als diese unschönen hier, und daß Sie dieselben dort betrachten können, so lange Sie wollen, ohne sich einer Erkältung auszusetzen. Ich will Ihnen ganz offenherzig sagen, mein Herr, daß ich an Ihre Naturschwärmerei nicht recht glaube. Es klingt gewiß paradox, aber es ist trotzdem zweifellos richtig, daß es Unnatur ist, wenn ein Kulturmensch des neunzehnten Jahrhunderts für die Natur schwärmt.«
»Nun, mein Fräulein, wenn Sie sich für den Baumschlag auf einem Gemälde begeistern können, dann müssen Sie doch auch am Originale Geschmack finden.«
»Durchaus nicht. Ich sehe die Nothwendigkeit davon nicht ein. Nehmen Sie zum Beispiel ein beliebiges Gebäude, etwa das Louvre, und sagen Sie mir, ob es sich in der Wirklichkeit so stattlich repräsentirt wie auf einem Gemälde. Achten Sie einmal darauf, Sie werden sehen, daß ich Recht habe. So ein Baum in der Natur ist einfach ein Ding, welches uns im Sommer Schatten spendet und im Winter Holz für den Kamin, während ein von einem guten Künstler dargestellter Baum ein süperber Anblick ist, sich magnifique präsentirt.«
Die Männer widersprachen, aber Madeleine blieb bei ihrer Meinung.
»Es ist hier Alles so überaus ennuyant,« sagte sie. »Wenn wir wenigstens noch Berg und Thal hätten, so wäre es allenfalls erträglich, aber wir leben hier wie in der Steppe. Und nun erst die Menschen! Wenn ich an die Nachbarn denke, so bin ich in Verzweiflung.«
»Aber, Madeleine,« rief der Bruder, »wie kann man so hart und voreilig urtheilen. Du denkst immer noch an die Zeit, da Du noch nicht ganz erwachsen warst und daher natürlich auch noch nicht an der Gesellschaft theilnehmen konntest. Du wirst hier sehr angenehme Bekanntschaften machen und Du wirst Dein Vorurtheil bei Seite legen. Nicht wahr, Heinz, meine Schwester wird ihr Vorurtheil bei Seite legen?«
»Ich hoffe es,« erwiderte Heinz und sah vor sich nieder.
»Du bist mir unbegreiflich, Horace,« rief Madeleine, indem sie einen schnellen Blick auf Heinz warf, »völlig unbegreiflich. Mit wem spielst Du eigentlich Komödie, mit mir oder mit Deinem Freunde? Du weißt doch sehr wohl, daß ich mich hier ebensowenig einleben werde als Du. Du kennst doch sehr wohl das unsinnige Vorurtheil, das man hier, in Folge einer frechen Verleumdung, gegen unseren alten Adel hat und Du weißt eben so gut, daß unsere theure Mama, bei allen ihren vortrefflichen Eigenschaften, doch nicht gerade dazu geeignet ist, den hiesigen Baronen zu imponiren. Wir werden diesen Menschen hier nie für voll gelten und, bei Gott, uns irgendwo einzudrängen, dazu sind wir Balteville's nicht die Leute. Mißverstehen Sie mich nicht, Herr Eichenstamm, ich will damit natürlich nicht auf unsere Ahnen hindeuten, ich meine damit nur, daß mein Bruder und ich nicht die Leute dazu sind.«
»Warum sagen Sie dann nicht: ›mein Bruder und ich,‹ statt zu sagen: ›wir Baltevilles.‹
»Wohlan, mein Herr, ich will die Baltevilles ohne Weiteres fallen lassen, ich will annehmen, ich hieße ›Knochenhauer,‹ wie unsere theure Mama vor ihrer Verheirathung, und mein Großvater, der ein kleiner Kaufmann war, wäre mein Vater gewesen – trotzdem wären wir Beide, Horace und ich, hier nie im Stande, uns in einer Gesellschaft wohlzufühlen, in welcher man uns nur duldet.«
»Aber wer sagt Dir denn,« rief Horace, »daß man uns hier nur ›dulden‹ wird? Das ist ja eben das Vorurtheil, das wir in Dir bekämpfen. Warte nur einige Tage und Du wirst Dich davon überzeugen, daß kein Mensch ernstlich an das alberne Märchen von unserer lettischen Herkunft glaubt und daß man uns sehr freundlich empfangen wird. Was unsere gute Mama anbetrifft, so ist man hier viel zu höflich, um ihre kleinen Wunderlichkeiten nicht mit derjenigen Geduld und Nachsicht hinzunehmen, welche sie, um der vielen lobenswerthen Eigenschaften willen, welche mit ihnen gepaart sind, verdient.«
Madeleine schüttelte energisch den Kopf.
»Du täuschest Dich selbst, Horace,« rief sie, »wenn Du Dir unsere Stellung hier als eine so angenehme denkst. Wir werden hier immer als aufdringliche Abenteurer und Mama als eine aufgeblasene Thörin angesehen werden. Daß man gegen Diejenigen, welche Gleichheit prätendiren, schroffer ist als gegen die ganz Fernstehenden, liegt im Wesen einer jeden Aristokratie, und eben weil ich das einsehe, bin ich in Verzweiflung darüber, daß wir hierher zurückgekehrt sind. Wir lebten in Deutschland, in Paris, in Italien überall unbestritten in der besten Gesellschaft, wir fühlten uns in jeder Beziehung wohl und glücklich, und nun verlangt Mama plötzlich, wir sollen das Alles aufgeben, um in diesem verhaßten Lande zu leben. Das ist entsetzlich, Herr Eichenstamm, gerade entsetzlich. Wir, die wir an jedem anderen Orte der Welt eine, unserer Herkunft, unseren Geldmitteln und unseren Charaktereigenschaften entsprechende geachtete Stellung einnehmen könnten, kommen hierher, wo wir von vornherein lächerlich sind.«
»Aber, liebe Madeleine, Du weißt, daß Mama dieses Land liebt und daß wir daher als gute Kinder unsern Willen einfach dem ihrigen unterzuordnen haben.«
»O,« rief Madeleine mit blitzenden Augen, »so bist Du, Horace, so warst Du immer; Du beugst Dich nicht nur vor jeder Autorität, sondern Du redest Dir auch noch ein, daß sie nur das Vernünftige wolle. Verstehst Du wirklich nicht, wo Mama hinaus will? Warum wir hierher gekommen sind? Nun, ich will es Dir sagen. Unsere theure Mama hat noch von ihrer frühen Jugend her, da sie in Großpapa's Hause in sehr untergeordneten Verhältnissen lebte, einen ganz unglaublichen Respect vor den hiesigen Baronen, die ihr auch noch jetzt als die vornehmsten Menschen auf der Welt gelten, darum ist es ihr Lieblingswunsch, daß ich einmal einen Baron, Du eine Baronesse heirathest.«
»Aber, Madeleine,« rief Horace unwillig, »was redest Du?«
»Die reine Wahrheit, Horace, die reine nackte Wahrheit, die Du freilich nie hören willst. Deshalb mußten wir, trotz all' unserer Bitten, hierher, damit ich einmal die Frau irgend eines hochmüthigen Barons werde, der mich heirathet, um seine zerrütteten Geldverhältnisse in Ordnung zu bringen. Wir sollen hier verkauft werden wie Waaren, nur damit Mama das Vergnügen hat, einen hiesigen Baron ihren Schwiegersohn zu nennen.«
Das junge Mädchen war ganz außer sich. Ihr Gesicht flammte, die Thränen liefen ihr in Strömen über die Wangen, die kleinen Hände ballten sich krampfhaft.
»Aber, liebste Madeleine,« rief Horace erschreckt, »wie kann man sich so gehen lassen? Du siehst Gespenster.«
»Nun wohlan,« schluchzte Madeleine, indem sie sich mit dem Taschentuche die Thränen von den Augen wischte, »nun wohlan, Herr Eichenstamm ist Dein Freund und ein Mann von Ehre. Als solchen frage ich ihn jetzt gerade heraus: Glauben Sie, daß es unter den Edelleuten der Nachbarschaft einen Menschen giebt, einen einzigen, der uns wirklich für Baltevilles du Lys hält, für rechte, echte Baltevilles? Antworten Sie mir, Herr Eichenstamm!«
Heinz war in tödtlicher Verlegenheit. Er hatte tiefes Mitleid mit dem schönen, bis in's Innerste aufgeregten und verletzten Mädchen; aber er mochte nicht lügen.
»Nein,« antwortete er.
»Da hörst Du es,« rief Madeleine leidenschaftlich, »da hörst Du es. Du siehst, es ist wie ich sage; aber, bei der heiligen Jungfrau, Mama hat diesmal die Rechnung ohne den Wirth gemacht! Und wenn der heilige Erzengel Michael selbst sich mir nahete in der Gestalt eines hiesigen Barons, und wenn ich ihn lieben müßte wie Isolde den Tristan, bei allen Heiligen und dem Herzen Jesu schwöre ich – ich will diese Liebe aus meinem Herzen reißen.«
Heinz schaute voll Verwunderung auf das junge Mädchen, dem er nie solche Kraft und Leidenschaftlichkeit zugetraut hätte. Sie war ein wenig zurückgetreten, während sie mit zum Himmel erhobenen Augen und mit erhobener Rechten ihren Schwur aussprach, hatte dabei aber nichts Theatralisches. Solch' eine Lebhaftigkeit der Ausdrucksweise gehörte zu ihrem leicht erregbaren Wesen.
Es war, als ob der heftige Ausbruch Madeleine das Herz erleichtert hätte. Sie nahm wieder des Bruders Arm und alle Drei gingen schweigend weiter.
»Sie müssen sich nicht wundern, Herr Eichenstamm,« fuhr Madeleine ruhiger fort, indem sie mit dem Taschentuche in ihrer Rechten die letzten Thränen trocknete, »daß ich in Ihrer Gegenwart so offen spreche – ich sehe aber in Ihnen den Freund meines einzigen Bruders, meines einzigen Vertrauten, und als solchen auch den meinigen.«
Sie reichte Heinz die Hand, die dieser herzlich drückte.
»Ich danke Ihnen,« erwiderte er. »Sie haben Ihr Vertrauen keinem Unwürdigen geschenkt. Ich bin fast so selbstsüchtig, zu wünschen, daß Sie einmal eines Helfers bedürften. Sie würden mich an Ihrer Seite finden.«
»O, ich zweifle nicht daran, Herr Eichenstamm, ich zweifle nicht daran. Ich zweifle auch nicht daran, daß der Augenblick kommen wird, wo ich Sie um Ihre Hülfe werde angehen müssen.«
Sie waren unterdessen bis an das äußerste Ende des Parkes gelangt. Von hier aus lief ein, ein paar Hundert Schritte langer Fußpfad durch die Felder in den Garten des Pastorates.
»Auf Wiedersehen, Horace, auf Wiedersehen, mein Fräulein!« sagte Heinz, indem er den Geschwistern die Hand reichte.
»Auf Wiedersehen, Heinz,« erwiderte Horace. »Du bist doch zum Abende jedenfalls zurück?«
»Jedenfalls.«
Heinz ging langsam und zögernd, denn es waren schmerzliche, peinliche Empfindungen, die das Haus da in ihm wachrief. Er sollte jetzt zum ersten Male seit vier Jahren die Verwandten wiedersehen. Wie würden sie ihn empfangen? Anders hatte er sich die Zukunft ausgemalt, damals, als er hinausfuhr in die Fremde. Wie kam er jetzt zurück? Was hatte er aufzuweisen, um den ungeduldigen Fragen der Seinigen gerecht zu werden? Was hatte er erreicht? War er doch eben im Begriffe, wieder ganz von vorn anzufangen. Er kam sich vor wie ein Schiffer, der in gebrechlicher Barkasse heimkehrt in den heimischen Hafen, den er vor Jahren in stattlichem Vollschiffe verlassen.
Als Heinz in das Pastorat trat, fand er den Onkel und die Tante gerade beim Frühstücke.
»Siehe da, Heinz,« rief die Tante, indem sie aufsprang und Heinz entgegeneilte; »bist Du nun endlich wieder zurück?«
Auch der Onkel erhob sich und begrüßte den Neffen. Der Pastor war nicht gerade kalt, aber auch nicht herzlich.
»Seit wann bist Du zurück?« fragte er, als Alle drei Platz genommen hatten.
»Seit gestern.«
»Du bist mit den Baltevilles zurückgekehrt?«
»Ja, mit den Baltevilles.«
»Nun, und was denkst Du jetzt zu unternehmen?«
»Ich beabsichtige Landwirth zu werden.«
»Wie? Willst Du denn Deine Studien unbeendet lassen?«
»Ja.«
»Lieber Heinz,« rief die Tante, »das ist ja nicht möglich! Wir hörten hier, Du habest in Fischersbach für eine Arbeit eine Preismedaille bekommen und glaubten daher, Du seiest mit Leib und Seele Historiker. Verhielt sich das nicht so?«
»Allerdings, liebe Tante; aber Verhältnisse, auf die ich nicht näher eingehen will, machen es mir wünschenswerth, daß ich mich der Landwirthschaft widme.«
Der Onkel schüttelte bedenklich den Kopf, die Tante nickte lächelnd vor sich hin, als wollte sie sagen: »Dachte ich es mir doch!«
»Bist Du mit Fräulein Balteville verlobt?« fragte sie in ihrer geraden Weise.
Heinz wollte auffahren, beherrschte sich aber und sagte trocken:
»Nein.«
»Nun,« erwiderte die Tante etwas empfindlich, »uns könntest Du es ja immerhin sagen.«
»Erlaube, liebe Tante,« sagte Heinz gereizt, »daß ich Dich darauf aufmerksam mache, daß ich soeben ›nein,‹ nicht ›ja,‹ sagte.«
Heinzens einsilbige, schneidige Art verletzte den Onkel von vornherein.
»Hast Du im Auslande irgend ein Examen gemacht?« fragte er.
»Nein.«
»Nun, Du wirst durch diese Nachricht Niemand überraschen. Ich dachte es mir gleich, daß es mit der Medaille nicht weit her ist.«
»Ich denke, Du fragtest, ob ich ein Examen gemacht habe?«
»Nun ja. Erinnere Dich, was wir Alle Dir vorhersagten, als Du nach Deutschland gingst. Man weiß ja, was das heißt, in Deutschland studiren. Das ist weit von der Heimath und kein Mensch weiß, was man da treibt.«
Heinz fühlte, wie er vor Zorn erröthete, aber er kämpfte ihn nieder. Er hatte sich fest vorgenommen, mit den Verwandten in Frieden zu leben.
»Man weiß ja,« fuhr der Onkel fort, »wie unsere Landsleute da draußen studiren. Mir war die Geschichte mit der Medaille von vornherein unwahrscheinlich.«
»Nun, Heinz,« sagte die Tante begütigend, »Du kannst ja, wenn Du Dir nur die Lehre zu Herzen nimmst, immer noch ein tüchtiger Mensch werden. Schade ist es freilich um die vier Jahre und das viele Geld, aber wenn Du nur recht in Dich gehst, brauchst Du nicht zu verzweifeln. Man kann ja auch als Landwirth sein Brod in Ehren essen.«
Heinz fühlte, daß das Gespräch so nicht fortgehen durfte, wenn es nicht zu einer Scene kommen sollte. Vor Zorn am ganzen Leibe zitternd, behielt er doch seinen Entschluß im Auge und beherrschte sich, obgleich ihm die Aufregung kalten Schweiß auf die Stirn trieb. Er sah in diesem Augenblicke ein Heer von Demüthigungen voraus und diese Aussicht machte ihm das Herz still stehen vor Zorn und Furcht.
»Lieber Onkel,« sagte er mühsam, »ich glaube wirklich, daß wir gut thun würden, wenn wir dies unerquickliche Thema verließen. Da Du, Deiner eigenen Aussage nach, von meiner Studienzeit nichts weißt, als daß ich sie in Fischersbach verbrachte, so bist Du doch auch nicht in der Lage, darüber zu urtheilen, ob ich sie gut oder übel angewandt habe.«
»Nun,« meinte der Onkel einlenkend, denn er sah Heinz an, in welcher Aufregung sich dieser befand, »es giebt doch auch in diesem Falle ein Kennzeichen, aus dem man einen Schluß ziehen kann. Wer die Universität verläßt, ohne ein Examen gemacht zu haben, der hat seine Studien doch jedenfalls nicht absolvirt und mithin sein Ziel nicht erreicht. Entsinne Dich dessen, was wir Dir vorhersagten, Heinz, als Du die Schule verließest, ohne das Maturitätsexamen gemacht zu haben. Jetzt ist es ganz so gekommen, wie wir voraussahen – Du hast eben auch die Universität verlassen, ohne Dein Studium beendet zu haben. Ich glaube Dir vorhersagen zu müssen, daß Du nie ein wichtigeres Lebensziel erreichen wirst. Es wird Dir auch in der Landwirthschaft nicht glücken.«
»Das mag wohl sein,« sagte Heinz, nun ganz kalt, denn sein allzusehr verletzter Hochmuth bäumte sich entrüstet in ihm auf und half ihm über den Zorn hinweg. »Das mag wohl sein. Wie geht es den Vettern?«
»Du bist, wie ich sehe,« sagte der Onkel, »noch immer derselbe eigenwillige Thor, als der Du uns verließest. Du glaubst noch immer, daß man ungestraft durchs Leben geht, wenn man keinen guten Rath annimmt und Du wirst Dir darüber Dein Lebensglück ganz und völlig zerstören.«
»Unerbetener Rath schafft keine That, Onkel,« erwiderte Heinz. »Wie geht es den Vettern?«
»Nun, so thue was Du willst!« rief der Onkel erzürnt, sprang auf und verließ das Zimmer. Heinz erhob sich auch und reichte der Tante die Hand hin.
»Lebe wohl,« sagte er gezwungen lächelnd.
Die Tante war ganz außer sich.
»Du hast uns nicht gerade mit Aufmerksamkeit oder gar Liebe verwöhnt,« rief sie; »aber daß Du gleich am ersten Tage, da Du wieder hier bist, den Onkel, der Dich zum Theil erzogen hat, den Bruder Deines seligen Vaters, so beleidigen würdest, das hatten wir nicht erwartet. Das ist schlecht gehandelt, Heinz, geradezu schlecht.«
Heinz zuckte die Achseln und zog die dargereichte Hand zurück. Dann wandte er sich um und verließ das Haus.
Sein Zorn war ganz und gar verraucht. »Diese Leute sind kein Verkehr für mich,« murmelte er hochmüthig; »es ist gut, daß wir gleich im Anfange aneinander und auseinander gekommen sind.«
Er ging nun auf dem Fußpfade, der durch die Felder führte, wieder zurück und betrat den Park von Parkhof.
»Habe ich mir heute irgend etwas zu Schulden kommen lassen?« fragte er sich. »Kam ich nicht mit dem festen Entschlusse hierher, um jeden Preis mit den Meinigen in Eintracht zu leben und wurde ich nicht so sehr gereizt, daß ich eben einfach weggehen mußte? Nun, wir haben, Gottlob, nichts mit einander zu thun!«