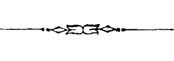|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Nicht ohne ein banges Gefühl hatte Gräfin Gisela vor bald vier Jahren dem Wiedersehen mit ihrem Sohn entgegengesehen. Wenn sie nun in die Zeit seiner ersten Jugend und Kindheit zurückblickte, so wunderte sie sich ihrer damaligen Verblendung, ja ihr Gewissen zeihte sie in mancher schlaflosen Nacht des ungemessenen Hochmuthes, der sie von ihrer Höhe herab die Reize des niedrig gebornen Kindes, weil es eben so tief unter ihrem Sohne stand, für ungefährlich halten ließ! Sie führte sich manchen jener Momente aus den Ferienzeiten des hochaufgeschossenen feurigen Studenten vor und konnte nicht begreifen, daß sie, die sonst ihr wachsames Auge überall hatte, nicht der wachsenden Liebe gewahr geworden und ihr zuvorgekommen war. – Froh, voll seligem Liebestaumel kam er nun in die Heimat, wie würde er die Kunde von der Zerstörung seiner Träume und Pläne hinnehmen? Wie schon in so vielen schweren Fällen ihres Lebens, so war es auch hier wieder die väterlich fürsorgende Liebe ihres alten Lehrers, der vermittelnd auftrat. Nicht daheim sollte den jungen Mann der erste Blitzstrahl treffen, des Mutterhauses erwärmende Liebe sollte nicht erkältet werden durch den Eindruck einer bösen Nachricht, an den Grenzen seiner engern Heimat wollte er ihn erwarten, an dem Kreuz, an dem Marie um Kraft gebetet, wollte er ihm ihre Antwort mittheilen. So geschah es. Mit der vollen Liebe der Religion, deren Träger er war, suchte er den aufbrausenden Jüngling zu beschwichtigen; seinen sanften Worten gelang es allmälig, die wilde Leidenschaftlichkeit, mit der er Mariens Vater und seine Mutter anklagte, das Mädchen in diesen Entschluß hineingehetzt zu haben, in ruhigen Schmerz zu verwandeln. Erschüttert lehnte er auf derselben Bank, auf welcher wenige Wochen früher Marie gesessen, und las den Brief, den sie ihm hinterlassen. Dann sah er lange in die blaue Luft und folgte dem Flug der Schwalben, wie sie in kreisendem Lauf sich haschten und jagten und des Sonnenlichtes freuten.
»Glückliche Vögel,« sagte er nach schmerzlichem Sinnen, »Ihr dürft Euch lieben, Eure Nester bauen wo und wie es Euch gefällt unter Gottes weiter Erde, da greift nirgends eine eisige Hand tödtend zwischen Eure Liebe und spricht von Unterschied des Standes, der Geburt. – Oh dieser erbärmlichen Formen, die der Mensch geschaffen, sich sein Dasein unerträglich zu machen! warum sollen wir sie nicht Umstürzen und die Welt genießen als das Paradies, das sie uns sein könnte.«
»Warum es so ist,« entgegnete der Priester, »das ist eines jener vielen ›Warum,‹ dessen Beantwortung wir in einem bessern Jenseits vielleicht finden werden. Es ist so aufgebaut in der allgemeinen Weltordnung, und das einmal Hergebrachte stößt nur selten ein schwaches Menschenkind ungestraft um. Vielleicht kommt es einmal anders, der strenge Unterschied des Standes gleicht sich einmal aus, und Bildung des Herzens und der Sitten ebnet die scheidende Kluft – heute sind wir noch weit, weit davon entfernt! und du selbst, mein Sohn, darin aufgewachsen, hättest dich in ruhigern Zeiten ihres Einflusses nicht entziehen können – deiner stolzen Mutter erbleichende Haare, ja selbst deiner alten Ahnen Bilder hätten zu Zeiten vorwurfsvoll auf dich geblickt, und Marie die sanfte schüchterne Taube, hätte sich als Eindringling gefühlt in das stolze Nest der Adler. Sie wird in dem Bewußtsein, für dein Glück, für das Glück deiner Mutter, ja selbst für das eigene Glück, das Richtige erfaßt zu haben, Ruhe und Frieden finden, wenn der erste Seelenschmerz überwunden ist.«
»Vater Johannes,« sagte Max sich erhebend – und die Hand auf des bewegten alten Mannes Schulter legend, sah er demselben forschend in die treuen Augen. – »Ihr habt wohl selbst geliebt, daß Ihr so gut versteht, einem unglücklich Liebenden Trost einzusprechen?«
»Ob ich geliebt habe, mein Sohn?« lächelte wehmüthig der Greis, »wenn es war, so liegt es tief in des Herzens verborgenstem Schrein der Erinnerung entrückt – nur das weiß ich, daß strenge Ausübung der obliegenden Pflichten die einzige Arznei ist, um leidende Gemüther gesunden zu lassen.«
Erst später am Abend dieses Tages trat Max bei seiner Mutter ein, er mußte erst sein heißes Blut wieder kühlen, um den richtigen Ton zu finden. Ernst schritt er auf sie zu und küßte ehrerbietig ihre Hand, sie aber zog ihn zu sich herab und barg ihr Antlitz an seiner breiten Brust, die Thräne, die sie auf ihrer Hand fühlte, brannte gleich einem heißen Tropfen auf ihrer Seele.
»Mein Kind,« flüsterte sie, als er neben ihr saß und sie zärtlich mit dem Arm umschlang, »zürnest du deiner Mutter nicht, weil sie den Bund nicht hätte segnen können und dürfen, der dich glücklich gemacht hätte?«
»Mama,« entgegnete Max, »es war ein schöner Traum, den ich geträumt; wie diese erste Liebe, wird keine mehr einziehen in mein Herz – aber ohne Ihren Segen wären wir nie glücklich geworden, das ist mir klar, nun ich daheim bin in dem alten Schloß meiner Väter.«
Mit dem Anblick der geliebten Mutter beherrschte ihn wieder vollständig der Zauber ihrer Liebe, die Macht ihres Allen imponirenden Einflusses. –
Kurze Zeit darauf verließ er mit Gabriele die Falkenburg, sie, um ihre Stellung anzutreten, er, um in sein Regiment einzurücken; bald darauf wurde dasselbe nach Wien versetzt und die Gräfin hatte in der schweren Zeit, die jetzt für sie anbrach, den Trost, ihre beiden jüngern Kinder beisammen zu wissen. Dagegen erfüllte sie das Geschick ihrer ältesten Tochter Therese, die in Dresden verheirathet war, mit schweren Sorgen; der Gemahl derselben, ein hochgestellter sächsischer Beamter, war seit Monaten leidend, und sie konnte aus der belagerten Hauptstadt seit langer Zeit keine Nachricht erhalten. Dabei hatte sie abwechselnd Freund und Feind im Quartier, beide wußte ihr ernstes, gebietendes Wesen in Schranken zu halten. Gleich einem hülfreichen Engel stieg sie hinab in die Hütten, die sich wie schutzsuchende Kinder an den Schloßberg anlehnten, spendete Hülfe und linderte die Noth und den Jammer des Krieges.
Seit fast einem Jahr war Gabriele nun wieder bei ihr, Leben und Sonnenschein in der alten Burg verbreitend. Briefe von Max hatten vollends ganz ihre Sorgen über seinen Seelenzustand genommen.
»Glauben Sie nicht, liebe Mama,« schrieb er von Wien aus, daß ich die arme Marie vergessen habe – oft wenn ich mit den Kameraden zusammen bin und es wild und bunt zugeht, dann taucht wie aus der Ferne ein ernstes Nonnenbild vor mir auf, wie es still betet, und ich schleiche mich weg, des schönen Jugendtraumes gedenkend.«
Nun stand er seit einem Jahr vor dem Feind; es lag nicht in Gräfin Gisela's Art, ängstlich zu zittern, dazu war sie zu sehr an Kriege gewöhnt, allein ernster ward sie und ihre Locken bedurften des Puders immer weniger, manche Stunde lag sie im Gebet vor dem Bild des Gekreuzigten; das Thurmzimmer zunächst dem ihrigen hatte sie in aller Stille räumen lassen und die Kammerfrau in ein anderes Gemach verlegt, dieses Zimmer, luftig und still, mit dem geräumigen Gemach in der Nähe, hielt sie bereit für einen Fall, der ja eintreten konnte.
Auch aus dem Feld trafen häufig Briefe von Max ein, freilich nicht so häufig und regelmäßig, wie in unsern geordneten Zeiten während des Krieges, wo jeder arme Bauer den Trost hatte, Nachricht von dem abwesenden Sohne zu bekommen.
»Sie wundern sich, geliebte Mama,« schrieb er diesen Winter, »daß mein bester Freund ein so junger Mensch ist, allein traurige Verhältnisse, die Niemanden bekannt sind, haben den jungen Simonitch vor der Zeit ernst gemacht und lassen sein Wesen älter erscheinen. Der erste Grund, daß ich mich mehr mit ihm beschäftigte, lag, wie Sie sich denken können, in der Art, wie er selbst sich mir empfahl, durch die kühne Geistesgegenwart, mit der er sich damals am Jungfernsprung benahm, und dann, daß er mir durch unsere Kaiserin selbst war empfohlen worden. Ich finde in ihm für manche meiner Liebhabereien, für Natur, für Poesie, mehr Verständniß als bei den Kameraden, deren wilde Trinkgelage mich häufig anwidern; stehle ich mich dann weg, so finde ich mich häufig mit ihm zusammen, den sie den ›Träumer‹ nennen, weil er sich stets fern von ihnen hält. Ich erzähle ihm dann von Euch meine Theuren, von den schönen Zeiten daheim, ja selbst von Marie und meinem ersten Jugendtraum! Letzthin erinnerte ich ihn daran, daß ich ihn vor mehreren Jahren in seiner Heimat gesehen – er war dazumal ein schöner stolzer Knabe, dem lachender Uebermuth aus den Augen blitzte – jetzt ist er freilich ganz anders – so ändert uns eben das Leben, und der Krieg mit seinen Gräueln. Auch hierin stimmen wir zusammen, bei allem Muth, bei aller Todesverachtung, die er bei jeder Gelegenheit gezeigt hat, verabscheut er wie ich die Gräuelthaten und Grausamkeiten, die nicht nothgedrungen mit dem Kriege verbunden sind; ein paar Mal hat er sich mit einer Energie ins Mittel gelegt, die den Betreffenden übel bekam, und die solchen imponirte, die in ihm nur einen träumerischen Knaben sehen, ja bei seiner Weichheit überraschte selbst mich die schonungslose Strenge, die er dabei zeigte. – Doch Sie werden ihn selbst kennen lernen; demnächst beziehen wir Winterquartiere und wenn meine verehrte Mama es erlaubt, werde ich ihn zu vermögen suchen, mich auf die Falkenburg zu begleiten.«
Dieses Wiedersehen war ein Sonnenblick, der auf lange, bange Winternächte leuchtend und erwärmend das Herz der Mutter belebte.
Inzwischen war die Nachricht von dem erfolgten Tode von Theresens Gatten auf Umwegen eingelaufen und bald darauf die der Einnahme Dresdens durch die Reichsarmee. Vereinzelte Berichte sprachen von Gräueln, die dort verübt worden – mit ängstlicher Spannung sahen die Bewohner der Falkenburg der zu hoffenden Ankunft Theresens entgegen.