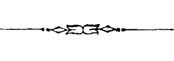|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die nächste Station, Madame, ist die Ihrige!« Diese Worte, von der Stentorstimme des Conducteurs am Waggonfenster gesprochen, rissen mich rasch aus dem unbehaglichen Halbschlummer, in den mich die Ermüdung der langen Reise geworfen. – Die jetzige Art zu reisen ist für Reise-Dilettanten, wie ich bin, immer mit Aufregung verbunden. Man kommt an, freut sich eines langersehnten Wiedersehens, darf sich aber ja nicht dieser Freude des ersten Augenblickes überlassen, denn der Zug hält nur fünf Minuten und braust mit unerbittlicher Schnelligkeit davon, ehe man gehörig für sein Gepäck gesorgt hat. Und vollends Abreisen! Die verschiedenen Scheidegrüße, Küsse und Händedrücke und letzten Aufträge, wie werden sie abgekürzt und in Hast gegeben, denn der Zug rast von dannen zur bestimmten Minute. Zu jetziger Zeit des allgemeinen Freiheittaumels begiebt sich der Mensch, wenn er auf Reisen geht, jeder Freiheit; von dem Augenblick, in welchem er die Fahrkarte gelöst hat, ist er der Sklave der Minute, ein lebendes Stück Gepäck, das durch die Maschine weiter befördert wird. Wie ganz anders war dies ehedem! ich erinnere mich zu meiner Jugendzeit, wenn wir alljährlich von der Stadt auf das Land oder auf Besuch zu den lieben Verwandten reisten, da hielt der große Wagen eine geraume Zeit vor dem Hause, man konnte so gemüthlich manches vergessene Stück noch in verborgene Seitentaschen stecken, den Freundinnen Lebewohl sagen und sich dann ganz behaglich in der geräumigen Kutsche einrichten – ebenso war es beim Ankommen, erst galt es alle begrüßen, dann erst wurden Taschen und Schachteln und Päckchen herausgeholt. – Ich war seitdem nicht viel gereist und nur die innige Liebe zu meinem Neffen, der sammt seiner jungen Frau mich mit Briefen bestürmte, sie endlich einmal zu besuchen, konnten mich bewegen, die lange Reise von Innsbruck nach der schlesischen Grenze zu unternehmen. Seit einem Jahr hatte er das Schloß unserer Väter, die alte Falkenburg, bezogen und das Schwert gegen den Pflug vertauscht; nun konnte ich nicht mehr widerstehen und alle Aengstlichkeit überwindend, hatte ich den Stiftsdamen Lebewohl gesagt, und begleitet von ihren besten Wünschen mein Reisebündel geschnürt. – Inzwischen hatte ich meine Sachen an mich genommen, um doch ja nichts zu vergessen, und da waren wir! – wahrhaftig dort steht er schon und sucht den Wagen entlang – »Max!« rufe ich – die Thüre wird geöffnet und ich liege in seinen starken Armen. – »Ihre Reisetasche, gnädige Frau!« ruft mir jemand nach und eine mitleidige Seele reicht sie mir lächelnd heraus! – Da hatte man's – wer denkt in solcher Freude noch an die Prosa einer Reisetasche!« Endlich war alles geordnet und ich saß im Wagen neben meinem Liebling und fuhr den waldigen Berghügeln zu.
»Wie lieb von dir, Tantchen,« sagte er, die zwei Braunen antreibend, »daß du dich zu der Reise entschlossen hast und endlich einmal kommst, unser Glück selbst in Augenschein zu nehmen.«
»So bist du also glücklich?« fragte ich, mehr um eben etwas zu sagen, als weil ich darob im Zweifel war. – »Das fragst du noch?« lachte Max, »und hast doch alle Kämpfe mitgemacht, hast die Blume erblühen sehen, deren Duft mich beglückt; o Tante, für jedes Wort, das du für uns beim Vater einlegtest, sei tausendmal gesegnet. Er selbst hat sich vor seinem Tod von unserem Glück überzeugt und gesehen, daß eine Frau auch ohne Geld Schätze mitbringen kann!«
Wie freute ich mich, Ernestine wiederzusehen, die Tochter einer meiner Jugendfreundin, die, früh gestorben, sie meiner besondern Sorgfalt anvertraut hatte. Ein täglicher Gast in unserem Damenstift hatte sie bei mir Max kennen gelernt, der erst in Innsbruck auf hoher Schule und dann in Garnison Jahre lang bei mir daheim war.
»Wie hat sich denn Ernestine in der alten Burg unserer Väter angewöhnt? und wie hast du es überhaupt dort gefunden? recht verfallen und verwildert wohl durch die lange Zeit, daß sie unbewohnt gewesen ist?«
»Nicht so sehr, als man denken sollte,« entgegnete Max, den Pferden mit der Peitsche die lästigen Fliegen verjagend, »die Familie des Kastellans wohnte in der Burg und hielt Alles in so gutem Stande, daß man wohl sah, wie das Geld meines Vaters gewissenhaft verwendet würde. Der Kastellan und der Förster sind beide der Familie so anhänglich, wie dies nur dann ist, wenn, wie hier, die Stellen seit mehr denn 100 Jahren von Vater auf Sohn sich vererbten. Im Anfang fürchtete sich meine kleine Frau etwas in dem altersgrauen Schlosse und ich ließ, was eigentlich der Schönheit desselben etwas Eintrag thut, den bewohnten Theil im neueren Styl herrichten, allein nun hat sie sich daran gewöhnt und überzeugt, daß es mit dem Geisterspuk nicht weit her ist.« – »Nächst der Sehnsucht dich zu sehen,« entgegnete ich, »und daß sie groß war, brauche ich dir wohl nicht zu sagen, zog es mich auch, dieses alte Schloß, von dem ich immer viel und manches Geheimnißvolle gehört, einmal zu sehen und die Bilder vieler unserer Ahnen, die dort sind, kennen zu lernen.« – »Das war ich von meinem aristokratischen Tantchen überzeugt,« erwiederte Max, »du sollst aber auch alles sehen, nur in einen Theil kannst auch du nicht eindringen.«
Lachend blickte er von seinem hohem Sitze auf mich herab, die neugierig fragend aufschaute. »Doch,« fuhr er fort, »dort taucht das Schloß eben aus dem Wald heraus und gerade der finstere ›Geisterthurm‹ begrüßt uns zuerst!« Mit der Peitsche deutete er in die angegebene Richtung, wo in einem grünen, fast von allen Seiten mit waldigen Bergen umgebenen Thal, auf einem Hügel aus uralten Bäumen ein grauer Thurm zuerst und dann allmälig das ganze Schloß sichtbar wurde. Die Abendsonne sandte ihre letzten Strahlen auf das alte Mauerwerk, daß selbst sein düsteres Aussehen heller ward und seine alten von Schlingpflanzen halb versteckten Steine sich zu verjüngen schienen, um mich zu bewillkommnen. Allmälig kam der neuere, oder besser der in modernere Kleidung gehüllte Theil des Schlosses zum Vorschein, wo eine steil gegen das Thal abfallende Terrasse einen freundlichern Anblick gewährte. Jetzt sah man auch jemand winken.
»Dort steht Ernestine!« rief erregt Max und ließ die Pferde, die den Stall witterten, laufen, »siehst du sie? sie kann es kaum erwarten, dich an ihr Herz zu drücken.«
Noch eine halbe Stunde den steilen Berg hinan und ich drückte Ernestine, die mir doppelt lieb war, als die Gattin meines geliebten Neffen an meine Brust und zwei niedliche Kinder, ein Knabe und ein Mädchen, schmiegten sich halb scheu, halb zutraulich an mich.
»Nun wir dich einmal haben,« sagte Ernestine mich zärtlich anblickend, als wir in der Halle am freundlichen Theetische saßen, »lassen wir dich nicht so bald wieder los! wenn es dir nur auch bei uns gefällt!« – »Warum sollte es mir nicht gefallen bei euch? in schöner Umgebung? im Kreise meiner glorreichen Ahnen, deren Bekanntschaft ich erst noch machen muß?« frug ich lächelnd, mit einer grüßenden Handbewegung zu der Reihe Bilder blickend, die in Rüstung und Allonge-Perücken, in Halskrausen und Reifröcken mit fabelhaften Taillen und winzigen Händchen den Gruß ceremoniös zu erwiedern schienen.
Zögernd blickte Ernestine auf Max, der, seine Cigarre rauchend, den Blick nicht bemerken wollte und versetzte etwas kleinlaut:
»Wenn wir dich nur in ein anderes Zimmer hätten logiren können.« – Etwas geärgert warf Max seine Cigarre in das offene Kamin und stand auf.
»Da hat man's,« sagte er ungeduldig, »warum denn lang vorher davon sprechen, das regt ja nur die Fantasie unnöthig auf. Siehst du, Tante,« wandte er sich an mich, indem er die Hand seiner Frau, die sich ihm begütigend genähert hatte, in seine Hände genommen, »siehst du, das ist ihr einziger Fehler: sie ist erschrecklich abergläubisch und furchtsam.«
Meine Neugierde war rege geworden und ich entgegnete: »Aber etwas, das diesem Aberglauben Nahrung gibt, muß doch da sein, du selbst sprachst auf dem Herweg so geheimnißvoll, als könne oder dürfe ich nicht überall eindringen und nanntest jenen Thurm den Geisterthurm.«
»Ach, und das ist es ja eben, was mich bekümmert,« rief nun Ernestine, »daß wir nicht anders konnten, als dich in jenen Flügel logiren, in das alterthümliche Zimmer des geheimnißvollen unberührbaren Bildes.«
»Das nur so lange unberührbar bleibt, als Aberglauben und – nun ich will nichts weiter sagen–« erwiederte etwas heftig der junge Mann.
»Nenne es Aberglauben,« versetzte Ernestine mit einem feuchten Blick voll Liebe zu ihrem Gatten aufsehend, »nenne es selbst Beschränktheit, ich fühle nicht den Muth in mir, die Erste zu sein, die einen tief eingewurzelten Glauben unberücksichtigt lassen kann. Es ist wohl, weil ich so unaussprechlich glücklich bin in deinem Besitz, in dem Besitz unserer Kinder, weil seit 7 Jahren kein Leid sich an uns heranwagte, seit den bangen Zeiten des Harrens und Hoffens unserer langen Liebe daß ich so ängstlich bin. Zu was ein Geheimniß mit Gewalt lösen wollen, das bis jetzt geheiligt geblieben.«
»Nun aber dürft ihr meine Neugierde nicht länger auf die Probe stellen, Kinder,« rief ich gespannt, »ich bin müde und sehne mich nach Ruhe, aber bevor ich mein geheimnißvolles Gemach betrete, muß ich wissen, um was es sich handelt. Hängt denn ein so entsetzliches Bild in meinem Zimmer, daß du fürchtest, meinen Schlaf gefährdet zu sehen?«
»Du sollst dich selbst überzeugen,« entgegnete Max lachend, den bereit stehenden Leuchter ergreifend, »wir wollen dir das Geleite geben. Mir ist nicht bange, denn seit mehr denn hundert Jahren zeichnen sich nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen unseres Geschlechtes durch Muth aus.«
»Ich könnte nicht sagen, daß der bei mir sehr stark vertreten wäre,« versetzte ich, mich erhebend, »sobald es sich um etwas Greifbares handelt, bin ich die Erste, die davor zurückbebt, wogegen ich Geisterfurcht gar nicht kenne und besonders dann nicht, wenn mein Interesse angeregt wird, was stets der Fall ist, wo es gilt, in den Zeiten unserer Voreltern zu forschen und Alterthümer aufzufinden.«
»Jenes Bild nämlich,« nahm mein Neffe wieder das Wort, während wir uns langsam auf den Weg machten, »hängt vielleicht seit mehr denn 100 Jahren an derselben Stelle, ohne daß jemand gewagt, es nur einmal herunterzunehmen, weil die Sage im Mund der Leute geht, es bringe dem Schloß Unheil, wenn es von der Stelle gerückt würde. Natürlich hat dadurch nie jemand die Kehrseite gesehen, wo allenfalls ein Name stehen könnte; so hängt es über einer Thüre, die den Eingang des engen mit Schießscharten versehenen Ganges öffnet, der an den grauen Eckthurm führt. Der Gang hat von unten eine Thüre in das Freie und direkt in den Wald und oben eine Oeffnung in die Küche, beide Eingänge sind verschlossen und als ich sie mit Gewalt öffnen lassen wollte, denn beide wären von großem Nutzen für uns, protestirten die beiden Alten, der Kastellan und der Förster, mit solcher Macht und meine Frau half so ehrlich mit, daß ich bis jetzt nicht durchdrang, dagegen aber es durchsetzte, wenigstens dieses Zimmer, eines der schönsten im Schlosse, zu benützen.«
Wir waren inzwischen durch Gänge und über Treppen darin angelangt und überrascht mit einem Ruf der Bewunderung blieb ich stehen. Eine alterthümliche Lampe hing von der dunkeln getäferten Decke herab und beleuchtete ein Gemach aus alter Zeit, wo jedes Stück harmonisch in seiner Alterthümlichkeit zum andern paßte. In der Mitte der Hauptwand das geräumige Himmelbett und in der Ecke der große grüne Kachelofen, der kleine hohe Eckschrein mit dem geschnitzten Kruzifix, der Madonna darüber und dem sammtgepolsterten Betschemel davor paßten zu den hochlehnigen Stühlen mit verblaßtem Sammt und den Fenstern mit runden in Blei gefaßten Scheiben, zu dem schweren eichenen Tisch in der Mitte, zu dem Schreibtisch mit den eingelegten Schubfächern und der hohen Rückwand. Entzückt klatschte ich fast jugendlich in die Hände:
»Und wenn alle Geister der Falkenstein mir hier ihren Besuch abstatten wollten,« rief ich, »hier möchte ich wohnen und, in frühere Zeiten mich versenkend die alten Möbel sprechen und mir erzählen lassen, was sie erlebten. Und nun gute Nacht, Kinder, habt Dank, die alte Tante so freundlich bewillkommt zu haben!«
Mit herzlichem Kuß entließ ich sie und hörte nur noch, wie Ernestine zu ihrem Gatten sagte: »Die Tante hat Muth, mir gefiele es hier nicht!«
Meine Phantasie war durch die Reise und die Freude zu sehr aufgeregt, um gleich auspacken zu können. Ich nahm das Licht und leuchtete noch einmal durch das ganze Gemach. Vor dem einen abgestumpften Eck blieb ich stehen; über der niedern Thüre mit dem schweren silberbeschlagenen Schloß hing ein Bild, das Einzige im Zimmer, in einem breiten geschnitzten Rahmen; es stellte in halber Lebensgröße die volle Gestalt eines Jünglings dar; ein Militärmantel, auf einer Seite über die Schulter geworfen, bedeckte zum größten Theil die Figur; der Schnitt der Uniform, die Form der Kopfbedeckung, die neben ihm am Boden lag, deutete auf die Zeit des siebenjährigen Krieges, diese für Oestreich so traurige Zeit. Den spitzigen Degen in der Scheide, lehnte der Jüngling sinnend an dem knorrigen Stamm einer Buche, hinter welcher der Blick sich in die Perspektive eines Waldes verlor. Ich hob das Licht höher, um die Züge der gut gemalten Gestalt zu erkennen, und blieb gebannt davor stehen. Große dunkle Augen blickten ernst auf mich nieder. Der festgeschlossene Mund schien trotzig mich herauszufordern, sein lange bewachtes Geheimniß zu ergründen. Wenn ich den Blick davon wegwenden wollte, schienen die Augen mit ihrem magischen Glanze sich nach mir zu drehen, immer wieder zog mich's hin, immer bekannter wurden mir die Züge. Jahre verschwanden vor meinem geistigen Blick und mein kurzer schöner Jugendtraum tauchte plötzlich vor mir auf. Ja, die Geister der Entschlafenen waren wach geworden, es waren die Züge des Geliebten meiner Jugend, die Züge Wilmos' von Falkenstein, meines Namensvetters von der kroatischen Linie, die mir plötzlich wieder nach beinahe 20 Jahren so lebendig vorgezaubert wurden. Jene schöne frohe Jugendzeit in Graz, wo wir uns kennen gelernt und verlobt, ehe ein Gewittersturm kam und die Blüthen meines jungen Glückes knickte. Der unselige Krieg in Italien, der Oestreich die Perle seiner Länder raubte, entriß mir den Geliebten. Die kroatische Linie der Grafen von Falkenstein war erloschen, – meinen Wilmos konnte mir niemand mehr ersetzen! Solch' eine Liebe läßt nur Wehmuth, doch keine Bitterkeit zurück, sie bleibt aufbewahrt in dem verborgensten Schreine des Herzens, auch wenn dasselbe aufgehört hat, mit dem Ungestüm der Jugend zu hoffen und zu wünschen. Manchmal fast vergessen wie ein schöner Traum, regt er sich wie jetzt eben bei mir, und der Schrein wird geöffnet und das Bild betrachtet und geliebkost.
Noch vom Bett aus sah ich im unsichern Schein der flackernden Nachtlampe seine dunkeln Augen auf mich gerichtet, bis die meinigen sich schloßen und ein Traum mich zurückversetzte nach dem schönen Graz. Ja, sie waren wach geworden die Bilder manches früh Entschlafenen, aber es waren keine schauerliche Geister, die mich umschwebten, sondern liebe Freundesgestalten, die mich heimsuchten; ich war nicht mehr das alte Stiftsfräulein, sondern das junge muntere Mädchen, das lachend und hoffnungsvoll dahinflatterte!
Am andern Morgen saß ich so sehr in Gedanken verloren vor dem Bild, daß ich nicht bemerkte, wie ganz leise die Thüre geöffnet wurde und schüchtern die kleine Elsa hereingetrippelt kam mit einem großen Strauß der herrlichsten Rosen in dem Händchen; erst als sie vor mir stand und ihr Köpfchen zu mir emporhebend leise »Guten Morgen, liebe Tante,« flüsterte, gewahrte ich sie und hob sie küssend auf meine Knie.
»Die liebe Mutter läßt dich fragen, wie du geschlafen hast und schickt dir hier einen Morgengruß,« entledigte sich die Kleine ihres Auftrages.
»Dank, Dank, mein Engel,« erwiederte ich, »ich hörte dich gar nicht eintreten, ich glaube, du flogst wie ein herziges Vögelchen durch das offene Fenster herein.«
»Du warst ganz versunken im Anschauen dieses Bildes, Tante,« versetzte das kleine Mädchen.
»Das Bild erinnert mich an den Frühling meines Lebens,« entgegnete ich. »Was ist der Frühling des Lebens?« fragte Elsa, zutraulich zu mir aufsehend.
»Das ist, wenn alles um uns herum blüht und duftet,« erwiederte ich, mehr zu mir selbst redend, »wenn die Schwüle des Sommers noch nichts versengen konnte und noch kein Gewittersturm vernichtend über zarte Blumen hinbrauste.«
»Bin ich schon im Frühling des Lebens?« fragte die Kleine altklug.
»Du bist noch nicht darinnen, mein Liebling,« gab ich der kleinen Fragerin zur Antwort, »aber du kommst hinein und inzwischen streust du Blumen und Knospen dahin, wo der Herbst mit seiner kalten Luft vorübergegangen. Ich bin der Herbst, du der keimende Frühling.«
»Der Herbst ist kalt und häßlich, du aber bist warm und schön,« sagte die Kleine, zärtlich ihre runden Arme um mich schlingend.
»Das macht deine und deiner Eltern Liebe, die machen den Herbst warm und freundlich.« Damit nahm ich die Kleine an die Hand und sie führte mich in die Halle, wo das Frühstück bereit stand und ihr Vater uns empfing. Auch Ernestine kam und beruhigte sich erst vollkommen auf meine Versicherung, daß ich süß und unbelästigt durch irgend welchen unheimlichen Lärm geschlafen.
»Und wenn es einen gegeben hätte, so hätte ich mir ihn sehr gut erklärt,« beruhigte ich ihr ängstliches Gemüth vollends, »denn in den verlassenen Räumen hinter der geschlossenen Thüre kann es Ratten genug haben.«
»Und Eulen,« sagte Max, »finden dort den besten Platz für sich und ihre Familie; damit wären die Geister, die den letzten Besuch, den wir hier hatten, meinen alten Hofmeister, so bald vertrieben, zur Genüge erklärt.«
»Da wir nun schon an den Geistern sind,« sagte ich mich erhebend, als das Frühstück beendigt war, »so lasse uns zur nähern Bekanntschaft dieser alten ernst und kriegerisch aussehenden Herren schreiten und die schönen Damen betrachten.«
»O weh,« rief tragikomisch mein Neffe aus, indem er sich ebenfalls erhob, »da kommst du an den Rechten, ich habe mich so viel über die alten Herrn geärgert, deren erblassenden Glanz ich durch eine reiche Heirath wieder auffrischen sollte, während mein Herz schon Ernestine gehörte, daß ich mich wenig um sie und ihre Schicksale, wer ihre Gemahlinnen und wie viele Kinder sie hatten, gekümmert; einen Sohn hatte ein Jeder, so viel steht fest, sonst stände ich nicht da, und damit bist du doch zufrieden, Tantchen?«
»Er ist ein arger Ketzer,« rief lachend Ernestine, die am Kaffeetisch noch die Kinder versorgte, »man kann ihm aber doch nicht böse sein!«
»So ist mir's von jeher gegangen,« erwiederte ich, »aber ich lasse dich doch nicht los, einige Namen mußt du mir doch nennen; z. B. wer ist dieser schöne Mann in Uniform, unten steht M. v. F. 1766? Welch' eine Hünengestalt scheint auch er, wie alle nachfolgende Falkenstein, du mit eingerechnet.«
»Das ist Graf Max von Falkenstein, hier allgemein der alte Graf genannt, weil er bis an sein Lebensende hier gelebt. Unter ihm waren dieses Gut und die kroatischen Besitzungen vereinigt und wären es jetzt wieder, wenn er nicht dort die Bestimmung getroffen, daß die weibliche Linie im Fall des Aussterbens der männlichen erbberechtigt sei; durch solche Bestimmungen gehen die Familien zu Grunde. Die Güter hatte er als Schenkung von Maria Theresia erhalten.« »Mein Vater zeigte mir einst die Abschrift dieser Urkunde,« entgegnete ich, »sie lautete, so viel ich mich erinnere, daß Kaiserin Maria Theresia besagte Güter, im Fall je der Staat Anspruch darauf erheben wolle, dem Grafen Max von Falkenstein und seiner edlen Gemahlin auf ewige Zeit zuerkenne in Anbetracht der Verdienste dieser Letztern.«
»Das wußte ich freilich nicht,« erwiederte ernster Max, »aber mir ist es nur unbegreiflich, warum denn nirgends ein Bild dieser Gattin zu finden ist, warum diese Verdienste in keinem Archiv ausgezeichnet sind.«
»Vielleicht ist alles in Kroatien,« entgegnete ich, und wandte mich zu dem nächsten Bild, während mein Neffe den eben eintretenden Kastellan empfing. Das Bild stellte eine schöne Frau vor mit energischen Zügen, in denen sich eine gewisse Strenge und Entschlossenheit mit sanfter Weiblichkeit paarte, ein grünes Jagdkleid umschloß ihre volle Gestalt, aus der weißen Krause erhob sich der schlanke Hals, auf dem der schöne Kopf graziös saß, bedeckt mit einem dreieckigen Hütchen zum Kleide passend; ihr in den Zügen ähnlich, aber mit zartern jugendlichern Formen erschien das Bild eines jungen Mädchens als Schäferin gekleidet, auf den gepuderten Locken ein Strohhütchen, unter denen ein paar braune Augen munter herablachten und sich zu wundern schienen, daß sie sich auch da befand unter den Ahnfrauen.
»Hier ist der rechte Mann,« rief Max, mir den ehrwürdigen Kastellan vorstellend, »um dir die Herrschaften vorzuführen, er ist unter ihnen aufgewachsen und ihm verdanken wir's, daß sie so gut erhalten blieben.«
»Das war nur meine Schuldigkeit, Herr Graf,« sagte geschmeichelt der alte Mann, und sich zu mir wendend, versetzte er: »Gnädige Gräfin stehen gerade vor den Persönlichkeiten, auf die Euer Gnaden mit Recht ganz besonders stolz sein können. Graf Max von Falkenstein war schon in jungen Jahren General im siebenjährigen Krieg; was er als Mann, das war aber seine Mutter Gräfin Gisela von Falkenstein als Frau; während ihr Gemahl im Felde war in den schlesischen Kriegen und nachher noch als Wittwe, während dem siebenjährigen Krieg, lebte sie ohne Furcht vor den Kriegsgefahren hier auf dem Schlosse. Ja, man sagt sogar, daß sie nach dem Gefecht bei Maxen, dessen Schauplatz man von dem alten Gemach oben übersehen kann, selbst mit Dienern und Tragbahren hinab ging, um zu retten, was zu retten war, doch das ist nur Gerücht.«
»Ja, ja,« erwiederte ich, mich besinnend, »von ihr hörte ich; sie gilt wohl deßhalb in unserer Familie für die kriegerische Ahnfrau.«
»Diese holde Schäferin gehört eigentlich nicht hieher,« nahm der Kastellan, meiner vorigen Bemerkung zustimmend, auf, »es war Gabriele Gräfin von Falkenstein, die Tochter der Gräfin Gisela und des Grafen Hannibal, und heirathete den Grafen Karl Nostitz, einen Vetter.«
Der alte Mann war in der That ein lebendiger genealogischer Kalender, was unsere Familie betraf. Die Andern waren ihren Geschäften nachgegangen, und da ich ihm mit großem Interesse zuhörte, denn auch meinem Gedächtniß war vieles entfallen von dem, was meine Mutter mir erzählt, so wurde ihm ganz wohl, wieder einmal in den Falkenstein's aufzuleben. »Die Jugend fühlt lange nicht mehr das Interesse für die Vorfahren, wie früher,« so sagte meine Mutter ehedem zu mir, und so sage ich jetzt selbst. Wenn das so fortgeht, so weiß der Enkel bald nicht mehr, wie seine Großmutter hieß, die Zeit bringt das so mit sich, aber mir altem Fräulein, das eine sorgenfreie Lebensstellung einer gewissen Reihe adeliger Vorfahren dankt, wird es schwer, sich in solch' philosophische Gleichgültigkeit gegen das, was gewesen, zu finden.
An diesem Tage machte ich noch eine Entdeckung in meinem Zimmer; in einem der vielen Schiebfächer des Schreibtisches fand ich einen kleinen Schlüssel, der den schönen geschnitzten Aufsatz öffnete; gespannt schlug ich die beiden Thürflügel aus einander und entdeckte, in zwei Reihen aufgestellt, in Thon gebildete Figuren, jene Banden Rothmäntel darstellend, wie sie noch jetzt, aber etwas eingeschränkt, in unserer Armee bestehen, und früher im dreißigjährigen und in den spätern Kriegen leider den Ruf der Oestreicher durch zahllose Greuelthaten befleckten. Verwundert holte ich Max, ihm diese Figuren zu zeigen, er hatte keine Ahnung woher sie stammten, selbst unser alter Gewährsmann, der Kastellan, wußte nichts.
»Wer weiß, was du noch alles findest, Tantchen,« sagte Max, »um Ende findet sich noch ein großer Petrusschlüssel, der uns jenes Paradies öffnet, welches von dem geheimnißvollen Bild so streng bewacht wird.«
»Ich zweifle sehr, dort die geringste Aehnlichkeit mit einem Paradies zu finden,« entgegnete ich lachend.
»Das kann man gar nicht wissen,« meinte Max, »übrigens,« setzte er ernsthafter hinzu, »Spaß beiseite, solltest du hineindringen, so sagen wir vorerst Ernestinchen nichts davon.«
Nachdem die nothwendigsten Besuche in der Nachbarschaft gemacht waren, bat ich die Kinder, ungenirt ihre Ausflüge zu machen und mich daheim zu lassen. Es waren meist junge Ehepaare, und ich hatte das ganze Jahr in Innsbruck genug geselligen Verkehr, um Lust zu empfinden, hier neue Bekanntschaften anzuknüpfen. Kamen sie dann zurück, so hörte ich ihnen gern zu, und Ernestine folgte beruhigter den Aufforderungen ihres lebhaften Mannes zu größern Ausflügen, wenn sie ihre Küchlein mir anvertrauen konnte. Ich genoß in vollen Zügen die Stille eines Landlebens, das durch kein Geräusch der Eisenbahn unharmonisch gestört wurde; am liebsten suchte ich den Wald auf, und öfters machten wir größere Spaziergänge, die kleine Elsa und ich; sie war ein liebes Geschöpfchen mit ihren sinnigen Fragen und ihrer unbewußten Poesie. Häufig war der Schluß dieser Wanderungen das tief im Wald versteckte Försterhaus. Der Förster war ein Seitenstück zum alten Kastellan, von ihm hörte ich manches, während die Försterin zu Elsens Entzücken einige kunstvolle Klosterarbeiten herbeiholte und uns mit Milch, Butter und Schwarzbrod bewirthete, wie es uns nirgends besser schmeckte. Einmal kam ich auf das Bild in meinem Zimmer zu sprechen und ich fragte den Förster, woher wohl diese Sage stamme und diese Scheu, sowohl vor dem Oeffnen der Thüre, als dem Berühren des Bildes.
»Sehen Euer Gnaden,« entgegnete der Alte, »das stammt noch von dem alten Herrn Grafen her, der hat es befohlen, dort solle das Bild bleiben.«
»Welchen alten Grafen meinen Sie?«
»Nun, den alten General, den Grafen Max, der auch oben starb, in dem Himmelbett gerade gegenüber dem Bild. Er nahm auch den Schlüssel mit sich ins Grab,« setzte er nach einigem Zögern mit der Miene der festesten Ueberzeugung hinzu. »Mein alter Großvater, der sich seiner noch erinnern konnte, erzählte uns Kindern oft von ihm und wie er stets nur in jenem Zimmer gewohnt; selbst seine Söhne, der eine lebte ja noch eine Zeitlang hier, kamen nie in den abgeschlossenen Flügel, nur er und ein sehr alter Diener, den er mit aus Kroatien gebracht hatte.«
»Aber er ist doch nicht in der hiesigen Gruft begraben, obwohl er hier starb?«
»Er wurde nach Kroatien gebracht, wo seine Gemahlin begraben war. Sie soll man nur selten hier gesehen haben. Auch nach seinem Tod ehrten seine Söhne das Gebot; nun können Sie begreifen, wie frevelhaft es wäre, seine Ruhe zu stören durch ein gewaltsames Eindringen in das, was er verborgen hielt.«
Begreifen konnte ich es nun zwar nicht, allein ich sah ein, daß nichts zu machen war und wandte mich zur kleinen Elsa, die mir freudestrahlend ein wirklich kunstvoll gearbeitetes Kistchen zeigte; auf blauer Seide waren Silber- und Goldflitter gestickt, mit feinen Seidenfäden verbunden. Innen im Deckel war das Bildniß einer in ihrem Sarge ruhenden Klosterfrau.
»Das ist aus alter längstvergangener Zeit,« erläuterte die Försterin, als ich es bewundernd untersuchte, »dies und all diese schönen Stickereien stammen von dem Original jenes Bildes her, das eine Gräfin aus dem Schlosse gemalt hat.«
Sie lenkte mit diesen Worten meine Aufmerksamkeit auf das Bild eines wunderschönen jungen Mädchens. Die ganze Gestalt, ebenfalls in halber Lebensgröße, zeigte in Malerei und Auffassung entschiedene Aehnlichkeit mit dem Bild in meinem Zimmer; der kindliche Ausdruck der blauen Augen, in welche die Malerin ihre ganze Kunst gelegt hatte, war auf einen Edelfalken gerichtet, der, die Flügel zum Fluge gespreizt, den nächsten Augenblick davon flog. Einen ganz leisen Zug wie von Schmerz in den Augen und um den frischen rothen Mund konnte man bemerken, als trauere das schöne Kind, das edle Thier fortzulassen, und doch hielt sie es auf dem ausgestreckten Finger selbst in die freie Luft.
»Ist dieses reizende Mädchen eine Klosterfrau geworden?« rief ich voll Interesse.
»Es hat uns auch oft gewundert,« entgegnete die Försterin, »aber es ist so, sie wird eben auch ihren Grund gehabt haben.«
Wir verabschiedeten uns von dem alten Paare und traten unsern Heimweg an. In Gedanken verloren hörte ich dem Geplauder der Kleinen zu und achtete nicht der wahrhaft niederdrückenden Schwüle des Sommertages. – Mein Wunsch, einzudringen in das Geheimniß jenes Thurmes, zu wissen, wen das Bild vorstellte, das mir von Tag zu Tag theurer wurde, steigerte sich, je unwahrscheinlicher die Erfüllung desselben wurde. Wenn jener schöne Jüngling ein Angehöriger der Familie war, warum hing sein Bild fern von denen seiner Väter, hier herauf verbannt? War es ein verlorner Sohn, an dem das Herz des Vaters, selbst nach dem es ihn verstoßen noch im Geheimen hing? Ich konnte es nicht glauben, aus diesen weichen ernsten Zügen sprach nichts Schlechtes. Und noch lange lehnte ich an jenem Abend aus dem Fenster und schaute sinnend den Blitzen zu, wie sie von allen Seiten am Horizonte aufzuckten. Kein Lüftchen bewegte die Blätter der großen Bäume vor dem Fenster, die sich nach Erfrischung zu sehnen schienen in diesen drückend heißen Tagen. Die Eulen neben an schnauften, als hätten sie Furcht, und deutlicher als sonst hörte ich ihren schweren Flügelschlag in der tiefen, regungslosen Stille.
Ich riß mich endlich los und setzte mich an den alten Schreibtisch; beim Herausziehen eines der vielen kleinen Schiebfächer, das ich heute zufällig zum ersten Mal benützte, um meinen Schmuck hinein zu legen, fiel mir ein klappernder Laut im Raum daneben auf, als bewege sich darin ein harter Gegenstand und stoße klirrend an das Getäfer. Noch ein geheimes Fach! aber wo war die Oeffnung dazu? Ich zog das eine Fach heraus, das meinem in solchen Dingen erfahrnen Auge sogleich als zu klein für den ziemlich großen Raum erschien, und tastete mit den Fingern nach einer innen angebrachten Feder. Da gerieth ich auf eine kleine Unebenheit, ich drückte leicht darauf und ein ziemlich großes Fach fuhr heraus – überrascht, fast erschreckt leuchtete ich hinein und ein Schrei der Verwunderung hallte durch die stille Nacht – denn darinnen lag auf einem vergilbten überschriebenen Papier ein großer altertümlicher Schlüssel! Ihn ergreifen und zu der Thür laufen war ein Moment, mit hörbarem Herzklopfen und fieberhafter Aufregung steckte ich ihn in das Schloß: er paßte! Der Schlüssel war gefunden! sollte, durfte ich öffnen? Nichts ist ansteckender, als Aberglauben – jetzt an der Schwelle meiner Wünsche bebte ich feige vor der Erfüllung derselben zurück, war es nicht Verrath – war es nicht Unheil bringend? aber ich hatte ja Maxens Erlaubniß, war es einmal geschehen und ereignete sich kein Unglück, dann söhnte sich wohl Ernestine auch damit aus, also frisch Muth gefaßt. Mit einiger Kraftanstrengung gelang es mir den Schlüssel zweimal zu drehen, aber jede Anstrengung, die Thür in ihren Fugen zu bewegen, war vergeblich. Schwer aufathmend von der ungewohnten Arbeit, blickte ich ziemlich rathlos auf. Halb drohend, halb spöttisch blickten die dunkeln Augen des Wache haltenden Jünglings herab auf mich. »Laß ab, laß ab, schwaches Weib, und warte bis es einer höhern Macht gefällt, mein Geheimniß zu ergründen.«
So schienen die stolz aufgeworfenen Lippen zu sprechen, und ich unterließ jeden weitern Versuch. Aufgeregt entkleidete ich mich rasch, schloß das Fenster und legte mich ins Bett. Fieberhafte Träume verfolgten mich auch dort. Von Neuem suchte ich die Thüre zu öffnen, langsam ging sie auf, allein als ich über die Schwelle schreiten wollte, sah ich, wie die Pandurenschaar von ihrem Gestelle herabglitt, zu riesenhafter Größe anwuchs und drohend unter heftigem Kanonendonner auf mich zumarschirten; entsetzt suchte ich mich zu verbergen, der Kanonendonner wurde immer lauter, die gräßliche Schaar kam immer näher, da trat der Jüngling mit aufgehobenem Schwert zwischen uns, ein feuriger Schein beleuchtete ihn und ich rief: »Wilmos! Wilmos!« und erwachte. Die Figuren standen ruhig auf ihrem Schrein, das Bild hing stumm an der Wand; aber das Gewitter war ausgebrochen mit voller Gewalt, die alten Fenster erklirrten unter dem fortwährenden Rollen des Donners, der ganze Horizont schien in Flammen, wie zwei feindliche Armeen stieß es auf einander mit verschiedenen nahen und fernen Hülfscorps. Es hielt mich nicht länger im Bett, ich machte Licht und kleidete mich an. Mein Blick fiel auf den Schlüssel im Schloß jener Thüre, sollte jetzt schon eintreffen, was die Leute befürchteten? Alle Elemente waren in Aufruhr, prasselnd schlug Hagel mit Regen vermischt an die Fenster und der Sturm knickte die Bäume im nahen Wald. Angstvoll warf ich mich auf den Betpult vor das Bild des Gekreuzigten.
»Mein Gott,« rief es in mir, »laß finstern Aberglauben nicht Meister bleiben!«
Jesus Maria, was war das? Ein zackiger feuriger Blitz und ein schmetternder Schlag, Krachen. Qualm! Betäubt fiel ich zu Boden ...
Als ich wieder zu mir kam, war die Gewalt des Gewitters gebrochen, der Tag schien durch die Fenster, und unschuldig im Schein der ersten Sonnenstrahlen glänzten an den erfrischten Blättern die Regentropfen, als lächelten sie über den Schrecken der armen Menschenkinder. Wie gelähmt erhob ich mich – Gott sei gelobt, ich konnte stehen, ich sah noch, mich hatte der Blitz verschont, aber wie sah es im Gemache aus! ein erstickender Schwefelgeruch erfüllte es – ich öffnete hastig die Fenster – Gott sei gelobt! nirgends Feuer, alles ruhig, die Vögel zwitscherten als wäre nichts geschehen und brachten dem Höchsten ein jubelndes Dankopfer. Jetzt erst fiel mein Blick auf die Thüre – ich glaubte zu träumen – sie stand weit offen und vor ihr lag von der Wand herab gefallen, wo es seit über hundert Jahren gehangen – das Bild! Das Geheimniß war erschlossen, nicht länger durfte ich zögern, weiter nachzuforschen. Behutsam hob ich es auf und blickte auf die Rückseite. Da stand im Eck klein aber deutlich geschrieben: »Wilmos.« – Lange blickte ich sinnend auf den Namen und stellte das Bild an die Wand. Vor allem mußte ich nach den Kindern sehen. Ich fand die alte Kindsfrau aufgeregt von der fürchterlichen Nacht, aber die Kinder ganz ruhig schlafend. Keines war auch nur ein mal aufgewacht, sie schliefen freilich im entgegengesetzten Thurme. Ich gab Befehl, mich den Morgen nicht zu stören, da ich noch ruhen wolle, und eilte hinauf in mein neu entdecktes Reich. An den Schreibtisch tretend, gewahrte ich das noch geöffnete Fach und nahm die alte Schrift heraus; alle Aufregung war vorüber, mir war, als habe Gott selbst zu mir gesprochen und mir die Erlaubniß gegeben.
Mit Mühe entzifferte ich die mit zitternden Buchstaben geschriebene Schrift, es waren nur wenige Zeilen und lauteten:
»Meine Lebenszeit ist nun bald zu Ende, bald werde ich neben meinem theuern Weibe, dem besten Freunde meines Lebens, im Grabe liegen. Das Geheimniß ihres Lebens habe ich auch nach ihrem Tode selbst vor unsern Söhnen bewahrt, es ruht in dem Thurme den dieser Schlüssel öffnet, dort habe ich alle Einzelheiten, alle Briefe und Schriften, die darauf Bezug haben, gesammelt; es in ein Ganzes zu fügen, alle Glieder vereinend, ist mir nicht mehr gestattet – mein Wunsch ist, es nur als solches, als harmonisches Ganze meinen Nachkommen zu übergeben, und meine Bitte darum an denjenigen meiner Kinder oder Enkel den zuerst ein Zufall dazu führt geht dahin, es nur so dem Familienarchiv zu übergeben.« Gez. Maximilianus Graf von Falkenstein, General, so geschrieben auf seinem Schlosse Falkenburg anno domini 1786.
Also nach beinahe hundert Jahren war ich vom Geschick erlesen, den Schlüssel zu finden; war ich aber auch würdig, die Aufgabe zu erfüllen, die mein Ahnherr an mich richtete? ... Ein Bangen ergriff mich und voll heiliger Scheu kniete ich nieder auf den Betpult, auf dem er sein letztes Gebet gebetet, und flehte um den Segen Gottes und der Heiligen. Gestärkt erhob ich mich und überschritt im hellen Schein der Morgensonne die Schwelle. Ein enger Gang, auf einer Seite mit Schießscharten versehen, öffnete sich vor mir. Alles lag voll abgefallenem Gips und Mörtel, der kalte Blitzstrahl war überall an den Drähten hingefahren, ohne zu zünden; durch den Luftdruck wohl war die durch meine schwache Kraftanstrengung schon etwas locker gewordene Thür aufgesprengt, und die Erschütterung hatte das Bild aus dem Hacken geworfen. So erklärte ich mir es eben, und überlasse nun gelehrteren Menschen, dies anders und richtiger zu erklären. Es war ein kurzer Verbindungsgang zwischen dem äußersten Thurm, der einst wohl als Lugaus gedient haben mochte. Rechts befand sich eine enge Wendeltreppe, die zu einer verschlossenen Thüre führte, offenbar ein früheres Ausfallpförtchen, geradeaus gegenüber der meinigen, befand sich eine Thüre, die dem Druck meiner Hand bald nachgab und mir den Eingang in ein rundes Thurmgemach gestattete. Anfangs konnte ich nichts sehen, da die dicken Läden an den drei Fenstern verschlossen waren. Mit Mühe gelang es mir, sie zu öffnen und dem Gemach das lang vorenthaltne Tageslicht zu gewähren. Scheu flatterten die gestörten Vögel, die schon so lange ihre Nester da gebaut hatten, davon, und eine frischere Luft ersetzte den Modergeruch in dem eingeschlossenen Raume. Vor allem zog meine Aufmerksamkeit ein verhülltes Bild auf sich; erwartungsvoll zog ich an der Schnur des Vorhanges, und sah eine imponirende Frauengestalt vor mir, in der Mode des vorigen Jahrhunderts, doch ohne die geringste Uebertreibung gekleidet. Die Figur war mehr schlank als voll, die schönen, durchaus edlen Züge zeigten eine für eine Frau ungewöhnliche Entschlossenheit, zu den geheimnißvoll dunkeln Augen fühlte man sich unwiderstehlich hingezogen durch den Ausdruck weiblicher Liebe und Hingebung, der darinnen lag. Die Haare waren nur wenig gepudert, und ganz gegen die Mode der damaligen Zeit hingen einzelne schwarze Locken wie zufällig über die hohe Stirne und bedeckten sie theilweise. Das konnte Niemand anders als die Mutter des armen verbannten Wilmos sein; ganz dieselben Züge, nur war hier statt dem tiefen Ernst eine innere Ruhe und Zufriedenheit zu lesen. Eine Tafel unter dem Bild klärte mich sofort über dasselbe auf: Hier war das lang vermißte Porträt, hier in dem geheiligten Sanctuarium hielt es Graf Max verborgen und saß wohl stundenlang davor an dem runden Tisch und schrieb, in ihren Anblick versenkt die Geschichte ihres Lebens, denn hier lag in einer großen Mappe von Schweinshaut ein Stoß Papiere. An der einzigen längeren Wand des Zimmers stand eine einfache Feldbettstatt, auf welcher sorgfältig ausgebreitet auf dem Militärmantel eine Uniform lag, auf welcher einige bedeutende Orden befestigt waren; darüber der Säbel sammt der Chärpe. An der Wand oberhalb des Kopfendes hing ein Kreuz und darunter standen auf einem Papier die Worte: »Hier starb Wilmos von Simonitch im Oktober des Jahres 1759.«
War es derselbe Wilmos? In den Papieren lag wohl die Lösung aller dieser Räthsel. Mit fast ehrfurchtsvoller Scheu öffnete ich die Mappe. Sorgfältig zusammengebunden fanden sich Briefe; auf einem andern Platz verschiedene Tagebücher. Eines mit zierlich gemalter Ueberdecke, wo zwischen Blumen und Arabesken die Worte: »Tagebuch der Gräfin Gabriele« zu lesen war; ein anderes in französischer Sprache, das einen ganzen Stoß Hefte bildete, die mit einem Umschlag verbunden waren, mit der Aufschrift: »Tagebuch der Mademoiselle Beaumont.« Ich fing nun an zu lesen, und las und las und konnte nicht aufhören, auch als die Sonne schon heiß und brennend zu den Fenstern herein schien. Erst das wiederholte Pochen und Rufen an der verschlossenen Thüre meines Zimmers brachte mich wieder auf diese Welt und in mein Jahrhundert. Es waren wohl die Kinder und die Leute, die nicht wußten, was denn aus mir, die sonst so pünktlich war, geworden. Ich rief heraus, sich zu beruhigen, ich käme gleich, verhüllte und verschloß sorgfältig alles wieder, und auf einen Tisch kletternd, hing ich das Bild wieder an seinen Platz – ich kannte es ja jetzt, ich wußte nun, wem mein Wilmos glich, von wem er die tiefen dunkeln Augen mit ihrem unergründlichen Ausdruck, die glänzenden schwarzen Locken geerbt. Fest verschloß ich wieder die Thüre und legte den Schlüssel in sein, in meinen Augen geheiligtes Geheimfach – dann erst öffnete ich und gehörte wieder der Welt. Aengstlich betrachteten mich die Kinder, deren Ungeduld, mir guten Morgen zu sagen, nicht mehr zu zügeln war.
»Wir fürchteten, du seiest krank geworden,« sagte Elsa, während der kleine Albrecht sich auf die andere Seite an meinen Rock hing und still meine Hand streichelte. »Du bist sonst so früh bei uns. Jetzt ist es schon Mittag und du erschienst noch immer nicht.«
»Ich habe durch das furchtbare Gewitter heute Nacht sehr schlecht geschlafen,« beruhigte ich die Kleinen, »heute bleibe ich aber den ganzen Tag vollends bei euch.«
Damit waren sie zufrieden; wir gingen in den Wald, wo selbst der Förster mir klagte, welch' großen Schaden das Gewitter durch Sturm und Blitz angerichtet; einige seiner schönsten Bäume waren vom Blitz getroffen mitten durchgespalten und ein paar junge Bäumchen vom Sturm geknickt. Ich suchte ihn so gut als möglich zu trösten und dankte im Stillen Gott, daß nicht größeres Unglück geschehen war.
Erst in der Nacht suchte ich wieder den Thurm auf und vertiefte mich in die verschiedenen Handschriften. Ja, mit Gottes Hülfe wollte ich es übernehmen das Vermächtniß des alten Grafen, hier in diesem Gemach wollte ich es niederlegen. An diesem Abend kam Max mit Ernestine zurück, sie beriefen mich über mein bleiches Aussehen, was ich ihnen aber weglachte und sie versicherte, mich ganz wohl befunden zu haben. Beide waren sehr vergnügt gewesen und Ernestine in ihrer lieben, kindlichen Weise dankte mir unter zärtlichen Umarmungen, daß ich ihr diese Freude verschafft hatte.
»Du darfst auch so bald nichts vom Fortgehen sprechen, Herzenstante,« sagte sie, wie schon früher, wann ich das Thema berührt hatte, wir lassen dich gar nicht mehr fort.«
Mit Max hatte ich diesen Abend auf meinem Zimmer ein langes und ernstes Gespräch. Den Inhalt der Papiere durfte ich ihm nicht mittheilen, sonst jedoch sagte ich ihm, wie alles kam, und er überzeugte sich selbst, daß eine Bauerei vorerst nicht eile. So gewinnt man Zeit,« sagte er, sich ernst über den vollen Bart streichend, »wenn dann Monate darüber hingegangen sind und sich Ernestine selbst überzeugen kann, daß nichts Entsetzliches geschehen ist, so findet sie sich darein und der Aberglaube stirbt endlich ab aus Mangel an Nahrung. Freilich,« setzte er lachend hinzu, »wenn du des Nachts da herum wanderst, stellen sich die Leute auf den Kopf und kein Mensch will mehr in mein Schloß.« »Dem ist leicht abzuhelfen,« entgegnete ich, »ich hole mir alles heraus, denn das darf nicht sein.« »Was mich am meisten dabei freut,« sagte mein Neffe, mich innig an sich drückend, »ist, daß wir dich nun noch eine Zeit lang gefesselt halten.«
Und so unternahm ich es denn, was ich nicht lassen konnte und fing noch in jener Nacht an, die Arbeit fortzusetzen, die vor beinahe 100 Jahren vorbereitet und begonnen worden.