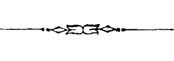|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Seit dem Tode ihres Mannes war das alte getäferte Gemach, in dem ich jetzt wohne, der Gräfin Gisela Sanctuarium; hier in dem großen Himmelsbett schlief sie, hier arbeitete sie stundenlang an dem Schreibtisch, in dem großen, schon damals altersverblichenen Lehnstuhl saß sie und pflog lange Berathungen mit den Beamten, oder mit dem alten Kaplan, frühern Lehrer und Erzieher ihrer Kinder. In dem Eckthurm schlief früher der Kammerdiener, nun die Kammerfrau, das was jetzt zur Küche eingerichtet ist, war ein Raum, wo nach Bedürfniß weitere Dienstboten untergebracht werden konnten, der aber jetzt unbenützt war, und abgeschlossen blieb. Ein kleines Miniaturbild ihres Gemahls aus frühern Zeiten in kostbarer Rahme hing an der verschlossenen Thür des Schreibtisch-Aufsatzes. Der, dessen Bild hier noch in voller Jugendkraft und Schönheit strahlte, war Jahre lang an dieses Zimmer gefesselt, durch Gicht und schwere Kränklichkeit, die er sich in den ersten schlesischen Feldzügen geholt. Obwohl viel älter wie sie, hatte die innigste Liebe sie zusammen verbunden; die Ehrfurcht vor dem ältern Manne hatte ihrer Liebe keinen Eintrag gethan und die leichte Neigung zu Herrschsucht in ihrem Charakter sanft gemäßigt. Sinnend saß sie auch heute in dem Lehnsessel, die einzige Bequemlichkeit, die man sich zu jener Zeit erlaubte. Eine schwarze Wittwenhaube, die sie seit dem Tode ihres Mannes nie mehr abgelegt, bedeckte ihre leicht gepuderten ergrauenden Locken, der lange Flor derselben fiel rückwärts über das schwarze faltige Gewand hinab. Ihre Gestalt war voll und imponirend, nicht groß, machte sie doch den Eindruck, als wäre sie groß, durch das Gebietende ihres Wesens und die Vornehmheit ihrer Erscheinung. Eine Thräne, die in ihren Augen glänzte, milderte die Strenge ihres Ausdruckes. Die Thüre ward leise geöffnet und die Kammerfrau meldete den Herrn Kaplan.
»Er kann eintreten,« erwiederte die Gräfin und ging dem alten Herrn auf halbem Wege entgegen, ihm freundlich Guten Morgen wünschend und ihm selbst einen kleinen Armsessel in ihre Nähe rückend.
»Ich hatte Wichtiges mit Ihnen zu besprechen, lieber geistlicher Herr,« begann sie, »und nun bin ich ganz ergriffen und aus dem Gleichgewicht gebracht durch einen Abschied.«
»Einen Abschied?« entgegnete der Kaplan und sein dreieckiges Hütchen, wie die Weltgeistlichen noch jetzt in vielen Gegenden zu tragen pflegen, neben sich auf einen kleinen Gueridon legend und den Stock mit dem großen goldnen Knopfe bedächtig daran lehnend, zog er eine Schnupftabaksdose hervor und bot sie der Gräfin dar, die jedoch heute dankte, worauf er selbst eine Prise nahm und forschend sprach: »und darf ich fragen, welcher Abschied meine gütige Herrin so aufgeregt hat?«
»Marie Lenig war es,« entgegnete Gräfin Gisela, »die mir ihren Entschluß mittheilte, sich dem Kloster zu widmen und noch heute reisen wird. Wußten Sie davon, Kaplan? Das heitere Mädchen, die Milchschwester meiner Gabriele, die Gespielin meiner Kinder schien mir doch nie zu Schwärmerei geneigt. Ich hatte immer gehofft, sie näher an unsere Familie zu fesseln.« Betroffen blickte der Kaplan auf. »Der junge Verwalter,« fuhr die Gräfin fort, »meinte ich, habe ein Auge auf das schöne Mädchen geworfen, warb er nicht um sie?«
»So viel ich weiß, wies sie ihn zurück,« entgegnete der Kaplan, die buschigen grauen Augenbrauen in die Höhe ziehend.
»Schade,« sagte die Gräfin, »doch vielleicht hat sie das bessere Theil erwählt und findet nun in Ausübung frommer Pflichten Ruhe und Frieden.«
»Ja, Frieden,« brummte der alte Herr in den Bart, »für sich und Andere.« Die Gräfin hatte diese Bemerkung überhört und aus einem der vielen Fächer ihres Schreibtisches ein großes Schreiben mit einem kaiserlichen Siegel hervorgezogen. Es öffnend fing sie in verändertem Tone zu etwas Anderm übergehend an: »Ich habe heute Morgen dieses Handschreiben Ihrer Majestät meiner Allergnädigsten Kaiserin erhalten, welches mich einigermaßen bouleversirt hat. Sie bittet mich in demselben um meine jüngste Tochter Gabriele als Gespielin für ihre zweitälteste Tochter, die jugendliche Erzherzogin Friederike. ›Sie muß,‹ so schreibt die hohe Frau, ›außer den steifen Respektsdamen noch eine Freundin ihres Alters haben, und wer anders dürfte dies sein, als die Tochter meiner eignen Jugendgespielin Gisela.‹ Ehrfurchtsvoll führte die Gräfin die Unterschrift an die Lippen, und den Brief zusammenlegend fuhr sie fort: »Es wird mir schwer, mich von dem theuern Kinde zu trennen, allein es ist jedenfalls nur auf wenige Jahre und die Bitte meiner Kaiserin ist mir Befehl. – Für das Kind selbst ist mir diese Gelegenheit willkommen, daß sie bei berühmten Maestri sich noch mehr ausbilde in Malerei und Musika, zu welchem sie ganz besonders viel Talent zeigt, auch ist es gut, daß sie die Welt etwas mehr kennen lerne. Es ist hier nicht mehr der rege Verkehr wie ehedem; nun auch Marie fort ist, fehlt es an jugendlichem Umgang; in ernstem Studium sitzt sie dann stundenlang an ihrer Staffelei und bei ihrem Clavi cembalo und verfällt leicht unnützer und gefährlicher Schwärmerei.«
»Frau Gräfin vergessen den Cousin Grafen Karl, der mit inniger Liebe an der Cousine hängt und dessen Worten sie, wie mich oft bedünkt, mit munterm Lächeln lauscht.«
»Das ist eben auch ein Grund,« versetzte die Gräfin, »warum mir die Gelegenheit erwünscht kommt. Beide sind noch zu jung, Graf Karl noch Student, noch ein unfertiger Jüngling, Gabriele noch fast ein Kind, das die Liebe noch nicht kennt; beide sollen noch hinaus, ehe sie die unauflöslichen Bande der Ehe verbinden. Ich sprach darüber bereits mit Graf Karl, sein ungestümes Drängen ernst zurückweisend und ihm Schweigen gebietend. So werden wir nun die nächsten Jahre allein zusammen hausen, mein treuer Freund, denn ich bin entschlossen hier zu bleiben, auch wenn, was ich im Stillen fürchte, der Krieg wieder ausbricht. Schon blitzt es da und dort – der preußische Adler regt sich auf's Neue und unsere Kaiserin wird sich von Neuem zu rüsten haben!«
Ernst zustimmend bot der Geistliche die Dose der Dame hin, die dieses Mal eine leichte Prise nahm.
»Was ich durch meine Gegenwart zur Erleichterung des Elendes thun kann,« fuhr sie fort, »das soll nicht versäumt werden durch feiges Weggehen.«
Wieder öffnete sich die Thüre und die Kammerfrau brachte auf einem silbernen Teller einen Brief und bot ihn mit tiefer Verbeugung der Gebieterin hin.
Hastiger, als gewöhnlich, nahm die Gräfin den Brief: »Von meinem Sohn,« sagte sie erfreut ihn öffnend. »Er kommt in Bälde,« rief sie freudig erregt und laut lesend fuhr sie fort, »ehe ich zum ersten Mal seit meiner Mündigkeits-Erklärung das Schloß meiner Väter wieder betrete, gilt es vor allem, Ihnen, theure Mama, einen Entschluß mitzutheilen, der längst im Stillen reif geworden ist und Sie um Ihren mütterlichen Segen zu bitten zu der Wahl, die ich getroffen.«
Die Gräfin hielt inne, ihr Gesicht ward strenge, »Der thörichte Junge,« murmelte sie, » schon getroffen, hatte er sich nicht darüber mit der Mutter zu berathen? nicht jede ist eines Grafen Falkenstein werth.«
Der Kaplan hatte sich erhoben und ging sinnend im Zimmer auf und ab – da tönte ein Schrei aus der Gräfin Mund, kraftlos sanken die Hände, den Brief krampfhaft festhaltend, herab.
»Kaplan,« sagte sie mit matter Stimme, das todtenbleiche Haupt erhebend, »lesen Sie, mir flirrt vor den Augen, ich sah wohl nicht recht, steht da richtig: ›meine Braut Marie Lehnig?‹«
Der Kaplan nahm den Brief: »Es ist so,« erwiederte er, »fassen Sie sich, Gräfin Gisela, Tochter, fassen Sie sich,« wiederholte er dringender, der Gräfin ein Riechfläschchen vorhaltend.
Gewohnt von Jugend auf sich zu beherrschen, faßte sich die in den angewurzelten Vorurtheilen ihres Innersten, ihrem heiligsten Stolz, dem Stolz auf ihren Sohn angegriffene Frau.
»So, mein Sohn,« sprach sie mit dumpfer strenger Stimme, »nun deines Vaters kräftiger Wille nicht mehr da ist, glaubst du an einer schwachen Mutterliebe keinen Widerstand zu finden! du irrst, an der Stelle des Vaters stehe ich hier und eher soll dein und mein Herz brechen, bevor ich zugebe, daß unedles Blut sich vermische mit dem reinen Blute unserer Ahnen!«
»Der Hauptwiderstand ist in dem edlen Mädchen selbst gefunden,« sagte leise festen Tones der Geistliche, »und Sie wissen nun den Grund von Mariens Entschluß, der die Erwiederung ist auf den Antrag des Grafen.« Ueberrascht sah die Gräfin auf.
»Kaplan,« sprach sie streng, »Sie wußten davon, wußten von dieser thörichten Liebe?«
»Ich wußte von den Kämpfen eines unschuldigen Mädchenherzens, erst als dieses derselben gewahr wurde,« entgegnete der Geistliche ernst, »und mir in der heiligen Beichte davon sprach – ich warnte und ward nicht gehört, die Tochter des ›Dieners‹ schien kein gefährliches Spielzeug.«
Lange schwieg die Gräfin, das Haupt vorne über gebeugt, sie erschien um Jahre gealtert. Endlich sprach sie in ruhigem, aber schmerzlichem Tone:
»Sie haben Recht, Kaplan, Sie warnten mich, o ich erinnere mich jetzt dessen, ich aber lachte und sagte, sie sei noch ein Kind, er ein Knabe! – Ja ich, ich selbst bin schuld, wenn nun zwei junge Herzen verwundet sind, wir Alten sind schuld, die nie begreifen können, daß Kinder heranwachsen und aufhören Kinder zu sein – so ließen wir sie gewähren, an dem harmlos kindischen Spiele uns ergötzend, bis der Knabe ein Jüngling, der Jüngling ein Mann wurde, bis das blond gelockte Kind eine Jungfrau ward mit einem so warmen Herzen als das der gleichberechtigsten Gräfin. – Und nun bleibt dies eine Kluft zwischen meinem Max und mir, die nimmer auszufüllen ist.«
»Diese Kluft ist ausgefüllt und geebnet durch Marie, denn von ihr allein geht ja der Widerstand aus.«
»Edles Mädchen, armes, zutodt verwundetes Herz – Gott lohne es dir,« flüsterte leise die Gräfin.
»Verlassen Sie mich jetzt, mein Freund,« fuhr sie nach einer kleinen Pause fort, »ich muß allein sein, allein mit ihm,« sie deutete auf das Bild ihres Gatten, »und mit Gott.« – –
* * *
Währenddessen saßen zwei liebliche junge Gestalten eng verschlungen auf dem kleinen Kanapee in Gräfin Gabrielens eigenem Thurmzimmer, das in jedem Stück seiner zierlichen, mit Elfenbein eingelegten geschnitzten Möbel, den vielen kleinen Porzellanfiguren auf dem feingearbeiteten Schreibtisch, den niedern Armsesselchen mit der vergoldeten Lehne, von seiner jugendlichen Besitzerin zeugte. Sie selbst, eine schlanke, zarte Gestalt mit dem leichten Kleid à la Wateau, in den gepuderten Haaren eine Rose, die sie sich gerade vom Strauch gebrochen und die den frischen Lippen glich in dem zart angehauchten Kindergesicht, schien so recht das Kind des Glückes, das noch keine Täuschung gekannt, an dessen Wiege eine glänzende Fee ihre Gaben ausgestreut hatte. Den schönen, vollen runden Arm, den der weite, spitzenbesetzte Aermel bis über den Ellbogen unverhüllt ließ, um das ernste Mädchen neben ihr schlingend, sagte sie:
»Setze dich noch einmal hierher, wie so oft in früherer Zeit, meine süße Marie; noch kann ich es nicht begreifen, daß du, die muntere Försters-Marie, deren Lachen am hellsten klang unter uns, dich in die Stille eines Klosters begraben willst; es scheint mir ein Traum, und auf einmal komme ich mir vor wie ein rechtes Weltkind, nicht werth, wie du gerufen zu werden zum Dienst der heiligen Jungfrau. Während deine Gedanken auf's Höchste gerichtet sind, denke ich an die Herrlichkeiten Wiens, die mich jetzt erwarten, an unsere hohe Kaiserin und ihre Gnade, denke an meinen guten Vetter Karl, der mir jeden Tag eine andere Ueberraschung bereitet, und frage mit bangem Zweifel, bin ich denn so viel weniger gut und fromm wie du, weil mir's nicht gegeben ist, der Welt zu entsagen? weil ich so glücklich bin bei all dem Glanz und der Freude?«
»Die Wege sind verschieden,« erwiederte ernst und träumerisch Marie, »auf denen uns Gott zu sich zieht – die Einen durch Sonnenschein und milde Lüfte – die Andern durch Sturm und Regen, alle führen sie zum gleichen Ziel, dem Einen dient zum Heil und Frommen, was dem Andern zum Verderben gereichen würde; das Warum dürfen wir Ihn nie fragen.«
»Ach die schöne Kinderzeit,« sagte mit der leichten Art glücklicher Jugend zu etwas anderem überspringend die junge Gräfin, »sie war doch schön, und wenn ich auch Glänzenderes erlebe und mir noch manches Glück zu Theil wird, ich werde sie nie vergessen! wenn wir nach unsern vereinten Lehrstunden wieder in Hof und Garten durften, frei des lästigen Zwanges, als noch Max daheim war, ein wilder Knabe! Weißt du noch, als er einmal von Mama gestraft werden sollte und nicht um Verzeihung bitten wollte, da gingst du zu ihm, du warst noch ein ganz kleines Mädchen, und legtest deine Aermchen um ihn und batest, er solle thun, was die Mama befohlen?«
»Und er ging und that ihren Willen,« flüsterte Marie leise, »und als ich damals in den Schloßteich fiel, da sprang er hinein und holte mich heraus und trug mich herauf; und zu einer andern Zeit, als mein kleines Schwesterchen krank war und ich zu Hause bleiben mußte, da kam er täglich in's Försterhaus und brachte mir Bücher, daß ich der Kleinen die Bilder zeigen sollte, und half mir mit schönen Geschichten sie zerstreuen.«
»Dann kam die traurige Stunde, als er fort mußte in's Theresianum,« fiel Gabriele wieder ein, während Marie in ferne Zeiten starrend mit dem Kopfe nickte, »weißt du noch, wie wir weinten und zu schreiben gelobten – und dann die schönen Ferienzeiten! Karl Nostiz kam mit ihm, und brachte die Ferien hier zu, und wir waren zwei Paare, und wie sehr auch dein Vater grollte und brummte und meinte, du dürfest nicht länger mehr spielen, ich brachte ihn alle mal wieder herum. In jener Zeit war es, daß ich dich bat, mir zum Malen zu sitzen, und ich versprach deinem Vater dein Bild. Er hatte mir damals einmal einen schönen Falken gebracht, den gab ich dir in die Hand und Max stellte sich dir gegenüber, damit du immer in die gleiche Richtung sehen solltest. Mein Meister lobte mich über keines meiner Bilder so sehr, der Edelfalke wollte immer davonfliegen, so kam es, daß er auf dem Bilde die Flügel zum Fluge spreizt. Karl saß hinter mir und war eifersüchtig auf dich, und wir lachten ihn aus.«
»Gräfin Gabriele, hören Sie auf,« bat jetzt Marie und nicht länger vermochte sie die Thränen zurückzuhalten, die über ihre runden blühenden Wangen unaufhaltsam rollten, »ich darf nicht mehr daran denken, in des Klosters Stille und ernsten Pflichten muß ich zu vergessen suchen, daß ich einen glücklichen Traum geträumt!«
Betroffen und bewegt blickte das Kind des Glückes auf die Freundin. »Mußt du denn alles vergessen, was sonnig und hell war?« rief sie, das weinende Mädchen an sich drückend, »o so bleibe, noch kannst du ja zurück, – daß die Reue nicht nachher über dich komme.«
»Nein, nein,« flüsterte fast heftig Marie, »es darf nicht sein, ein heiliges Gelübde bindet mich – ich bin die verlobte Braut Jesu und Er wird mir Kraft geben, es zu halten mit frohem Muth! Leben Sie wohl Gräfin Gabriele – denken Sie, daß hinter Klostermauern jemand betet für Sie und die Ihrigen!«
Fast gewaltsam riß sie sich los und eilte den Schloßberg hinab – fort bis an das Kreuz, wo ihr Vater mit ihrem Reisebündelchen ihrer harrte; noch ein leises Gebet, noch ein Blick hinüber nach dem Schloß und dann sprach sie mit fester Stimme: »Vater, ich bin bereit,« und reichte mit ruhigem Ausdruck ihm die Hand.
»Gerade da ich fort wollte,« sagte der Förster, die heftige Bewegung, die sich seiner bemächtigte, mit Gewalt bekämpfend, »kam ein Diener der Gräfin mit diesem Päckchen und einem letzten Gruß.« Marie öffnete es, es war ein vor wenigen Jahren gemaltes Miniaturbild von ihr und ein Briefchen. Mit steigender Bewegung las sie die wenigen Segens- und Dankesworte einer Mutter, der sie einen bittern Kampf mit dem Sohne erspart hatte. Sie barg den Brief und das Bild, nachdem sie es geküßt – es war ja eine Mutter.
»Wenn du dereinst dieses Bild sammt dem Brief zurückgeschickt bekommst,« sagte sie bewegt, »so hat Gott mich erlöst auf immer von allem Weh dieser Welt.«
Und still schritten jetzt Vater und Tochter dahin zur nächsten Poststation, der Förster selbst wollte sein Kind sicher geleiten auf der weiten Reise, bis er es da untergebracht wußte, von wo er es nimmer wieder holen durfte.