
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Mit fiebernder Ungeduld sah Ludwig der Ankunft Theresas entgegen. Früher wiegte er sich in Sicherheit einer unzweifelhaften Zukunft – sein Arkadien, Martonvásár, stand immer offen. Jetzt konnte er die Stunde nicht erwarten, da er sie endlich sein nennen dürfte.
Der Tag kam, der heiß ersehnte, da der Brunszviksche Reisewagen in den Gutshof der Erdödy hereinrollte.
Dem Wagen entstieg – nicht Theresa, sondern der Bruder, Franz Brunszvik.
Er besprach sich zuerst mit der Gräfin, ehe man Ludwig bitten ließ.
Das Wiedersehen war nicht fröhlich wie sonst.
»Wo ist Theresa?« war Ludwigs erste Frage, und erwartungsvoll mit halb freudig, halb ängstlich gespannter Miene sah er sich um in der Erwartung, daß sie im nächsten Augenblick aus der Nebentür treten würde, wie damals im Wiener Stadtsalon der Gräfin Erdödy. Franz war seinen suchenden Augen gefolgt und schüttelte stumm den Kopf. Er sprach von der Mutter, und daß die Liebenden sich, solange sie lebte, nicht die Hände reichen könnten.
»Oh, es ist schrecklich genug, auf den Tod der Mutter warten zu müssen!« Fassungslos sah ihn der Meister an. »Entsagen? Nein, Bruder und Schwager, nicht so; glaube mir, Theresa blutet das Herz. Nur noch ein wenig Geduld. Mama ist alt und schwach, später ist die Bahn frei für euch. Also standhaft bleiben, ausharren!«
Wie betäubt stand Ludwig da, wie damals angesichts der Brandkatastrophe. Nur das eine Wörtchen »Zu spät!« entringt sich ihm. Es umfaßt unmeßbare Tiefen. Sein ganzes Liebesleid. Wieder stürzte ein Bau zusammen, der Tempel seines Glücks. Arkadien, das geliebte Martonvásár mit seinem Lindenraum und mit der still waltenden Geliebten, der Göttin seiner Träume, versank vor seinen schwimmenden Augen. Es war ihm, als ob das Tor seines ersehnten Paradieses krachend zugeschlagen würde; er stand draußen allein, vor ihm die wüste Erde, der rauhe Pfad, den er zu wandern hatte.
In Sehnsucht und Verlassenheit sucht der Mensch den Himmel. Still setzt sich der Meister wieder hin und arbeitet an seiner Messe. Aber das Herz liegt schwer in der Brust, wie tot.
Schindler hatte nicht unrecht: »Niemals dürfte ein so großes Kunstwerk unter widerwärtigeren Lebensverhältnissen entstanden sein als diese Missa solemnis.«
Sie bedurfte noch Jahre zu ihrer Vollendung. Diese Verschleppung war der Tribut, den er seiner unseligen Liebe für den Neffen zollte. Sie war auch der Tribut für die Versäumnisse seines Herzens, die diese letzte furchtbare Enttäuschung zur Folge gehabt haben.
Erzherzog Rudolf war längst Kardinal geworden.
Unbequeme Fragen, wann die Messe fertig werde, pflegte der Meister mit der unwilligen Bemerkung abzutun:
»Bis der Erzherzog Papst wird!«
Mit der Missa solemnis hat er sich in transzendente Höhen emporgesungen, dahin die Zeitgenossen dem Erdentrückten noch nicht folgen konnten. Die C-Dur-Messe war ein Anfang auf diesem Wege – die Missa solemnis die Erreichung.
Seine Taubheit, seine Einsamkeit, dieser Fluch seines Lebens, enthüllt nun erst seine eigentliche tiefe Segenskraft – der Sinn reiner Tragik will aus der anscheinenden Sinnlosigkeit seines Mißgeschicks plötzlich hervorleuchten:
Dem Meister war es dadurch beschieden, in Sphären hinein zu horchen, die kein leibliches Ohr je vernommen und die nur ihm, dem Lauscher in die Ewigkeit, der mit Geistesohren hörte, erschlossen waren, nachdem sein Gehörsinn den irdischen Klängen taub geworden war.
Er hört nach innen, und die Stille spricht.
Überirdische Musik wird ihm zum Gnadengeschenk.
Das ist die Missa solemnis.
Das ist die neunte Symphonie, die nebenher fast gleichzeitig entsteht.
Die Messe ist sein Bekenntnis vor Gott, sein Dankopfer an den Schöpfer.
Die Neunte ist sein Bekenntnis vor seiner unsterblichen Muse, sein Liebesopfer an Theresa, sein Seelenleben, Beichte und Lebensbeschreibung wie all sein Dichten.
Der Kampf ist ausgekämpft.
Er sucht nicht mehr die irdische Erfüllung seiner Sehnsucht und Herzenswünsche: er sucht das Himmlische.
Er will nicht mehr erinnert sein an seinen verzweiflungsvollen Leidenszustand:
»Oh, nein, etwas Schöneres, Besseres fordere ich!« lautet seine Notiz. Und: »Ha, dieses ist es, es ist gefunden –: Freude, schöner Götterfunken!« Auf dem tiefsten Grund des Leidens ist der Freudenquell aufgebrochen, auf Gottesgrund!
Gott als Schöpfer ist der Freudespender; er ist auch der Urquell der Liebe. Dorthin geht sein Sehnen, dort will er, der Heimgefundene, den Engelschöre umringen im Reich der Seligen, seine unsterbliche Geliebte finden in unlösbarer seliger Vereinigung. Ihr gilt das tiefsinnig verschlungene Freude- und Liebesthema, das schließlich als gewaltigste hochzeitliche Hymne mit trunkener Begeisterung ins Ewige fortjubelt.
Ein Rückblick über das ganze Leben ist diese Neunte, eine Zusammenfassung, eine Klärung. Seelengeschichte, Triumph und Tragik enthüllt sich darin, Leid und Verklärung.
Aus Erinnerungstiefen wird noch einmal der Dämon beschworen, der mit furchtbarer Majestät unter schreienden Dissonanzen erscheint, wie in einer schrecklichen Walpurgisnacht. Unholdinnen sind seine Sendlinge: Sünde, Not, Verführung, Verderben. Dreimal wird die Spukphantastik dieser Beschwörungsszene wiederholt. Alle grausigen Schatten, die überwunden scheinen, stehen nochmals auf, tausend Erinnerungen seines leidvoll tragischen Seelenlebens, die den kämpfenden, leidenden Helden umgarnen und hinabzuziehen suchen.

Aber das Ewig-Weibliche in himmlischer Bedeutung zieht hinan. Die menschliche Sehnsucht bittet den wohlgerüsteten Starken, der als goldener Ritter aufrecht dasteht, daß er sie über den Berg der Sünde und des Verderbens hinwegführe in das Reich der Seligkeit, wo die ferne Geliebte thront. Die Sehnsuchtsmelodie Leonore-Adelaide-Theresa schwebt hoch wie eine weiße Taube über der Sintflut. Sphärenhafte Bläserklänge tönen herüber, Klangstrahlen aus jenem Reich – – – Heilige Stimmung gewinnt Oberhand über irdische Lockung. Hoch ragt der Sinn des goldenen Ritters, weltabgewandter Einsamkeit zugekehrt. Alles, was sich je verheißungsvoll angeboten, wird abgewiesen: der dämonische Gespensterzug des Scherzo, die Zauberbotschaft der Sinnenliebe, Reminiszenzen an Giulietta, an den lockenden Reigen der Holdinnen, die ihn in Scharen umschwärmten – die Baßrezitative wie die Stimmen des innersten Gewissens erheben immer Einspruch dagegen; höher, höher steigt die Sehnsucht, empor zur Unsterblichen im jauchzenden Dithyrambus an der Schwelle der Unendlichkeit, wo Engelschöre und der Sang der Seligen die Vereinigten umschweben in der ewigen Liebesfeier, die alle Menschheit mit ihrem Glück umfassen möchte: »Seid umschlungen, Millionen«, und: »Diesen Kuß der ganzen Welt!«
Aus der Versenkung, in die ihn für viele Jahre die schlechte Zeit, Krankheit, Prozesse, die Vormundschaftssorgen und ähnliche Dinge haben verschwinden lassen, so daß man sich kaum seiner allerdings oft wechselnden Adresse erinnert, taucht der alternde Meister in neuer Glorie wieder auf; die Mitwelt lernt den verklärten Beethoven nun in seiner dritten Schaffensepoche kennen, nachdem sie seine erste fröhliche Zeit bis zum Septett und seine tragische Periode vom Heiligenstädter Testament an miterlebt hatte. – – –
Ein Kind ist es, das ihn aus Vergessen und Einsamkeit wieder herausführt.
So steht es eines Tages vor ihm, eine liebliche halbwüchsige Mädchenerscheinung, mit einem Blumenstrauß in der Hand. Die Verkörperung der holdseligen Jugend, ein Märchenbild, geträumt von einem idealen Jüngling, der die blaue Blume sucht und sie in dieser Gestalt findet als Frau Poesie und als seine Braut.
Ludwig ist eigentümlich berührt; ein Nachklang ferner Zeit, ach, wie weit! Allerhand Erinnerungen drängen sich auf: die neun musenhaften Frauenwesen, die er in seinem Leben liebend gekannt hat, und die sich in der einen Fernen vereinigen, der Unsterblichen! Und diese hier könnte in verjüngter Gestalt sie alle verkörpern.
»Meister, ich habe mein Debüt als Opernsängerin und mir für mein erstes Auftreten eine Rolle gewählt: Leonore! Einige Benefizianten der Oper wollen das Werk für ihren Abend geben – ich möchte in dieser Aufführung die Leonore singen! Bitte, Meister, bitte inständig!«
So süß kann dieses Kind flehen, daß es schwer ist, nein zu sagen.
Er möchte die Kleine nicht betrüben und wendet nur sein Bedenken ein: »Aber Sie sind noch ein Kind – die Partie ist viel zu schwer für Sie!«
Er sieht nur den umflorten Blick, die tiefe Wehmut, die plötzlich das reine Antlitz umschleiert, ihr kindliches Bitten.
»Ja, wer sind Sie denn?«
»Die Burgschauspielerin Wilhelmine Schröder.«
Richtig ja! Er hat schon von der jugendlichen Künstlerin gehört.
»Ja, können Sie denn singen?«
»Nein. Ich denke mir halt, daß ich es probiere. Ich möchte für mein Leben gern zur Oper. Das heißt, gesungen habe ich immer, nur für mich. Es ist halt meine Leidenschaft!«
Das ist jedenfalls neu und eigenartig.
»Nun denn! Probieren können wir ja!«
Er kramt in den Noten, den Klavierauszug zu suchen, aber sie ist flink:
»Bitte, die Noten hab' ich schon mitgebracht!«
»Gut.« Er setzt sich ans Klavier und schlägt gleich die schwierige Partie auf vor dem Duett mit Florestan.
Er kann dem Gesang nur mit der Phantasie folgen: aber welcher Ausdruck, welches Feuer, welche Leidenschaft! Das Kind ist nicht Kind – das Weib erwacht plötzlich vor ihm.
»Sapperment! Das war gut!«
Und jetzt der Aufschrei.
»Himmel, welch ein Schrei!«
O Wunder, er hat den Schrei gehört! Dieser furchtbare leidenschaftliche Aufschrei hat selbst die eherne Pforte seiner Taubheit gesprengt, welches Labsal! Der menschliche Ton ist an sein inneres Ohr gedrungen! O welche Seligkeit über ihm! So muß es dem armen Florestan in seinem unterirdischen Kerker gegangen sein, als die geliebte Stimme seines Weibes ihn rief und Erlösung winkte!
In des Meisters Herz ist der Ton gedrungen.
Leonore, seine Leonore ist gefunden! Er springt auf, und in maßloser Freude umarmt er die Kleine, die wieder bescheiden und verschämt vor ihm steht, eine zarte Mädchenblüte, die es willenlos geschehen läßt, daß er einen Kuß auf ihre Stirn drückt.
»Meine Leonore!«
Sie hat den wahren Charakter der Rolle erfaßt: die erste dramatische Sängerin ist erstanden, das Urbild aller Leonoren!
Das Urbild aller jener Frauengestalten, die der Meister im Leben gekannt und geliebt hat. Sie war Dichtung geworden in jener Leonorenoper, und die Dichtung nahm Fleisch und Blut an: Leben und Erfüllung geworden, steht sie nun leibhaft vor ihm.
Kaum ist Wilhelmine Schröder fort, überfällt es den Meister mit Schmerzensgewalt. Alles, was ihm das Leben versagt hat und wonach er sich so heftig sehnte, so daß es schließlich Dichtung wurde, hat sich in diesem Mädchen gleichsam zu einem Symbol verdichtet mit der Mahnung:
»Zu spät! Zu spät!«
Wie zum Hohn besuchte ihn das Glück als Sinnbild dessen, was er im Leben vergeblich ersehnt.
»Ah, mein Dämon – was verfolgst du mich!«
In Tränenfluten löst sich der namenlose Schmerz. Jetzt erst weint er über sein Mißgeschick, über sich, über Theresa, über die Unsterbliche. Der Anblick des Mädchens hatte ihn an sie erinnert, an die holde Lenzzeit der ersten Begegnung mit ihren Blütenträumen, und darum hatte es ihn jetzt so machtvoll ergriffen. Mit diesem innigen Gedenken an Theresa.
Ihr Hoheitsbild neigt sich aus unerreichbaren Fernen liebend über ihn – ihr sanfter Geist umschwebt ihn: in seiner Neunten feiert er die selige Vereinigung mit ihr, zu spät für dieses irdische, vergängliche Leben, nie zu spät für jene höhere Welt dort, in der Liebe grenzenlosem Reich – – – In Tönen hat er zu ihr hingefunden, in Tönen feiert seine Liebe ihr Hochzeitsfest, in Tönen hat er das Paradies seines Glückes verewigt und der Unsterblichen einen Thron errichtet, der über unvergänglichen Sphären schwebt.
Nun soll auch die Welt erfahren – nicht von seinem Seelenleid, das er in sich verschließt, sondern von seinem Schaffensglück, das daraus geboren ist und seine Tränen verwandelt in strahlende Kleinodien und Edelsteine, damit er angetan ist wie mit einem Gewand von Herrlichkeit und mit einer leuchtenden Krone, deren Rubinglanz es nicht mehr anzumerken ist, daß sie eine Dornenkrone war.
In dieser Gloriole wollte der vergessene Meister wieder erstehen wie damals am Kongreß vor einem Fürstenparkett; nein größer, höher noch, ohne Seitenblick auf diese Welt, das Antlitz dem Ewigen zugekehrt, davon seine Missa solemnis, seine Neunte ein Widerklang sind, ein Tongemälde seiner unendlichen Heimat, seines himmlischen Arkadiens, seiner unsterblichen Geliebten.
Die egozentrische Welt, die seine Kanonadenmusik einst bejubelte, scheint aber vor der hohen Musik, die dem entgegengesetzten, transzendenten Pol angehört, versagen zu wollen. Die Missa solemnis wird in Subskriptionsexemplaren den europäischen Höfen vorgelegt, das Widmungsexemplar zu fünfzig Dukaten. Der König von Preußen schickt zwar einen Brillantring statt des erhofften Ordens, und Ludwig XVIII. von Frankreich eine goldene Medaille; aber sonst haben die regierenden Häupter, die ihm auf dem Kongreß die Cour machten, ein schwaches Gedächtnis. Das Erträgnis deckt kaum die Kosten der Kopiatur. Goethe, dem der Meister einen demütigen Brief geschrieben hat, darin er auf seine Krankheit und seine Vaterpflichten hinweist, antwortet nicht; der Weimarer Hof hat nicht subskribiert.
Auch mit der Aufführung der beiden großen Werke steht es fragwürdig. Auf Wien ist der Meister schlecht zu sprechen; daß man hier des Großen, der hier lebt, so ganz vergessen konnte, hat ihn am meisten gekränkt.
»In Berlin soll die Erstaufführung stattfinden!«
Über diesen Entschluß sind die Freunde außer sich.
Eine Huldigungsadresse mit vielen Unterschriften wird ins Werk gesetzt, den Meister umzustimmen. Man rührt sich jetzt, ein wenig spät zwar und auch nur aus Eifersucht; Berlin soll nicht den Vorzug haben.
Der Meister zögert noch; halb stimmt er zu, halb lehnt er ab; zum Schluß droht die Sache doch zu scheitern.
Franz Brunszvik ist zufällig in Wien und wird von den Intimen ins Vertrauen gezogen. Er möge doch seinen Einfluß auf den Genius aufbieten.
Es gibt nur einen Menschen, der Ludwig bewegen könnte: Theresa! Darauf baut Franz seine diplomatische Mission bei dem Freund und Bruder, der doch Schwager in spe ist!
Das Zauberwort hat gewirkt.
»Theresa?! Natürlich findet die Akademie statt!« entscheidet der Meister, nachdem er eben vorher energisch dagegen war; »wem könnte,« so denkt er, »die Missa solemnis als Krönungsmesse unserer himmlischen Vermählung und besonders die Neunte als unsere himmlische Hochzeitsmusik denn sonst gelten als ihr?!«
Nun wird das Werk mit Feuereifer in Szene gesetzt, darin Ludwig seiner Unsterblichen den höchsten Thron der Verklärung erbaut hatte, sakrale Musik, ein Himmelsdom dieser einzigen Liebe, für die die Welt nicht Raum hat, und die weit über die Sterne reicht.
Alles freut sich darauf: »Es wird herrlich gehen!«
Das Haus ist dicht gefüllt am 7. Mai. Man ist gespannt auf die »interessante Persönlichkeit« – deren Unnahbarkeit sprichwörtlich ist. In Wien ist man auch in der Kunst immer auf die Person neugierig, um so mehr, je weniger man sich aus ihr machen kann. Der Meister ist bereits zur Legende geworden, und das gibt immer Relief. Man munkelt dies und das über den tauben, finster blickenden Musiker; das Seltsame wie das Seltene ist stets begehrt. Jedenfalls gibt es eine Sensation.
Knapp vor Beginn nimmt eine dicht verschleierte große Dame im Hintergrund einer Loge Platz, wo sie von niemandem gesehen wird. Theresa. Sie ist einige Stunden vorher in Wien angekommen.
Der Meister erscheint am Dirigentenpult, vom Beifallslärm begrüßt, hinter ihm Kapellmeister Umlauf. Die Ovation nimmt kein Ende – der Meister steht am Pult mit dem Rücken gegen das Publikum, er hört das Toben nicht; die Raserei nimmt zu, bis endlich der Polizeimeister abwinkt.
»Mein Gott! Wie ist der liebe gute Ludwig gealtert! Das Haar ergraut, die Züge gramvoll gefurcht!«
Auf Martonvásár lebt sein Bildnis in unverwelkbarer Frische und Idealität fort, und so in ihrem Herzen; die Liebe kennt kein Altern. Nur die Wirklichkeit zeigt jetzt mit grausamer Deutlichkeit, daß die Zeit nicht spurlos vorübergeht.
Tiefe Wehmut beschleicht die Gräfin; sie hat sich vor diesem Augenblick fast gefürchtet.
Sie geht seltsame Gedankenwege. Sie empfindet plötzlich, daß auch sie nicht mehr im Rosenhauch der Jugend steht und dem Bild nicht voll entspricht, das der Meister von ihr besitzt und verehrt. Sie ist nicht eitel; aber sie will ewig schön und ewig jung in seinen Augen bleiben, ein unzerstörbar Ideal – wie schrecklich, wenn er durch die Wirklichkeit, durch das Altern und das Abblühen aus der Illusion gestürzt und an das Allzuvergängliche des Lebens erinnert würde. – – –
»Dann wäre es besser, sich nicht zu sehen! Nur im Geiste leben die Ideale in unverminderter Jugendschöne fort!«
Unter der sphärenhaften Wirkung der Musik ist diese Empfindsamkeit gewichen. Und sie erkennt in dieser verklärenden Musik das Urbild der idealen Himmelsliebe, gegen das alle Wirklichkeit verblaßt. Sie erkennt ihre Züge, wie sie der Meister als seine unsterbliche Muse anschaut – kein Wirklichkeitsbild kann neben dieser übersinnlichen Schönheit bestehen.
Die Klänge sind verrauscht, man war in eine andere, wunderbare, kaum geahnte Welt erhoben und findet sich nur schwer zurück.
Ein Orkan von Beifall reißt die Sinne wieder aus ihrer Entrücktheit herab in diese Welt des Scheins.
Aber nicht ihn, den Meister!
Er hört den Lärm nicht und bleibt mit dem Rücken gegen das Publikum gewandt.
Das Orchester schweigt, der Meister dirigiert weiter vor einem unsichtbaren Musikerchor!
Er hatte längst die Fühlung mit dem Musikapparat verloren, den Umlauf heimlich ans Ziel geführt hat – ratlos, entsetzt sehen die Spieler auf den Meister hin, der einen Geisterchor mit dem Taktstock befehligt, von Harmonien umrauscht, die kein irdisches Ohr hört und die nur er vernimmt.
Atemlose Stille tritt ein nach dem ersten Beifallssturm; eine Stille der Ergriffenheit und der Tränen – –
Verwundert schaut der Meister auf und sieht, daß die Instrumente in den Händen ruhen; diesen Augenblick erfaßt die Sängerin Karoline Unger und dreht den Meister nach dem Publikum um, das nun mit verdoppelter Gewalt in Beifallsfreude ausbricht. Und wären es Donnergewalten, der Meister hört sie nicht!
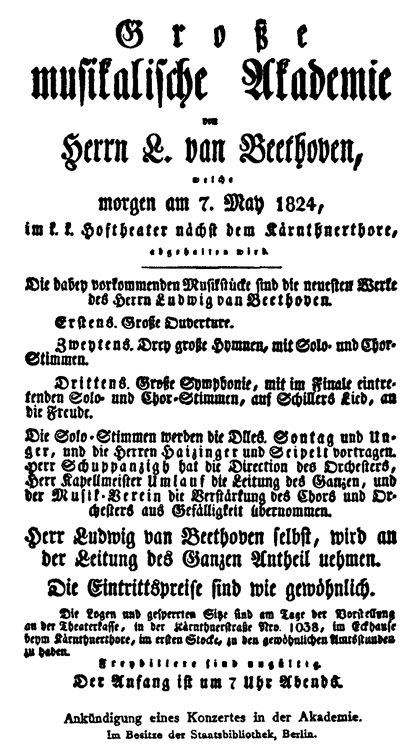
Ankündigung eines Konzertes in der Akademie. Im Besitze der Staatsbibliothek, Berlin.
Die Tragik des tauben Meisters stand an diesem ergreifenden Schluß so deutlich vor aller Augen, daß es wie eine heftige Gemütserschütterung durch das ganze Haus ging.
Er sieht das Tücher- und Hüteschwenken und lächelt; aber dieses Lächeln schneidet ins Herz und entlockt noch mehr der Tränen.
Eine Menschenwoge brandet zu dem Meister empor, als wollten sie ihn in der Raserei des Jubels und Schmerzes hinwegheben. Alle drängen sich hinzu und wollen etwas sagen: vergebens – er hört sie nicht!
Schindler und die anderen Freunde müssen einen Wall um ihn bilden und retten ihn endlich in das Künstlerzimmer, wo nur die Intimsten Einlaß finden.
Eine Gestalt hat ihren Platz verlassen und strebt, bebend vor Schluchzen, dem Ausgang zu: Theresa. Ihn jetzt zu sehen und ihm ihre Tränen zu zeigen – unmöglich! Aufgelöst in Schmerz und weher Seligkeit, wäre sie schluchzend keines Wortes fähig. Nur fort, fort!
Schuppanzigh und Umlauf bringen den Meister heim und warten noch die Ankunft Schindlers ab, der den Kassenrapport bringen soll. Ludwig hat alle drei Helfer zu einer kleinen Nachfeier, einem Frühstück im Prater, das in den nächsten Tagen stattfinden soll, eingeladen.
Endlich kommt Schindler. Aber ach! ein allzu bitterer Tropfen in den vollen Becher der Freude! Der Kassenrapport weist einen so geringen Überschuß aus, daß der Arme aus allen Himmeln der Erwartung stürzt. Er hatte eine hohe Einnahme erwartet; das Konzert sollte ihn auf lange Zeit aller Sorgen entheben, die er sich Karls wegen macht, und für viele still ertragene Entbehrungen entschädigen. Und gerade diese Hoffnung ist zerronnen.
Wie vernichtet ist der erschöpfte Meister zusammengebrochen.
Man mußte ihn auf das Sofa bringen. Dort blieb er lautlos liegen, ohne Speise und Trank zu verlangen. Spät nachts gingen die Freunde weg, als sie sahen, daß er über seinen Schmerz und Kummer fest eingeschlafen war.
Am anderen Morgen fanden ihn seine Dienstleute noch in Konzerttoilette auf derselben Stelle.
Unterdessen weilte Theresa zu Besuch bei der Vertrauten ihres Herzens, der Gräfin Erdödy, die infolge ihres Fußleidens verhindert war, an dem Ehrentag Ludwigs teilzunehmen, und sich den schmerzlichen Triumph des Meisters von der Freundin erzählen ließ.
»Ist es wahr, daß seine Musik infolge seiner vollständigen Gehörlosigkeit gelitten hat und unverständlich geworden ist«, wollte die Erdödy wissen.
»Das ist gewiß nicht wahr, und ich bin glücklich darüber«, erklärte ihr Theresa. »Im Fortschreiten seines Geistes ist seine Musik übersinnlich geworden; sie hat den höchsten Grad der Verklärung erreicht und lebt schon in jenseitigen Gefilden, in ewiger Glorie, die durch diese beiden Werke hindurchstrahlt wie durch ein Transparent. Allerdings glauben manche, ich habe es auch schon gehört, für das, was sie nicht verstehen, seinen Gehörmangel und sein entschwindendes Tongedächtnis verantwortlich machen zu müssen; in der Tat aber sind gerade diese Werke ein Beweis, daß sein Tonsinn und seine Vorstellungskraft eine Feinheit und Schärfe erlangt hat, die über alles hinausreicht, was der menschliche Genius bisher errungen hat. Er ist in Sphären vorgedrungen, wohin ihm der Verstand mit allen seinen bisherigen Erfahrungen nicht folgen kann. Er ist ein auserwähltes Werkzeug Gottes geworden; ihm hat der Himmel seine Gnadenfülle erschlossen, um ihn desto reicher für alle Entbehrungen des Daseins zu entschädigen, und ich fühle mich darüber wunderbar getröstet. Ihm folgen zu dürfen und Seele in Seele mit ihm in jenem Reiche einzuziehen, das er prophetisch unserem ahnenden Sinn erschlossen hat, ist wahrhaft ein hohes, unsagbares Glück und eine Auserwählung, die über alles erhaben ist, was das Leben an gewöhnlichen Freuden bieten kann. Was können denn wir beide, er und ich, vom Leben noch erwarten? Wir sind alt geworden – – – Und wenn du einmal hörst, daß ich den Schleier genommen, oder mich in strengster Zurückgezogenheit einer betrachtenden Lebensweise gewidmet habe, so denke, daß es nur ein Schritt ist, näher unserem gemeinsamen großen Ziel, und daß es der Brautschleier ist, der mir diesseits versagt war – –«
»Ihr seid doch das seltsamste Liebespaar, das je auf Erden war«, rief die Freundin. »Hast du denn schon abgeschlossen mit dem Leben?«
Die Freundin klopfte mit dieser Frage vorsichtig auf den Busch. Sie wollte Näheres über das eigentliche Geheimnis Theresas wissen und scheute sich, direkt zu fragen, wie es innerlich um die beiden zueinander stehe.
Theresa erwiderte ausweichend.
»Nichts erwarten, nichts verlangen! Irdische Wünsche müssen fortan schweigen. Resignation ist unser Los. Doch bleibt alles, wie es war. Die Zeit kann unserem Ideal nichts anhaben. Wir altern, unsere Liebe nicht, die sich den Himmel verdient, die Ewigkeit und darum die Vereinigung um so sicherer erhofft. Seine Musik hat mir diese Zuversicht gegeben. Ich habe sie verstanden – es war eine Botschaft seiner Seele an meine Seele!«
»Nun, was das Altern betrifft, so straft dein Aussehen deine Worte Lügen!«
»Gestern abend bei der Aufführung habe ich plötzlich erkannt, daß ich alt geworden bin, und heute früh hat mir's der Spiegel bestätigt«, sagte Theresa mit einem Anflug von Trauer.
»Ach, der Spiegel lügt – – –«
»Nein«, erwiderte Theresa bewegt, »der Spiegel, in den ich gestern blickte, lügt nicht. Der Spiegel war Ludwig, sein Gesicht! Es war erschütternd – – –« Ihre Stimme zitterte; sie mußte innehalten, um Tränen zu bekämpfen; dann fügte sie hinzu: »Wie kann ich glauben, daß ich selbst jung geblieben bin – – –«
»Nun aber, das ist doch etwas anderes«, bemerkte die Erdödy; »Er – hat sehr gelitten; seine Krankheiten, dann der Kummer, den ihm sein Neffe bereitet, der ein Lumperl geworden sein soll; ich habe Ludwig schon lange nicht gesehen; es ist ja so schwer mit ihm, seine völlige Taubheit macht jede Unterhaltung mit ihm fast unmöglich; man kann nur schriftlich mit ihm verkehren, durch Zettel oder durch sein unförmliches Konversationsbuch, das er einem mit der traurigsten Miene von der Welt hinlegt – – Das macht einem einen tieferen Gedankenaustausch wirklich schwer – – Ein Glück für ihn, daß er sein Faktotum Schindler hat, den er übrigens schlecht behandelt und dem er mißtraut – er hätte einen weiblichen Schindler gebraucht, aber das hat sich nicht gefunden, zu seinem Unglück. Schindler ist übrigens wirklich rührend in seiner unbedingten Anhänglichkeit und Treue. Es scheint, er möchte in der Ewigkeit einen Ehrenplatz neben dem Meister haben; jedenfalls ist er auf dieser Welt sein Schutzengel.«
Wie Messer fuhren diese unabsichtlichen Worte der Freundin in Theresas Herz. Hinter jedem der Sätze erhob sich riesenhaft der Vorwurf, daß sie versäumt hatte, dem Geliebten das zu sein, wozu sie nicht nur im Reich der Muse, sondern auch im Leben berufen war.
Erstaunt, erschrocken, hielt die Erdödy inne, als sie das heimliche Schluchzen bemerkte, das Theresa verbergen wollte, indem sie ihr Tüchlein an das Gesicht und an den Mund preßte und mit den Zähnen krampfhaft daran riß.
Ganz bestürzt zog die Gräfin die Weinende an sich und versuchte, sie zu trösten.
»Stand es denn in deiner Macht, anders zu handeln, du törichtes Kind?« schalt sie liebevoll. »Bist du ihm nicht mehr gewesen, indem du ihm ein Ideal geblieben bist, an dem seine Kunst höher und höher wuchs über alles Vergängliche hinaus? Unendlich mehr hast du ihm damit gegeben, als wenn du im gewöhnlichen Sinne seine Helferin und Dienerin geworden wärst. Du hättest ja doch nichts ändern können an seinem traurigen Geschick! – ihr hättet beide nicht gewonnen, sondern nur verloren. Bei seinem galligen Temperament wäre im zermürbenden Kleinkrieg des Alltags auch die ideale Liebe zerrieben worden und damit auch das reine Bild, das du ihm als Muse für seine Kunst geworden bist. Er, gerade er braucht diesen Aufblick zu einem hohen, unerreichbaren Ideal, das seine Kraft und Sehnsucht emporzieht; in dem heiligen Feuer dieser fast überirdischen Liebe hat sich sein Geist und seine Seele geläutert, von den Schlacken befreit und verklärt, und wer weiß, ob ihm das Höchste gelungen wäre, ohne sein Leiden, zu dem auch diese einzigartige Künstlerliebe gehört. So blieb wenigstens diese Liebe über allem Erdenschmutz – wahrhaftig ein glückliches Leid! Die Vorsehung hat es gut mit euch gemeint, besser als wir Menschen mit unseren kurzsichtigen, allzu kleinen Wünschen es ahnen. Der Himmel schenkt Gnaden, auch in dem, was er versagt, und dann oft am meisten – – – .«
Sie war eine liebe Trösterin, die gute Erdödy, und schließlich mußte man glauben, daß alles Unglück und Mißgeschick – ein Glück war.
»Ich wußte nicht, daß das Glück so aussieht«, sagte Theresa einigermaßen wieder gefaßt; »wenn ich denke, wieviel Tränen ich darum schon geweint habe, dann möchte ich es alles andere eher nennen.«
Vor einer Stunde noch hatte sie dem Gedanken an ein Wiedersehen mit dem Meister keinen Raum gegeben; seit gestern abend stand der Entschluß fest, eine persönliche Begegnung zu vermeiden, die für beide nur schmerzlich sein könne.
Jetzt dachte sie anders darüber. War es nicht eine mattherzige Ausflucht gewesen und die Sorge um ihr eigenes Ich, daß sie der Peinlichkeit eines solchen Wiedersehens ausweichen wollte? Fort war das Gefühl von Kleinlichkeit – sie schämte sich nun solcher Empfindelei – vielmehr: wie wehe müßte es dem vereinsamten Geliebten tun, wenn sie fortginge, ohne ihn mit ihrem Besuch beglückt und getröstet zu haben. Mitleidige Liebe überwand alle Bedenken – ein glühendes Verlangen wurde mächtig, sofort zu ihm zu eilen und das teure Haupt zu umfangen. Was bedurfte es dazu der Worte, denen sein Ohr verschlossen war? Liebe spricht zum Herzen – dieser Sprache war er nicht taub!
Theresa erhob sich. Sie brannte vor Ungeduld und fühlte mit einem Male die Jugend der ersten Liebe, wie in jenen frühen kindischen Tagen.
Ein Kurier sauste in den Hof und verlangte die Gräfin Brunszvik sogleich zu sprechen.
»Komtesse belieben gnädigst sofort nach Martonvásár heimzukehren; der gnädigsten Frau Mama ist nach dero Abreise sehr schlecht geworden; das Schlimmste steht zu befürchten – – – der Wagen wartet unten, ich soll Komtesse unverzüglich heimbringen, damit es nicht zu spät ist.«
Theresa wurde zur Bildsäule.
»Gut,« sagte sie ruhig, »wir reisen sofort.«
Und dann zur Freundin, indem sie die Hand an die Brust preßte:
»Also werde ich diesmal Ludwig doch nicht sehen. Indessen: die Bahn wird frei! Schmerzlich zwar, aber ich darf sagen: ich habe meine Pflicht bis zur völligen Selbstentäußerung getan. Jetzt gehöre ich wieder mir. Und darf an Pflichten denken, die mir nicht weniger heilig waren, und die ich versäumen mußte – – – ich denke, sie gut zu machen, wenn es dem Himmel gefällt, der nun wieder anders lenkt, als wir denken mochten.«
Die Freundin faßte Theresa an beiden Händen.
»Laß mich nun offen reden als erfahrene Frau, bevor wir uns trennen. Du weißt, wie ich dich liebe und ihn, euch beide, und wie sehr ich euer Glück wünschte. Und weil ich es wünsche, so bitte ich dich heute: tu's nicht! Die Zeit ist vorbei – vielleicht war's gut so, wie ich vorhin schon sagte – – – Und nun reise gut und leb' wohl! Ich gedenke eurer guten Mama und bin somit bei euch in Trauer und Liebe!«
Schmerz lag wieder in den Zügen Theresas, und diese schmerzliche Schönheit, die ihr gewohnter Ausdruck war, das wundersam Rührende, Ergreifende, fast ebenso ergreifend wie die stille Trauer in dem tragischen Antlitz des Meisters:
»Seltsam, die Ähnlichkeit der beiden, bei aller sonstigen Gegensätzlichkeit, ein tragisches Liebespaar«, mußte die Erdödy denken, als Theresa fort war; das Herz tat ihr wehe; sie litt um beide, während sie im stillen Rückerinnern Bild um Bild vorüberziehen ließ, wie alles geschehen war und kommen mußte, wie es gekommen ist. Zwei ideale Menschen, die nicht zueinander kommen konnten trotz alles Ringens: »Ach, man ahnt ja gar nicht, welche Macht die Konvention ist!« Nun wollte ihr im Vergleich mit der Tragik dieser Edlen ihr eigenes Leid: das Unglück der eigenen Ehe, der Tod eines geliebten Kindes, im milderen Lichte erscheinen.
»Wer Trost sucht, blicke in fremdes Leid!«
In diesem Gedanken ahnte sie plötzlich den tiefen Sinn eines solchen Schicksals. Und dahinter leuchtete ein Ursinn auf.
»Ja, ja,« seufzte sie, »es ist ein Kreuz! Jeder muß seines tragen. Aber der das größte getragen hat, der hat den meisten Trost gegeben!«
*
Nach wenigen Wochen kam die Nachricht, daß die alte Gräfin das Zeitliche gesegnet hatte.
Nun war die Bahn wirklich frei.
Doch da stand zunächst die totenstille Zeit des Trauerjahres auf Martonvásár, in der alle Wünsche schlafen gehen.
Und da stand noch manches andere.
War die Bahn wirklich frei?
Da stand ein graues Gespenst: Alter und Krankheit. Resignation und Verzicht.
Ludwig schrieb nach Martonvásár in jener trüben Zeit:
»Ich bin elend und krank, mehr als je nach den aufreibenden Tagen seit meiner großen Akademie, wo ich vergebens wartete, daß du kommen würdest. Ein Dämon hat mein Leben zerstört. Wie glücklich hätten wir sein können! Hatten wir zuwenig Vertrauen in unser Glück? Ich weiß es nicht. Aber könnte unser Glück je größer sein, als es wirklich ist im Hinblick auf unsere Liebe, die im Ewigen begründet ist? Ich fühle mich heute nur als Asche; ja, Asche bin ich geworden durch meinen traurigen Zustand, und nichts als Asche könnte ich dir sein! Du wärest enttäuscht – und diese Enttäuschung wäre erst mein Ende, das Ende des einzigen Glücks, das mir unzerstört geblieben ist. Denke an Adelaide und denke dich dabei! Wie eine Blume entblüht das Wunder der Asche meines Herzens, und auf jedem Purpurblättchen schimmert dein Name, Adelaide – Theresa! So bleibe es, Geliebte; in Ewigkeit mein!«
Nach dem Zusammenbruch am Abend nach der Aufführung seiner Neunten fühlte sich der Meister schier am Ende. Der Verfall bedrohte sein sichtbar schwaches Lebenshaus.