
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Kartätschenschüsse fallen, daß Türen und Fenster klirren und Mauern zittern. Eine Schreckenszeit beginnt. Mitten in den Kriegslärm dringt die Kunde: der alte Papa Haydn tot. Französische Ehrenwachen und Offiziere begleiten den Sarg; der Verblichene wird nach Eisenstadt, der Stätte seines vieljährigen Wirkens überführt.
Mit ihm hat die alte Zeit Abschied genommen. Unter Kanonendonner wird eine neue Epoche eingeleitet. Die Wende ist da. Die Palastpforten schließen sich, der musikalische Himmel verstummt. Kriegsnot und alle folgenden Übel verscheuchen die Musen. Sie fliehen weinend von den verödeten Stätten und verlassenen Altären. Nur ein einsamer Stern leuchtet durch das finstere Gewölk: der Name Beethoven.
Die Zeit des Bombardements hat er mit Bruder Karl im Keller eines Hauses in der Rauhensteingasse verbracht. Er wohnt nicht mehr im Pasqualatischen Haus auf der Mölkerbastei. Zmeskall hat ihm in der unmittelbaren Nachbarschaft eine Wohnung verschafft, im sogenannten »Klepperstall«. Auch hier verbleibt er nur kurze Zeit. Er sehnt sich fort, aber aus Wien ist nicht hinauszukommen. Man ist von aller Welt abgeschnitten.
Seine Stimmung ist wirklich nicht rosig. Er hält seine Existenz für gefährdet. Das aristokratische Zeitalter, dessen Ausklang er mitgefeiert hat, ist endgültig vorbei, das bürgerliche beginnt. Der Adel, mit dem gut zu leben war, ist fort. Selbst die liebe unentbehrliche Freundin Erdödy weilt fern. Die Sehnsucht geht nach den schönen Tagen, zu edlen, hochgesinnten Menschen, zur unsterblichen Geliebten, nach Martonvásár – – – Selbst der Quell des Schaffens ist versiegt nach den letzten großen Werken; die Zeit ist nicht angetan für große Inspirationen, etwas ist am Sterben – – Seinen verlegerischen Freunden Breitkopf und Härtel in Leipzig klagt er brieflich: »Meine kaum kurz geschaffene Existenz hier ruht auf lockerem Grund – – Welch zerstörendes, wüstes Leben um mich her; nichts als Trommeln, Kanonen, Menschenelend aller Art – – –«
Seine Hoffnungen sind zu Ruinen geworden – wer mag unter solchen Umständen an die Errichtung eines Hausstandes denken? Sein Lebensglück steht in Frage. Damals auf Martonvásár wäre es möglich gewesen, aber er war selbst den praktischen Fragen gegenüber zu peinlich, zu gewissenhaft; und jetzt war es zu spät! Also Geduld! Und an Theresa geht die resignierte Bitte, halb Trost, halb Verzicht: »unsere Sache Gott anheimstellen, der Allmächtige weiß, daß unsere Herzen einig sind und unsere Treue unverbrüchlich; er gebe, daß wir bald zusammengeführt werden – – du wirst dich fassen, du weißt es, nie kann eine andere mein Herz besitzen, nie – – welche Sehnsucht mit Tränen nach dir – –«
Sie antwortet ihm liebreich: »Vor Gott und Ewigkeit bin ich deine Braut, und wenn es ihm gefällt, vor der Welt – es wird noch offenbar werden, ich weiß es und gedenke dein, täglich – wo ich bin, bist du mit mir; unter dem Lindenbaum fühle ich deine Nähe! Sei ruhig und gefaßt, wie ich es bin, die Vorsehung meint es gut mit uns, laß uns vertrauen – unser Glück ruht in Seiner Hand – – –«
Der Himmel ist ungünstig, er verdüstert sich immer mehr. Kaum daß Beethoven seine Jahresrente empfängt, die angesichts der stockenden Geschäfte und furchtbaren Teuerung als Kriegsfolge ohnehin seine Lage nicht verbessert, da setzt der Staatsbankrott seine Rente auf ein Drittel ihres Wertes – ein harter Schlag! Und noch ein zweiter, ein dritter: die Geldentwertung hat den reichen Fürsten Lobkowitz in Konkurs gebracht, er wird unter Kuratel gesetzt – seine Rentenzahlung hört auf. Und als dritte Hiobspost: Fürst Kinsky, der dritte Gönner, ist in Prag vom Pferd gestürzt und gestorben; die Erben verweigern die Weiterzahlung des Rententeils! Bleibt also nur jenes Drittel, das Erzherzog Rudolf zu leisten hat und das allein pünktlich fortgezahlt wird. Wegen der anderen verweigerten Anteile sieht sich der Meister schließlich genötigt, langwierige Prozesse anzustrengen – eine bittere Notwendigkeit, die einen häßlichen Nachgeschmack zurückläßt. Diese traurigen Erfahrungen wirken lähmend auf den Genius. Neue Symphonien sind im Werden, aber sie machen nur langsame Fortschritte.
»Statt Takte muß ich Gänge machen«, klagt er seinem großen Schüler, dem Erzherzog. Der Lebenskampf wird immer schwieriger.
Jetzt erkennt man erst, welche Rolle der Adel als Kulturträger gespielt hat, nachdem er verarmt und seine Rolle zu Ende ist. Alle Verhältnisse gehen aus den Fugen. Neu-Reiche sind von unten her aufgetaucht, aber sie sind ohne Kultur, ohne höhere Bedürfnisse – – – Bruder Johann ist durch Chininlieferung an die Armee ein reicher Mann geworden; für den berühmten Bruder Ludwig, der in Not ist, hat er kein Gefühl, keine Hilfe, nur hochmütige Worte.
Auch mit Karl gibt es nach kurzer Versöhnung wieder neue Ärgernisse. Er hatte sich wieder einmal als Geschäftsführer aufgespielt, um Ludwig in den schwierigen Zeiten neue Verlegerquellen zu eröffnen. Das alte Mißtrauen des Meisters ist nach anfänglicher übergroßer Vertrauensseligkeit alsbald wieder rege geworden; er hat den Bruder im Verdacht, daß er eine Komposition hinter seinem Rücken verkauft und den Ertrag für sich behalten hat. Er wird bestärkt in diesem Argwohn durch den Umstand, daß die Noten verschwunden waren, ohne daß sich irgendwelcher Ausweis über deren Verbleib oder eine Abrechnung vorfand.
Dies denken und in die Wohnung Karls stürmen, ist eins.
Die Familie sitzt eben bei Tisch, als Ludwig mit den Worten hereinstürzt:
»Du Dieb, wo sind meine Noten?!«
Die Frau hat alle Mühe, die hart aneinander geratenen Brüder auseinander zu bringen. Das fünfjährige Söhnchen, das ebenfalls Karl heißt, flüchtet weinend und schreiend zur Mutter.
Endlich werden die Noten aus einer Schublade gerissen und Beethoven vor die Füße geworfen. Das beruhigt den aufgebrachten Künstler, er lenkt ein, und ebenso rasch von den verletzendsten Vorwürfen zur reumütigen Versöhnlichkeit übergehend, bittet er den verdächtigten Bruder um Verzeihung. Der aber will nichts mehr wissen von ihm und schimpft weidlich fort. Schließlich stürzt Ludwig zur Tür hinaus, ohne die Noten mitzunehmen.
Nun ist für eine Weile wieder alles verschüttet zwischen ihm und seinen Brüdern.
Von der alten Gesellschaft ist nur Baron Zmeskall übriggeblieben. Er ist gewissermaßen Mittelglied zwischen dem Hochadel und den bürgerlichen Kreisen, in denen der Meister nun verkehrt, nachdem die aristokratischen Freunde fern von Wien sind.
Ein ganzer Kranz neuer Freunde umgibt ihn und ist bemüht, Blumen auf den rauhen Pfad des vereinsamten Pilgers zu streuen und sein Leben irgendwie zu verschönern. Es sind auch manche Dornen dabei.
Die Freunde versammeln sich in Zmeskalls Wohnung, die in dem ungeheuren Gebäudewirrsal des sogenannten Bürgerspitals liegt. Allwöchentlich ist Musikabend bei dem Hofkonzipisten der königlich ungarischen Tafel; der Meister erscheint ziemlich oft und ist gefeierter Gast. Hier begegnet er seiner Dorothea-Cäcilia, der Baronin Ertmann und jener anderen Interpretin seiner Werke, der Frau Marie von Bigot, mit der er seit dem Weggang der Gräfin Erdödy in herzlicher Freundschaft verkehrt.
Kindlich, ohne Arg und unbekümmert in seinem Verkehr, hat der Meister seine Freundin Marie zu einer Spazierfahrt an einem schönen Frühlingstag eingeladen, und zwar mitsamt ihrem kleinen Töchterchen – sie nahm ihm die dringende Einladung jedoch fast übel und meinte, das schicke sich nicht; der Meister ist ganz bestürzt darüber und muß sich in einem längeren Schreiben an das Ehepaar Bigot förmlich entschuldigen und seine Ahnungslosigkeit gegen den bösen Klatsch, der ringsum aufzüngelt und überall Schlechtes wittert, rechtfertigen; es gibt wieder einmal eine arge Enttäuschung. Solchen erbärmlichen Lebensauffassungen ist er in den hohen Adelskreisen allerdings niemals begegnet; dort fand er vornehme große Gesinnung, die ihm sein eigenes Wesen leicht machte, und wenn er hin und wieder hart anstieß, so war es nicht ihre Schuld.
Er tut sich schwerer mit den kleinen Freunden von jetzt als früher mit den großen, deren Lebensstil ihm zum Bedürfnis geworden ist. Er ist Aristokrat auch in der Dürftigkeit, und die Enge, in der er sich bewegt, ist jetzt doppelt drückend. Er muß es auf vielfache Art spüren.
An Stelle der Marie Bigot, die mit ihrem Gatten nach Paris übersiedelt, ist Nannette Stein, die Jugendfreundin aus Augsburg, jetzt verehelichte Streicher, getreten; sie gehört dem Musikkreise Zmeskalls an; ihr Gatte, der Wiener Klavierfabrikant, erfindet Schallverstärkungen für Beethovens Klavier, mit denen er besser hört. Nannette ist Ratgeberin in tausend Wirtschaftsfragen des Meisters. Sein Adlatus statt des Bruders Karl ist jetzt der Musiker de Oliva; denn irgendeine geschäftliche Hilfe muß der Künstler haben. De Oliva verkehrt auch in der Lesegesellschaft beim »Blumenstock« und im Kreise Zmeskall. Er gehörte früher zur Partei Gallenbergs und ist nunmehr dem Meister nähergetreten. Auf einer Kunstreise hat er in Weimar Beethovens Fünfte in C-Moll, die Schicksalssymphonie, vor Goethe gespielt, der indessen kein rechtes Verhältnis zu dieser gewaltigen Musik fand, die ihm wohl groß, aber mehr unbändig als ergreifend vorkam. Für diese Tragik fühlte er nichts; sein Kunstgefühl bevorzugte harmonisch ausgeglichenes Ebenmaß.
Der Name Goethe war freilich die beste Empfehlung de Olivas bei dem Meister, der auf Breitkopf und Härtels Veranlassung an einer Ouvertüre für Egmont arbeitete und unbegrenzte Verehrung für den Dichterfürsten hegte, dessen Lyrik er längst für sich entdeckt hatte.
Durch Oliva mit dem jungen Baron Gleichenstein bekannt und befreundet geworden, kommt Ludwig in das Haus des Arztes Malfatti, dessen älteste Tochter Anna Gleichensteins Braut ist. Die ganze Familie lebt und webt in Musik; die blonde sinnige Anna und ihre jüngste Schwester, die schwarze feurige Therese, gelten nun als die schönsten Mädchen Wiens. Es sind beschwingte Abende, an denen Therese am Klavier sitzt, der Meister dicht hinter ihr, Anna stehend mit der Gitarre, dem damals hochbeliebten Instrument; im Hintergrund Vater Malfatti mit dem Notenblatt in der Hand, und der Reihe nach Kopf an Kopf die engeren Hausfreunde, zu denen der ganze Musikkreis Zmeskalls gehört.
Therese, das frühreife Kind, nicht viel mehr als vierzehnjährig, wird Meister Ludwigs Schülerin. Daß sie denselben Namen trägt, wie seine Unsterbliche, ist ein Reiz mehr. Der vereinsamte Mann fühlt sich seltsam hingezogen zu dem schönen Kind, er beschäftigt sich viel mit ihr, schreibt ihr Briefe, wenn sie fern von der Stadt auf dem Lande ist, empfiehlt ihr seine Lieblingslektüre, »Wilhelm Meister« darunter, Shakespeare u. a., und läßt durchblicken, daß er ihr diese Werke selbst hinausbringen wolle aufs Land, nur auf eine halbe Stunde, und dann wieder fort, um ihr auf diese Weise »die kürzeste Langweile« zu bereiten. Auch ermahnt er sie, das Klavier nicht zu vergessen, rühmt ihr Talent, ihr Gefühl für das Schöne und Gute und möchte Vollkommeneres von ihr verlangen, das wieder zurückstrahlt. Er hat eine väterlich betonte Liebe zu ihr gefaßt; de Oliva spielt den Mephisto und trägt die Korrespondenz hin und her.
Das Kind Therese läßt sich die Huldigungen gern gefallen und spielt mit dem Feuer; sie ist freilich keine Gräfin Theresa und behandelt die Dinge, um die es dem Meister ernst ist, mit tändelnder, flüchtiger Oberflächlichkeit, die weit absticht von der Nachdenklichkeit des Lehrers und Freundes.
Das sichtliche Interesse gibt dem allzeit geschäftigen Klatsch wieder Nahrung; das Gerücht verbreitet sich, der Meister trage sich mit Heiratsgedanken und wolle um die Hand der Therese Malfatti anhalten.
Oliva, der sich ganz zum intimen Vertrauten Ludwigs zu machen wußte, spielt den Übereifrigen; er glaubt dem Meister einen Dienst zu erweisen, indem er sich zum Zwischenträger und Postillon d'amour macht, und läßt Andeutungen fallen. Die feurige Therese tut, als wäre sie wie aus den Wolken gefallen – der Vater Malfatti zieht die Brauen noch um eins höher: als Arzt behandelt er den Künstler und kennt sein kompliziertes Leiden; auch weiß er, daß sich der Meister oft in Geldverlegenheiten befindet; Gleichenstein, dem sich Ludwig freundschaftlich eröffnet, hat ihm erzählt, daß der Meister Geld aufnehmen mußte, da ihm der reiche Bruder nichts mehr borgt – – – kurz, man ehrt ihn als Künstler, aber sonst ist eine scharfe Grenze gezogen; die Einladungen bleiben plötzlich aus, und Gleichenstein teilt ihm mit, daß er es ihm sagen lassen wolle, wann wieder Musik sei.
Diese Nachricht stürzt den Sehnsüchtigen aus den höchsten Höhen seiner Illusionen wieder tief hinab in die Finsternisse der Trostlosigkeit.
Sein empfindlichster Punkt ist getroffen: er will nicht nur als Künstler, sondern als Mensch um seinetwillen und um der Freundschaft willen geliebt sein, seine ideale Forderung.
»Bin ich denn gar nichts als dein Musikus oder der anderen?«
So schreibt er ihm im Ton des schmerzlichsten Vorwurfs.
»Es ist wirklich betrübend, daß ich wieder nur im eigenen Busen einen Anlehnungspunkt suchen muß und daß es von außen keinen für mich gibt. – Nein, nichts als Wunden hat die Freundschaft und ähnliche Gefühle für mich!«
Und er klagt:
»Für dich, armer Beethoven, gibt es kein Glück von außen; du mußt dir alles in dir selbst erschaffen; nur in der idealen Welt findest du Freunde.«
Er bittet Gleichenstein gegen neun Uhr zum Frühstück bei sich und möchte die Wahrheit hören; jetzt sei es noch Zeit, meint er; Wahrheiten könnten ihm noch nützen.
Der liebenswürdige Gleichenstein, ein guter, lauterer Charakter, sagt mehr, indem er schonend schweigt.
Immerhin, Ludwig weiß genug. Er hat eine Lehre empfangen. Er beschließt, künftig auf der Hut zu sein, und notiert in seinem Tagebuch:
»Wegen Therese ist nichts anderes, als Gott es anheimzustellen, nie dorthin zu gehen, wo man Unrecht aus Schwachheit begehen könnte; nur ihm allein, dem alles wissenden Gort, sei dies überlassen.«
Er sieht ein, daß es Schwachheit war und ein Unrecht geworden wäre. Doch nimmt er sich vor:
»Jedoch gegen Therese so gut als möglich, ihre Anhänglichkeit verdient immer nie vergessen zu werden – wenn auch leider nie deren vorteilhafte Folgen für dich entstehen könnten.«
Als Mensch, um seinetwillen und der Liebe willen geliebt zu werden, diese ideale Forderung zu erfüllen, war nur Theresa von Brunszvik fähig, seine unsterbliche Braut, die er übrigens auch nur in der idealen Welt sein nennen darf, bis es dem Himmel gefällt, den Lebenswunsch zu verwirklichen und seine Einsamkeit aufzuheben.
Das war die Lehre, die er aus dieser Erfahrung sich entnehmen konnte.
Vater Malfatti hält es trotz allem für geraten, den Meister auf eine Zeitlang wenigstens zu entfernen; er fürchtet für Therese, die doch tiefere Empfindungen für ihn hegt, als sie dem Oliva verraten mochte, und verschreibt ihm zur Kur einen mehrwöchigen Aufenthalt in den böhmischen Bädern.
In der Tat läßt der gesundheitliche Zustand Ludwigs sehr viel zu wünschen übrig, woran die Aufregungen und Erschütterungen dieser entbehrungsreichen Zeit nicht wenig Schuld tragen. Die Magen- und Darmbeschwerden sollen Linderung, wo nicht gar Heilung in Teplitz finden. Das schlimmste freilich ist der Dämon im Ohr! Finstere Gedanken suchen ihn immer wieder heim: »Oh, so schön ist das Leben; aber bei mir ist es für immer vergiftet!«
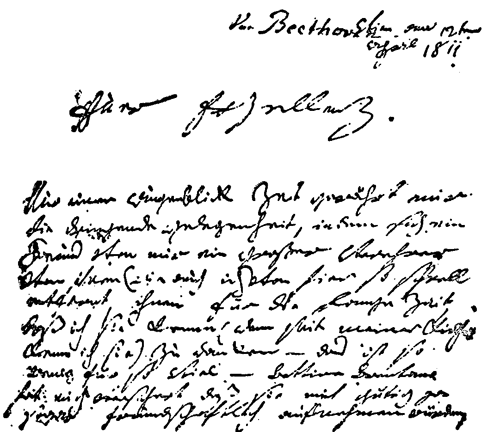
Brief Beethovens an Goethe. Im Besitz des Goethe- und Schiller-Archivs, Weimar.
Aus dem tiefen Mißmut und Lebensüberdruß, der ihn neuerdings erfaßt, reißt ihn eine neue Schicksalsbotin empor: die schwärmerische Bettina Brentano, die Freundin Goethes, die den Meister geistig erwärmt, aber nicht in Brand steckt.
Die berühmte Sibylle der Romantik hat bei ihren Verwandten in Wien, der Familie von Birkenstock, eine Beethoven-Symphonie gehört und allerlei Anekdoten über den Künstler gesammelt; sie ist auf bedeutende Persönlichkeiten erpicht und sucht ihn im Pasqualatischen Hause auf, wo der Meister wieder seine frühere Wohnung bezogen hat.
Der Zaubername Goethe öffnet Bettina Tür und Herz bei Beethoven, der sonst schwer zugänglich ist und sich in seiner Melancholie und Schwerhörigkeit vor Menschen scheu zurückzieht; was Fürsten und Prinzen, auch wenn sie ihm eine Rente zahlen oder schuldig bleiben, nicht ohne weiteres erreichen, gelingt ihr mühelos: nämlich daß Beethoven ihr zuliebe vorspielt. Ja, sie zieht ihn aus seiner Verborgenheit wieder hervor, glänzt mit ihm in der Gesellschaft, wo sie Arm in Arm mit ihm erscheint zur Verwunderung aller; sie wandelt mit ihm fast täglich durch die Alleen von Schönbrunn, im tiefen Gespräch über die Kunst, wobei sie ihre Antworten und Bemerkungen auf kleine Zettel aufschreibt, um nicht zu laut schreien zu müssen; sie schreibt begeisterte Briefe an Goethe und regt ein Zusammentreffen der beiden in Karlsbad oder Teplitz an – eine Aussicht, die den Meister entzückt und zu einer Korrespondenz mit dem Großen von Weimar veranlaßt. Sie hat auch einer Musikprobe der Egmont-Ouvertüre beigewohnt und berichtet in ihrem etwas exaltierten Stil nach Weimar:
»Da sah ich denn diesen ungeheuren Geist sein Regiment führen. O Goethe! Kein Kaiser und kein König hat so das Bewußtsein seiner Macht, und daß alle Kraft von ihm ausgehe, wie dieser Beethoven – –«
Der Dichterfürst antwortet etwas kühl, aber er ist neugierig gemacht; die Begegnung ist eine beschlossene Tatsache.
Malfatti drängt auf Abreise – alle Zeichen und Wegweiser deuten auf Teplitz; diesmal gehorcht er dem Arzt, obzwar er gegen alle Ärzte das tiefste Mißtrauen hegt, am meisten gegen den, der ihn jeweils gerade behandelt – –
Eine liebe Hoffnung ist es, daß Franz von Brunszvik, der ihm eine Sendung von guten Tokaier Weinen zur Herzstärkung zugehen ließ, die Reise mit ihm machen will, er ist ebenfalls kurbedürftig; schließlich aber trifft eine Absage ein, Franz ist verhindert und Ludwig wütend darüber. An dessen Stelle begleitet ihn der unvermeidliche Mephisto Oliva, der den Impresario spielt und irgendeine dunkle Mission als Sendling des Schicksals im Leben des Meisters zu erfüllen hat, wenn es auch nur eine neue Heimsuchung und Prüfung ist.
»Ich muß jemand Vertrauten an meiner Seite haben,« schreibt er nach Martonvásár, »soll mir das gemeine Leben nicht zu hart werden!«
Und da erweist Oliva auch schon seine geheime Bedeutung: der »Urania«-Dichter Tiedge, dessen Lied der Meister vertont hat, ist mit seiner Freundin, der Gräfin Elise von der Recke, erschienen, in ihrer Begleitung eine junge Berliner Sängerin, Amalie Sebald, dann Varnhagen von Ense und die berühmte Rahel Levin, schöngeistig wie Bettina und Varnhagens Braut, kurz ein ganzer Romantikerkreis, mit dem weltläufigen de Oliva persönlich bekannt, der sogleich die Verbindung mit seinem Herrn und Meister, dem großen unwirschen Sonderling, herstellt.

Es sind angenehme Tage in Teplitz, die zwar nicht Heilung, aber doch freundlichere Gemütsstimmung in der überaus anregenden Gesellschaft bringen, und das wirkt immer förderlich auf das Allgemeinbefinden. Auch sein Schaffenstrieb ist angeregt: zwei Singspiele von Kotzebue zur Eröffnung des Pester Theaters, »Die Ruinen von Athen« und »König Stephan«, sind in Musik gesetzt.
Die Atmosphäre von Huldigung und Bewunderung hat die Wirkung der Trinkkur insofern erhöht, als eine Brunnenfee wie Amalie Sebald den Seelentrunk reicht. Sie ist kein Blaustrumpf wie Bettina oder die Rahel oder die Recke, sondern ein liebes herziges Mädchen, das, wie es scheint, glühende Kohlen auf das einsame Herz sammelt.
Oliva freut sich diebisch; er weiß es so einzurichten, daß die beiden sich allein treffen; er möchte den Meister verliebt sehen und bringt im Alleinsein mit ihm stets das Gespräch auf die Frauen in einer Weise, die äußerst verfänglich ist. Er hat die Kunst des Verführers und Kupplers und macht sich dadurch beliebt; seine Meinung ist, daß dem Meister eine herzhafte Liebe fehle und daß ihm nichts so not täte als heiraten. War es früher die Malfatti, so ist es jetzt die Amalie, die ihm als der gegebene Fall erscheint – und Mephisto erzielt immer einen gewissen Erfolg mit seinen Einflüsterungen, besonders auf ein leidenschaftliches Temperament, wie es der Meister ist. Von dessen Herzensgeheimnis weiß er allerdings nichts: die ideale Liebe zu Theresa ist ihm verborgen. Zugleich steht er auch als Versucher hinter Amalie, die ihm ein geneigtes Ohr leiht; er schürt und schürt, bis das Fünkchen Seelenneigung zu einer richtigen Flamme angefacht ist – – – . Wieder bewahrheitet sich die Beobachtung, die Wegeler einst machte, daß Ludwig Eroberungen mache, die einem Adonis schwer oder gar unmöglich wären.
Beim Abschied schärft er Amalie ein, daß sie, auch wenn sie wolle, ihn ja nicht vergessen soll, und schickt ihr nachträglich noch durch die Gräfin von der Recke »einen recht feurigen Kuß«. Die Tändelei des Teplitzer Sommers ist vorüber, doch hat man sich das Versprechen gegeben, sich im nächsten Sommer hier wiederzufinden, zumal als dann auch das endliche Zusammentreffen mit Goethe stattfinden soll, der heuer bereits vor der Ankunft Beethovens von seiner Badekur nach Weimar zurückgekehrt ist.