
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Passiflor der reinsten Seelenliebe war auf Martonvásár erblüht. Glücklicher Sommer! Ein Traum, der nicht verweht! Der selig wie ein unnennbar tiefer Himmel immer über seinem Gemüte schwebt und den er auch trotz dunkler Wolkenlasten über sich weiß.
Ludwig verehrte Theresa wie eine Heilige. Der Vergleich mit Giulietta drängte sich ihm zwingend auf. Wie groß waren diese Gegensätze! Dort der glühende, verzehrende Brand einer Sinnenliebe, die in Enttäuschung und Widerwillen endete; hier die ruhige stetige Flamme einer keuschen, idealen Hingebung, fast leidenschaftslos und voll Opferfreude. Dort Untreue, Verrat, ein Verlassenwerden in Not und Krankheit – hier Karitas, die sich mit dem Leiden vermählt und an diesem um so größer erwächst: ein Opferlied der Treue. Ein Seelenband, das im Himmel geknüpft ist und unzerreißbar besteht, trotz aller Wechselfälle des Schicksals. Ein Bund, den die Vorsehung segnete. Es mußte zur Aussprache kommen; die Liebenden, die sich so schmerzlich suchten über allen Trennungen, hatten sich gefunden. Der Liebesengel hatte die Sehnsüchtigen, die wußten, daß sie unlösbar zusammengehören, in dem Park der Schwermut von Martonvásár zusammengeführt und umschlossen. Der reine Tag der Freude war dem Meister erschienen, die geliebte Hoffnung, die er in seinem Heiligenstädter Testament erfleht. Im Tempel der Natur und im Kreise würdiger Menschen war er als Würdiger aufgenommen, von Liebe und Freundschaft fürs Leben umwoben. Seligkeit überströmte sein Herz; er fühlte sich erquickt von dem Labsal des inneren Friedens, als er die Brust befreite von dem Geständnis der Liebe und das beglückende Geständnis der Liebe empfing unter den beseelten Linden an jenem unvergeßlichen Abend, wo nun Theresa wie die träumende Muse der Hoffnung und Erinnerung wieder still wandelte als keusche Priesterin dieses Weihebezirkes.
Aber diese Ruhe und Windstille, die alsbald folgte, begann schwer zu lasten auf seinem Gemüt. Wohl war das Leben schön in dieser Geborgenheit und ebenso schön zu denken, hier nur der Kunst, der Freundschaft und der Liebe zu leben in der ersehnten ehelichen Harmonie, die ihm stets als hohes Ideal vorgeschwebt war. Aber er brauchte den Sturm; er brauchte die Welt und den Kampf, der seine schöpferischen Tiefen und die Urgewalten seines Genius aufrief, die in seiner Musik ausströmten. Ja, er brauchte das Leid, um sein tönendes Evangelium der Überwindung zu verkünden. Und dieser Sturm, dieser Kampf, und sei es auch das Leid, sie warteten draußen. Hier auf dem schwermütigen, träumenden Martonvásár schwieg seine Muse, obzwar ihre sichtbare Verkörperung Theresa ihn mit ihrer holden Gegenwart umschwebte. Doch sein Schaffen stockte; es kam nicht in Fluß, was er sich auch mühte. Tragischer Zwiespalt!
»Oh, es ist so schön das Leben tausendmal leben – für ein stilles Leben, nein, ich fühl's, ich bin nicht mehr dafür gemacht – – –!« Er erinnerte sich wieder der Worte, die er vor soundso viel Jahren unter ganz anderen Umständen an Wegeler geschrieben, und sie hatten heute noch unveränderte Bedeutung.
Es war auch seinem Stolz unerträglich, in Abhängigkeit von der Familie Theresas zu leben, wie sie und der seelengute Franz es ihm vorgeschlagen hatten. Er mußte sein eigener Herr sein, auf eigenen Füßen stehen, unabhängig, wie er es von früh auf gewohnt war, dann erst war er ganz er selbst! Lieber in Armut, aber frei! Die Freiheit nach allen Seiten war die eigentliche Lebensluft, in der er leben und schaffen konnte. Martonvásár war trotz allem doch nur ein goldener Käfig, darin es ihn auf die Dauer nicht litt, ebensowenig wie damals in der vornehmen Bequemlichkeit des fürstlichen Hauses Lichnowsky, wo er gleichwohl wie sein eigener Herr schalten und walten durfte. Aber es gab Bindungen, die ihm unerträglich wurden und die er gerne mit der Ungebundenheit seiner elenden Junggesellenbehausungen vertauschte, wie sehr ihn auch die Misere von einer Wohnung in die andere trieb, weil keine ganz seinen Wünschen entsprach. Ein selbstgeschaffenes Heim nach eigenem Sinn mit Theresa an seiner Seite als Lebensgefährtin, abends ein kleiner Kreis von Freunden – so dachte er die Zukunft. Martonvásár konnte nur die gelegentliche Zuflucht sein, eine ferne stille Insel, wohin man ging, um auszuruhen: leben, schaffen, wirken mußte man draußen!
Das waren die Gedanken, die ihn auf der Reise begleiteten, als sein Wagen knirschend über den Kies der Schloßrampe hinunterrollte und vom Söller die wehenden weißen Tücher und winkenden Hände hinter der Wegbiegung verschwunden waren.
Nun lag das Schloß der Liebe versunken hinter den hohen Laubkronen des Parks in tiefer, tiefer Einsamkeit, und nur die Sehnsucht ging im hohen Flug zurück.
Franz Brunszvik und Deym gaben ihm das Geleit bis zur nächsten Poststation, wo er den Eilwagen bestieg, der ihn raschest nach Wien zurückführen sollte.
Ein seltsamer Zufall will es, daß unterwegs Fürst Esterhazy zusteigt. Er wollte ihn in Wien aufsuchen; um mit ihm die Einzelheiten der Aufführung der C-Dur-Messe zu besprechen, die der Vollendung harrt. Der Fürst wünscht, daß die Erstaufführung auf Schloß Eisenstadt stattfinde. Der Meister sagt zu, doch ist heuer noch nicht daran zu denken. Vielleicht im nächsten Jahr.
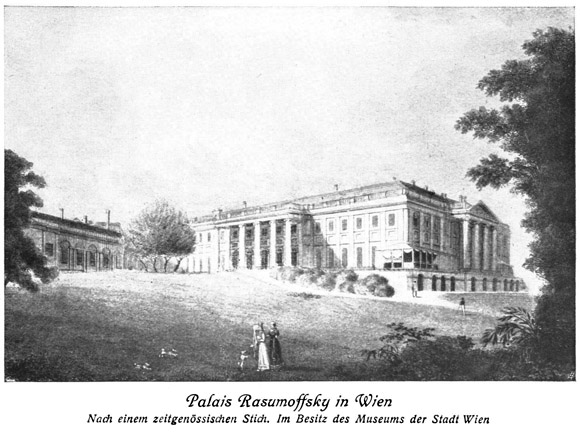
Das Wetter ist schlecht geworden; Juligewitter entladen sich mit furchtbarer Heftigkeit, Felder und Wege sind überschwemmt, ein wahrer See. Die Nacht bricht herein; es müssen Umwege gewählt werden; der Meister ist nicht zu bewegen, auf der vorletzten Station zu übernachten. Elementarereignisse rütteln Elementares in ihm auf; der Gewittersturm und Wolkenbruch ist ihm Wohltat nach der langen Stille und gleichförmigen einschläfernden Hitze unter dem blauen Himmel von Martonvásár. Er fühlt sich erfrischt und fährt in die wolkenschwarze, weglose Gewitternacht hinein.
Merkwürdig, wie ähnlich diese Heimreise jener anderen ist vor vielen Jahren, als er von Giulietta auf Schloß Eisenstadt unter den romantischsten Umständen Abschied genommen. Und nun fast dieselben Begleiterscheinungen. Auch damals trug er eine Liebe im Herzen, und der Wettersturm mit den nächtlichen Reisegefahren machte Musik dazu und sang mit dem Sturm um die Wette, der in seinem Inneren tobte. Fast wie heute! Und doch wie anders die Verhältnisse und auch die innere Stimmung diesmal gegen einst! Im Vergleich mit damals fühlt er sich wie neugeboren, einem tiefen Verhängnis entronnen. Er glaubte einen Engel zu lieben, der sich als Dämon entpuppt hatte. Er war verzaubert gewesen von süßen Sirenenklängen, eine Circe hatte ihn umgarnt; fast pries er sein Leiden, das Übel, das ihn heimgesucht hatte, denn es hatte ihm die wahre Erscheinung enthüllt, die sich in der Liebesgestalt verbarg. Wie viel Schlimmeres war ihm vielleicht durch jene schwere Leidensprüfung erspart geblieben. Die Bahn war frei geworden, die ihn in die Arme jenes wahren Lichtengels führte, der nun seine Seele erhellte und erquickte, ohne die unheimlich lodernden Leidenschaften zu entfesseln, die sein gänzliches Verderben hätten werden können. Giulietta rief etwas auf in ihm, was besser nie geweckt worden wäre; wie ein Trugbild erschien sie ihm wieder auf dieser stürmischen Fahrt; aber das Gesicht entwich alsbald, Gleichnis der irdischen Liebe; die reinen milden Züge Theresas gewannen Oberhand als Sinnbild himmlischer Liebe, das wie ein großes freundliches Gestirn aus dem zerrissenen Nachtgewölk hervorstrahlte. Sie hatte sein besseres Ich aufgerufen, daß jene andere keine Gewalt mehr über ihn gewinnen konnte.
Alle Gedanken und Gefühle drängten in liebender Sehnsucht zu Theresa zurück, je mehr die Entfernung zwischen ihr und ihm wuchs. Und dieses stille Gedenken machte wieder leicht froh, noch mehr, es machte ihn andächtig und fromm. Seine Seele war wieder keusch und rein geworden, seitdem die Geliebte darin Platz genommen und auf dem Altar thronte, der ihr gebührte, wenn auch eine andere sie zeitweilig verdrängt hatte.
Damals war Unruhe in seinem Herzen, jetzt Verklärung und zartes Sehnen. Allerdings gab es auch diesmal schwierige Lebensfragen und Probleme zu lösen; aber dem hohen Bild der Gnade konnten sie keine Trübung bereiten. Es stand über den äußeren Dingen und Zufälligkeiten des gewöhnlichen Daseins.
Kaum heimgekommen, gab er sofort dem Zug seines Herzens nach und schrieb an die Geliebte, um sich die Seele zu erleichtern:
»Am 6. Juli morgens
Mein Engel, mein Alles, mein Ich. – nur einige Worte heute, und zwar mit Blejstift – (mit Deinem) erst bis morgen ist meine Wohnung sicher bestimmt, welcher Nichtswürdiger Zeitverderb in d. g. – warum dieser tiefe Gram, wo die Nothwendigkeit spricht – Kann unsre Liebe anders bestehn als durch Aufopferungen, durch nicht alles verlangen, Kannst Du es ändern, daß Du nicht gantz mein, ich nicht gantz Dein bin – Ach Gott, blick in die schöne Natur und beruhige Dein Gemüth über das müssende – die Liebe fordert alles und gantz mit recht, so ist es mir mit Dir, Dir mit mir – nur vergißt Du so leicht, daß ich für mich und für Dich leben, muß – wären wir gantz vereinigt, Du würdest dieses schmerzliche eben so wenig als ich empfinden – meine Reise war schrecklich – ich kam erst Morgens 4 Uhr hier an, da es an Pferde mangelte, wählte die Post eine andere Reiseroute, aber welch schrecklicher Weg, auf der vorlezten Station warnte man mich bej nacht zu fahren, machte mich einen Wald fürchten, aber das reizte mich nur – und ich hatte Unrecht, der Wagen mußte bej dem schrecklichen Wege brechen, grundloß, bloßer Landweg, ohne solcher Postillione, wie ich hatte, wäre ich liegen geblieben Unterwegs – Esterhazi hatte auf dem andern gewöhnlichen Weg hierher dasselbe schicksaal mit 8 Pferden, was ich mit vier – jedoch hatte ich zum Theil wieder Vergnügen, wie immer, wenn ich was glücklich überstehe. – nun geschwind zum innern vom äußern, wir werden unß wohl bald sehn, auch heute kann ich Dir meine Bemerkungen nicht mittheilen, welche ich während dieser einigen Tage über mein Leben machte – wären unsre Herzen immer dicht aneinander, ich machte wohl keine d. g. die Brust ist voll Dir viel zu sagen – ach – Es gibt Momente, wo ich finde, daß die Sprache noch gar nichts ist – erheitere Dich – bleibe mein treuer eintziger schatz, mein alles, wie ich Dir, das übrige müssen die Götter schicken, was für unß sejn muß und sejn soll. –
Dein treuer
Ludwig. –
Abends Montags am 6ten Juli
Du leidest Du mein theuerstes Wesen – eben jetzt nehme ich wahr daß die Briefe in aller Frühe aufgegeben werden müssen. Montags – Donnerstags – die eintzigen Tage wo die Post von hier nach K. geht – Du leidest – ach, wo ich bin, bist Du mit mir, mit mir und Dir rede ich mache daß ich mit Dir leben kann, welches Leben!!!! so!!!! ohne Dich – verfolgt von der Güte der Menschen hier und da, die ich meine – eben so wenig verdienen zu wollen, als sie zu verdienen – Demuth des Menschen gegen den Menschen – sie schmerzt mich – und wenn ich mich im Zusammenhang des Universums betrachte, was bin ich und was ist der – den man den Größten nennt – und doch – ist wieder hierin das Göttliche des Menschen – ich weine wenn ich denke daß Du erst wahrscheinlich Sonnabends die erste Nachricht von mir erhältst – wie Du mich auch liebst – stärker liebe ich Dich doch – doch nie verberge Dich vor mir – gute Nacht – als Badender muß ich schlafen gehn – – ach Gott – so nah! so weit! ist es nicht ein wahres Himmelsgebäude unsre Liebe – aber auch so fest, wie die Veste des Himmels. –
guten Morgen am 7. Juli –
schon im Bette drängen sich die Ideen zu Dir meine unsterbliche Geliebte, hier und da freudig, dann wieder traurig, vom Schicksale abwartend, ob es unß erhört – leben kann ich entweder nur gantz mit Dir oder gar nicht, ja ich habe beschlossen in der Ferne so lange herum zu irren, bis ich in Deine Arme fliegen kann, und mich gantz hejmathlich bej Dir nennen kann, meine Seele von Dir umgeben ins Reich der Geister schicken kann – ja leider muß es sejn – Du wirst Dich fassen um so mehr, da Du meine Treue gegen Dich kennst, nie eine andre kann mein Herz besitzen, nie – nie – o Gott warum sich entfernen müssen, was man so liebt, und doch ist mein Leben in V. so wie jetzt ein kümmerliches Leben – Deine Liebe macht mich zum glücklichsten und zum unglücklichsten zugleich – in meinen Jahren jetzt bedürfte ich einiger Einförmigkeit, Gleichheit des Lebens – kann diese bej unserm Verhältnisse bestehn? – Engel, eben erfahre ich, daß die Post alle Tage abgeht – und ich muß daher schließen, damit Du den B. gleich erhältst – sej ruhig, nur durch Ruhiges beschauen unsres Dasejns können wir unsern Zweck zusammen zu leben erreichen – sej ruhig – liebe mich – heute – gestern – welche Sehnsucht mit Thränen nach Dir – Dir – Dir – mein Leben – mein alles – leb wohl – o liebe mich fort – verken(ne) nie das treuste Hertz
Deines Geliebten
ewig dein
ewig mein
ewig unß.«
Ries hätte ihm eine Wohnung in Heiligenstadt besorgen sollen, wo er für den Rest des Sommers seine Badekur fortzusetzen gedachte; es klappte nicht alles gleich auf Wunsch.
Es vergingen zwei, drei Tage, bis er in Ordnung untergebracht war; unterdessen blieb der Brief in der Tasche. Er wollte ihn selbst nach Wien bringen und eigenhändig der Fahrpost übergeben, damit er sicher ans Ziel gelange; nicht einmal dem treuen Ries wollte er ihn anvertrauen, daß er ihn mit nach Wien nehme.
Nach diesem Seelenerguß war Ruhe in sein Herz gekommen; aber es dauerte nicht lange. Die Ungeduld quälte ihn, mit Windeseile und auf Engelsflügeln hätte er der »unsterblichen Geliebten« Kunde geben mögen von seinem Fühlen und Denken. Aber der Brief befand sich noch in seiner Rocktasche und brannte wie heimliches Feuer, daß er mit fiebernden Händen immer wieder nach ihm tasten mußte, wie um sich zu vergewissern, daß nicht ein böser Dämon sich seines Geheimnisses bemächtigt und das Schriftstück entführt habe.
Wie ein unruhig klopfendes Herz zuckte der Brief in seiner Hand, sooft er danach griff. Er fühlte die Unruhe in seinem eigenen Herzen.
Das kommt daher, daß er noch nicht fort ist; die ferne Geliebte harrt eines gedenkenden Wortes, dachte er. Aber morgen, morgen mit der Extrapost! So tröstete er sich.
Doch seltsam, dieses Herzklopfen. Es läßt ihm keine Ruhe. Er reißt den Brief wieder auf und fliegt ihn noch einmal durch.
Und jetzt erwacht erst recht der Dämon Zweifel.
»Was habe ich da geschrieben?!«
Er greift sich an die Stirn, es ist ihm wie ein Traum. Er kann nicht mehr zurückfinden in die erste Ekstase, um solche Selbstentäußerung zu begreifen. Er erschrickt vor dem eigenen Seelenbild, das ihm aus seinen eigenen Zeilen unverhüllt entgegentritt. Er hätte es im ersten Sturm wegschicken müssen, versiegelt, ohne es wieder zu lesen, unbewußt, wie alles Schicksalshafte, dann wäre es gut gewesen. Jetzt liest er ernüchtert und schämt sich, daß er seine Seele nackt zeigen soll vor der Geliebten. Sein Fürchten und sein Hoffen malt sich in dem Spiegelbild. Vor allem sein Fürchten. Unwillkürlich hat sich eine geheime Scheu, ja eine förmliche Angst vor dem Glück in die Zeilen eingeschlichen. Die Angst, die jeden Liebenden befällt und jene ungewisse Trauer erzeugt, von der er spricht und die vom »Schicksal« abwarten will, »ob es uns erhört«.
Er hat jetzt Bedenken, solche Geständnisse der Unsicherheit der Geliebten zu machen, um sie nicht aus ihrer eigenen Traumsicherheit zu wecken. Er sollte ihr Mut machen und sich selbst – aber der Mut, den Liebe und Begeisterung gibt, ist durchwirkt von den Schatten der Sorge und rätselhaften Furcht, er könnte die innere Freiheit verlieren, die er im Dienst der Muse braucht und die ihm tiefstes Lebenserfordernis ist, so daß ihm bange wird sogar vor der reinen Liebe und vor ihr, der Unsterblichen, die ihm als die lebendige Verkörperung seiner Muse erscheint.
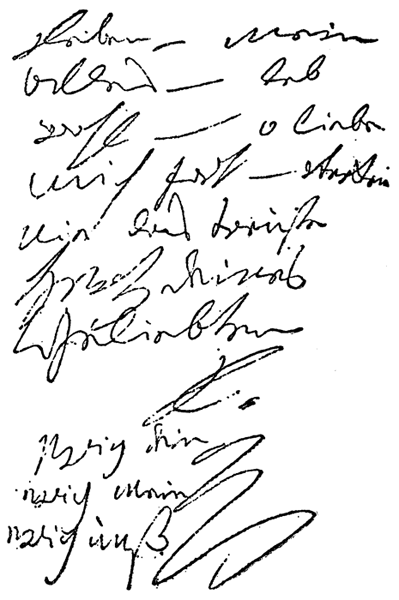
Brief an die unsterbliche Geliebte. (Letzte Seite.)
Kleinmut hat ihn befallen.
Ach, es gibt Dinge, die man selbst der Geliebten nicht sagen kann. Dinge, die man in größter Verschwiegenheit nur dem Seelenfreund anvertrauen könnte. Aber wo ist der Freund, dem er das Geheimnis seines Herzens enthüllen möchte? Etwa dem jungen Ries, der es doch nicht versteht? Oder Zmeskall, mit dem er nicht anders als witzelnd verkehrt und der als Zielscheibe für derbe Wortspiele gerade gut genug ist? Oder »Falstafferl«, dieser Musikantenseele, oder gar den aristokratischen Freunden?! Er hatte sie alle für nicht würdig zur Teilnahme an seinem inneren Leben befunden – – »Bloße Instrumente, worauf ich, wenn's mir gefällt, spiele – – –« Nicht einmal Steffen Breuning oder Wegeler, seinen Jugendfreunden, möchte er sich so erschließen. Und Amenda? Ach, die einstige innige Seelenfreundschaft ist mit der Zeit und Ferne so gut wie eingeschlafen. Niemand, niemand soll das himmlische Glück wissen; der Neid der Götter ist zu fürchten – – Darum darf auch niemand das heimliche Leid erfahren – –
Einsam ist der Mensch in seiner tiefsten Seele, und diese Einsamkeit ist seine Qual. An ihren Felsen ist er geschmiedet, und die Qual frißt wie ein Geier an seiner Leber. Streng ist das Glück, und Trauer empfindet er darob, wie alle Liebenden.
Mechanisch wandert er zur Stadt, den Brief in der Tasche, der nun doch fort muß.
Statt an der Poststation steht er vor dem Hause der Gräfin Erdödy. Ganz in Gedanken hat er seine Schritte dahin gelenkt, indem er sich einer inneren Führung überließ. Es ist ein Wink des gütigen Geschicks. Die Erdödy ist ja die einzige Mitwisserin seines liebenden Wünschens und Hoffens. Sein »Beichtvater«. Und eine Seele braucht der Mensch, der er sich erschließen muß, sein Glück, sein Leid; die Last des Schweigens ist zu groß.
Im nächsten Augenblick sitzt er in dem gemütlichen kleinen Salon, die arme leidende junge Frau, die mühsam herangehumpelt ist, sitzt ihm gegenüber. Die Zunge ist gelöst; mit glänzenden Augen und leuchtender Miene lauscht die Freundin dem Geheimnis von Martonvásár; sie ist der Schutzengel dieser Liebe. Wie gut sie versteht, und wie klug sie zuzuhören weiß!
Was er vor der Geliebten verbergen möchte, und was der Brief an sie wider Willen verrät, das wird jetzt freimütiges Geständnis der Freundin gegenüber.
Sie ist glückselig, den lieben Meister so nahe am Ziel seiner Wünsche zu wissen. Daß es Schwierigkeiten zu überwinden gibt, die sich nun erst bergehoch türmen werden, will auch sie nicht bestreiten. Aber den Liebenden müssen sich selbst Berge öffnen, um ihnen einen Weg freizugeben. Die Freundin ist voll Zuversicht; er ist es gar nicht. »Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt« – er kennt das Auf und Ab der liebenden Seele zu gut; das Klärchenlied hat es seinem musikalischen Herzen längst angetan.
Aber mit seiner Kopfhängerei ist sie gar nicht einverstanden.
»Wie kann man so wenig Selbstvertrauen haben?!«
Sie zankt ihn tüchtig aus.
Es tut ihm wohl; er, der sonst keinen Widerspruch verträgt, ist jetzt dankbar dafür, daß sie ihm gehörig die Leviten liest.
»Zur Kopfhängerei ist jetzt keine Zeit,« räsoniert die Gute, »und zum Umherschweifen in der Ferne, Kunstreisen und dergleichen Phantasien erst recht nicht – das ist ja wie Flucht vor dem Glück und führt zu gar nichts!«
»Fahren Sie nur so fort, Gräfin,« bittet der Meister, »ich brauche eine solche kalte Dusche; das erfrischt.«
»Nun gut also – Ihre Existenz und Ihre Zukunft liegt nicht in nebelhaften Fernen, nicht im Ausland, sondern hier, wo man Sie kennt und liebt und wo Ihre Freunde sind; jetzt fassen Sie tüchtig zu – ein Künstler, ein Meister wie Sie braucht nur ernstlich zu wollen: alles steht Ihnen zu Gebote; die Welt liegt Ihnen hier zu Füßen – – –«
»Glauben Sie?« gab er zweiflerisch zur Antwort.
»Glauben Sie etwa nicht?«
»Hm! Tja!«
»Also! Ein solches Glück vor Augen, müßte es mit Engelskräften über Sie kommen, verhundertfachte Schaffenslust – – –«
»Tut es ja – – –«
»Ruhm, Ehre, Würden; kurz, was Sie wollen.«
»Und die Hoftheaterstelle?«
»Ach, wenn es sonst nichts ist! Ihr Flug geht höher.«
»Aber die Sicherung der Existenz, Gräfin! Das Gesuch bleibt unerledigt liegen. Dieser elende Palffy! Der Intendant ist schuld! Wie soll der Mensch heiraten ohne feste Basis?! Schmählich ein Mann, der auf das Vermögen der Frau spekuliert! Er spielt eine unwürdige Rolle, und um seine Selbständigkeit ist es getan. Das könnte ich nicht ertragen. Bedenken Sie, daß ich dann für uns beide sorgen muß, für sie und mich – es reicht oft nicht für eines. Und meine Brüder – – –, die Galle läuft mir über, wenn ich an diese Undankbaren denke – – –«
»Lieber Meister, Sie sehen die Dinge zu schwarz. Man muß das Glück rasch packen und festhalten. Nicht zaudern; wer zuviel überlegt, versäumt es. Die Schwierigkeiten sind nichts, wenn man sie im ersten Feuer nimmt. Das Alleinsein ist nichts für Sie; Sie haben schon viel zu lang gewartet. Theresa ist treu und beständig; aber das ungewisse Harren zermürbt, und vor allem: zum Heiraten gehört ein gewisser Heroismus; wenn nur mehr die Vernunft spricht, erlahmt der Entschluß – – – Sie müssen handeln, Meister! Das andere findet sich dann. Der Preis ist hoch, aber er ist Ihrer würdig – ich möchte euch zwei glücklich sehen; ihr seid für einander bestimmt, nur fürchte ich, daß ihr euch die Sache noch schwerer macht, als sie ohnehin ist. Unpraktische Idealisten, alle zwei!«
Ein mütterliches Herz sprach hier zu ihm.
Beglückt und erleichtert ging er von dannen.
Den Brief hatte er der Freundin nicht gezeigt. Er ließ ihn hübsch in der Tasche. Auch als er an der Poststation vorüberging. Nicht Worte, Taten sollten für seine Liebe zeugen. Er fühlte neue Kräfte sich regen. Großes war ihm gelungen; Größeres war noch zu tun. Er konnte es, wenn er nur wollte – – –
Die Erdödy hatte recht: die Welt war sein, sie harrte ihres Siegers.
Das Herz war des Dankes voll für die Freundin: sie darbte selbst am Tische des Glücks; und wußte dem Darbenden doch so reiche Labe – – –
Nach außen hin die Hoftheaterstelle, das war das nächste; um das andere, das die Göttin Kunst verlangte, war ihm nicht bange.
Daß der Hofdienst eine Fron sei für einen Geist, dessen Lebensluft die Freiheit war, daran dachte er nicht. Er dachte nur an die Würde, die ihn der alten Gräfin Brunszvik als der künftigen Schwiegermama um soviel sympathischer erscheinen lassen müßte.
Also die Hofstelle! Damit wäre die Hauptschwierigkeit überwunden und die Bahn frei – – – Und dann – – dann – – –!
Das Haupt zurückgeworfen, den Hut tief im Genick, wanderte er mit wehenden Schößen zurück in die grünumrauschte Einsamkeit von Heiligenstadt. Die Schwermut war dahin, er segelte mit frischem Hoffnungswind dem großen, begehrten, vielfachen Ziel entgegen, wo das Glück winkte, die Liebe, die Unsterbliche!