
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wien, 28. August 1920
Hochverehrter Herr Kraus!
Es liegt mir fern, die auf Seite 7 der letzten »Fackel« abgedruckte Kritik einer Leserin verteidigen zu wollen, aber mich schmerzt der Zweifel, ob nicht die zu ihrer Widerlegung angeführten Zitate einer guten Sache dadurch einen schlechten Dienst leisten, daß sie den Kern eines an sich gewiß unberechtigten Tadels nicht ganz treffen. Es scheint mir nämlich zwischen den Versschlüssen »rosinfarben«, »Totschläger« und: »Hindernis«, »ängstigtest«, »erwartete«, »Fröhlichen«, »Schuldigen«, »Himmlische«, »Iphigenien« ein Unterschied zu bestehen, der den Wert dieser Zitate als Belegstellen für »rosinfarben« und »Totschläger« einigermaßen verringert. Die angeführten Verse von Shakespeare und Goethe schließen durchwegs nach einer betonten Stammsilbe mit zwei tonlosen Nebensilben, von denen die letzte – besonders im Vers – unwillkürlich doch einen ganz schwachen Ton (im Verhältnis zur vorletzten) erhält, da bei aufeinanderfolgenden Nebensilben Tonhöhe und Tonstärke wellenförmig ab- und zunehmen. Das Schema dieser Versschlüsse wäre etwa: [???]. In den Wörtern »rosinfarben« und »Totschläger« sind aber die beiden letzten Silben nicht gleichwertig, sondern die vorletzte Silbe trägt als Stammsilbe einen deutlichen Nebenton: [???]. Daher kann die letzte Silbe keinen noch so schwachen Nebenton auf Kosten der vorletzten Silbe erhalten.
Ich erlaube mir, nochmals hervorzuheben, daß mein Bedenken keineswegs die von jener Leserin beanstandeten Verse, sondern nur die Anführung der Belegstellen betrifft.
In aufrichtiger Verehrung
– –
*
Motto:
»Die unangenehmste Begleiterscheinung großer Menschen ist ihre Überhebung über die kleinen.«
Maria Wörth, 6. Okt. 1920
Geehrter Herr!
Die Aufklärung, die Sie zwei Leserinnen in der »Fackel« Nr. 551 unter »Druckfehler« S. 7, erteilen, beruht auf einem Irrtum. Sie nennen den Vers der »Apokalypse«:
Und die Haut des Tiers,
Auf dem sie sitzt, ist ganz rosinfarben
[Fackel 546–550, S. 79, letzte Zeile]
einen 4 füßigen Jambus mit 2 schwachbetonten Nachsilben. Dies trifft zwar für Ihre Beispiele zu, etwa bei Goethe:
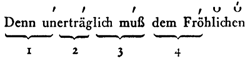
wobei die Nachsilben
![]() zwar schwach, aber immerhin doch mehr den Ton auf der 2. Silbe haben.
zwar schwach, aber immerhin doch mehr den Ton auf der 2. Silbe haben.
Der Vers »rosinfarben« hat aber folgendes Tonbild:
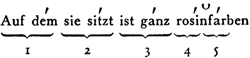
Hier ist im Versende »rosinfarben« die erste der schwachbetonten Nachsilben: -fárben betont, in den von Ihnen angeführten Beispielen dagegen bloß die zweite Silbe.
Sowohl Ihre Skandierung wie die der Leserinnen ist eine falsche, der Vers stellt nicht den 4 füßigen Jambus dar, sondern die eigenartig wunderbare Wirkung, durch das mitgeteilte Erlebnis vollauf gerechtfertigt, mag sie auch bloß skandierenden Lesern mißfallen, liegt bloß darin, daß sich eine Silbe »sin« über zwei Verstakte erstreckt. Sie geht von der Hebung des vierten Jambusfußes in die Senkung des fünften über. Mit » far-« wird der Ton, wenn auch schwach, aber immerhin doch wieder gewonnen, mit der tonlosen Endsilbe »ben« verklingt der Vers.
Die von Ihnen angeführten Beispiele können mit diesem Vers keineswegs in eine Parallele gezogen werden – sie sind klanglich vollkommen regelmäßig.
Mag diese Richtigstellung auch an sich unbedeutend sein, angesichts der Ausführlichkeit, mit der Sie die Einsenderinnen, zum Teil unrichtig, belehrten, schien sie mir nicht überflüssig.
Sie haben hierdurch bewiesen, daß der Künstler über sein Kunstwerk hinaus nicht Interpret seines Erlebens sein kann.
Mit größter Hochachtung
– –
Was hier – in der Hauptsache – vorgebracht wird, ist ebenso richtig wie falsch, und nichts wäre verlockender als zu zeigen, daß solches im Sprachgebiet möglich ist, wobei sich auch beweisen mag, daß der Künstler über sein Kunstwerk hinaus ein weit besserer Interpret seines Erlebens sein kann als der Metriker, der recht hat. Denn die Wissenschaft versagt dort, wo sie sich anstellt und anstellen muß, von diesem Erleben losgelöste Materialwerte in ihrer Unveränderlichkeit zu behaupten. Wenn ich mich zur Verteidigung einer Stelle, die auch die Meinung der Briefschreiber als unanfechtbar oder gar als ein Plus an Wert gelten läßt, solcher Belegstellen aus Goethe und der Schlegel'schen Übersetzung bedient habe, die sie ihnen nicht zu belegen scheinen, so hätten sie doch versuchen müssen, hier auf ein Gemeinsames zu kommen, das heißt zu prüfen, ob ich nicht ein Gemeinsames darstellen wollte, bei dem dann graduelle Unterschiede der Geltung ohne Belang wären (da sich ja bei eindringenderer Lektüre gewiß noch passendere Stellen finden ließen, solche oder mehr von solchen, wo eine an und für sich stark betonte Silbe mit tiefer Absicht in die Senkung gerät). Denn daß »farb« in farben als Stammsilbe stärker ist als »lich« in lichen, das wird mir doch wohl kaum entgangen sein. Aber wenn angenommen wird, daß von zwei tonlosen Nebensilben die letzte »besonders im Vers, unwillkürlich doch« einen Ton erhält (wiewohl dieses »en« gar nichts zum Gedanken beiträgt), so könnte ja – besonders im Vers – auch der Willkür, die eine an und für sich so starke Silbe wie »farb« zu einer unbetonten macht, etwas von einer Notwendigkeit eignen. Aber davon ganz abgesehen, erscheint die Anwendbarkeit jener Beispiele schon darin begründet, daß ja gegenüber einer Kritik, die nur skandiert und wenn's nicht klappt, skandaliert, doch nicht der Wert, sondern nur das Recht der Anomalie durch den Hinweis auf andere Anomalien, nur ihre Möglichkeit, nicht ihre Besonderheit dargetan werden sollte. Und daß, selbst wenn in »Fröhlichen« der Ton wieder ein wenig ansteigt, vor jenem Horizont eben diese Verse mangelhaft wären (weil man ja eben doch nicht »fröhlich en« sagt), und daß sie es nur nicht sind, weil sie von Goethe sind, darüber dürfte wohl kein Zweifel bestehen. Da ich aber gewußt haben mag, daß eine Stammsilbe wie »farb« an und für sich einen stärkeren Ton hat als die zweifellos ganz nichtige Silbe »lich«, so muß ich doch wohl gemeint haben, sie hätte ihn in meinem Wortmilieu verloren. Denn wenn sie ihn nicht verloren hat, so müßte wenigstens die erste Zuschrift die Konsequenz jener banalen Kritik haben, den Vers für mangelhaft zu halten. Es wäre denn, daß sie zu meiner Entschuldigung vorbrächte, worauf ich selbst schon hingewiesen habe: daß es im sogenannten fünffüßigen Jambus weder auf die fünf Füße noch durchaus auf den Jambus ankommt, daß vielmehr – einzig bei diesem Versmaß – die Andeutung seines Charakters genügt, ja daß oft die Abweichung der Kraft des Verses zugute kommt (Schlegel: »Rassle nach Herzenslust, spei Feuer, flute Regen!«). Der andere Einsender rechtfertigt die Unregelmäßigkeit zwar als einen Wert, welchen ich mir aber nicht zuerkennen lassen könnte, aus dem einfachen Grunde, weil ich ihn geradezu für eine Minderung des Wertes halte, der ihr tatsächlich zukommt. Ehe ich nun den Interpreten meines Erlebens darüber aufkläre, möchte ich beiden das Zugeständnis machen, daß ich damals tatsächlich vorwiegend Verse zitiert habe, an denen – den Forderungen von Leserinnen zuwider, die auf blitzblank eingearbeitet sind – die Verwendung unbetonter oder schwachbetonter Silben als Hebung gezeigt werden kann (die letzte in »Fröhlichen«). Darin schien die Analogie der letzten in »rosinfarben« gelegen, und nichts bliebe zu beweisen, als daß der Vers mit dieser Unebenheit fertig wird, weil die vorletzte ton- wie jambusgemäß in der Senkung steht. Vielleicht war es irreführend, jene zu belegen statt diese zu verteidigen. Daß es hier bloß auf das Recht jeder jambischen Anomalie ankommen sollte, ging umso deutlicher aus solchen Zitaten hervor, in denen die zweifellos am stärksten zu betonende, gedanklich wichtigste Silbe als kurze verwendet wird, wie in:
Den Ausgang schaffte durch
mehr Hindernis
Als zwanzigmal dein Zwang.
Oder:
Der mißversteht die Himmlischen, der sie
Blutgierig wähnt – –
Noch stärker:
Kraftvolles Mark – –
Hat den Rückkehrenden – –
Nun sind dies ohne Zweifel Fälle, wo an sich starkbetonte Silben auch an der Stelle, wo das Versmaß die Kürze verlangt, stark gesprochen werden müssen, wo aber eben die Jambuswidrigkeit dem Vers die Fülle gibt. Eine Silbe kommt in die Senkung, ohne darum in die Versenkung zu geraten. Auch diese Fälle unterscheiden sich von dem meinen, indem hier gerade durch die gedanklich richtige Betonung die Auflösung des jambischen Charakters erfolgt, während bei mir eine an sich betonte, aber in der Zusammensetzung entwertete Silbe sich ihm anpaßt, die erst wenn sie den Ton hätte, der von ihr fälschlich verlangt wird, (rosi nfarben) den Jambus so alterieren würde, wie es bei Goethe tatsächlich geschieht (den Rückkehrenden). Aber wird hier nicht auch die Verwandlung an sich starkbetonter Silben in unbetonte oder schwachbetonte an dem Schicksal der Stammsilbe »kehr«, »gier«, »voll« ersichtlich? Diese Verwandlung vollzieht sich zugleich mit der Abweichung vom jambischen Charakter, der nur gewahrt bliebe, wenn »Rück«, »Blut«, »Kraft« fälschlich unbetont wären. In »rosinfarben« ist mehr der Jambus als die Stammsilbe anerkannt und es wird sich erweisen, daß sie von Natur hinreichend schwach war, um sich in seine Kürze zu fügen, so daß ich von der Erlaubnis, »farb« jambuswidrig zu betonen, weil es eine Stammsilbe ist, keinen Gebrauch machen könnte. Auch muß ich leider die freundliche Erklärung ablehnen, daß sich die Silbe »sin« über zwei Verstakte erstrecke und in die Senkung des fünften Fußes übergehe, so daß »far« eigentlich dessen Hebung sei und »ben« nur die elfte Silbe, die dem Jambus als sechstes Rad so häufig nachhängt. Es war durchaus nicht so erlebt:
![]()
Sondern anders, »ro si-in« (das keine Dehnung, sondern Brechung wäre) bedeutet das Erlöschen der Farbe, vollends durch die Ermöglichung des » far-ben«. Die Farbe ist nur in » rosinfarben« erhalten. Wenn oben der Versbeginn »Kraftvolles Mark« jambuswidrig daktylisch gesprochen wird, so wäre das Schicksal der an sich so vollen Silbe »voll«, die tonschwach wird, aber auch in der Hebung mit Recht versinkt, zur Analogie heranzuziehen. Wohlverstanden, nicht was die Versmaßwidrigkeit, sondern was die Tonverwandlung anlangt, die ja dem Versmaß gerecht wird. Es ist aber eben die Verwandlung, die mit »farb« vor sich geht. Wenn die Einsender zwischen dieser und dem »sin« die Relation von betonter zu überbetonter Silbe walten lassen, so wollen wir getrost die zwischen einer schwachbetonten und einer betonten annehmen. Es scheint hier ja immer die Gefahr zu bestehen, daß eine Verwechslung an und für sich betonter Silben mit den im Wort, dieser mit den im Vers betonten in die Debatte spielt, und man denke, wie schwierig eine solche wird, wenn eben der Wechsel, den der Silbenton durch das Milieu erfährt, ihr eigentlicher Gegenstand ist. Vielfach verwirrt in der Enge terminologischer Behelfe, mag sie schließlich Erkenntnisse fördern, die man vorweg nicht bestreitet und immer schon anerkannt haben möchte, bevor sie erst jenes Rätsel herausstellen, zu dem sich in Dingen der Sprache alle Klarheit auflöst. Denn wie nur der mit der Sprache »umgehen« kann, der am weitesten von ihr entfernt ist, so wird, je näher man ihr kommt, das Gefühl der Befremdung zunehmen und mit ihm der Respekt. Was zur Not mit dem Satz zu gelingen scheint, scheitert an dem Wort, und einer Silbe auf den Grund zu kommen, könnte schon den Kopf kosten, weshalb auch nicht vorausgesetzt werden soll, daß Leute, die ihn zwar nicht haben, aber behalten wollen, Zeit und Lust an solche Untersuchungen wenden.
Daß das Wort im Vers vielfache Abenteuer zu bestehen hat, wird dem nicht gesagt sein, der es als totes Instrument handhabt, und daß die Silbe im Wort allerlei Einbuße erleidet, brauchte dem Andern eigentlich nicht erst an Beispielen bewiesen zu werden. Warum aber sollte sich gerade die Silbe »farb« diesem Prozeß widersetzen, wo doch alles danach angetan ist, sie ihm zuzuführen? So sehr, daß sie sogar wieder die Verstärkung der Endsilbe »en«, ganz wie in »Fröhlich en«, zuläßt und wenn sie dazu doch zu stark wäre, mit ihr eben »zwei schwachbetonte Nachsilben« bildet. Man denke nur: »farb« so entfärbt, daß dieses Ende möglich ist! Und doch ist es so, und dies hat es einzig und allein der Kraft des »rosin«, das alles »farbene« an sich zieht, zu danken. Denn es spottet der Tonregel und brennt wie die leibhaftige Orientsonne. Und damit wären wir bei dem Problem selbst, das eben als im Bereich des Sprachgeistes liegend von der sprachwissenschaftlichen oder metrischen Untersuchung – auf betonte Stammsilben, nach denen keine weitere Betonung mehr möglich sei – überhaupt nicht berührt wird. Was in einem Vers betont und was unbetont ist, entscheidet nicht das Gewicht der Silbe als solcher, sondern das Gewicht der Anschauung, das ihr in der Zusammensetzung und vollends in der Verbindung der Worte bleibt und vom Gedanken zuerkannt wird; entscheidet Art und Fülle der Vorstellung, die mit ihr übernommen ist; entscheidet das nächste Wort so gut wie das voraufgehende und wie die Luft zwischen den Worten, wie alle Aura, die um dieses, jenes und um alle umgebenden Worte spielt: entscheidet der Gedanke. Da kann es denn wohl geschehen, daß die stärkste Silbe, ja das stärkste Wort völlig tonlos wird, von allem, was sonst leer wäre, übermeistert.
In diesem Zusammenhang erscheint wohl ein Vers betrachtenswert, der in Beer-Hofmanns »Jaákobs Traum« (wo schon im Titel eine betonte Stammsilbe vorkommt) zu finden ist. Es sei hier über die gedankliche Bedeutung einer Dichtung nicht geurteilt, die die Bestimmung des auserwählten Volkes etwa als die eines schwergeprüften Vorzugsschülers deutet, welchen Gott, um ihm seine Gunst zu bezeugen, immer wieder durchfallen läßt: ein Gott, der durch einen prügelpädagogischen, fast sadistischen Dreh beglaubigt wird, ohne den der wahre Genuß schließlicher Herrlichkeit dem Beglückten so wenig erreichbar ist wie dem Beglücker: »Ich will ja nur, mein Sohn, mich dir so tief verschulden, / Daß ich – zur Sühne – dich erhöh'n vor allen darf!« Es ist gewiß ebenso interessant, daß Gott das süße Geheimnis dieser Methode dem Partner offenbart, wie daß er sprachlich ein rein zivilrechtliches Verhältnis statt des »sich an einem verschulden« setzt, wobei freilich die Scheu vor dem Bekenntnis, daß Gott sich an Menschen versündigen könne, mitgewirkt haben mag. Sie wagt sich immerhin zu dem Ausspruch vor, daß Gott sich für das, was er seinem Volk antut, eine »Sühne« auferlegt und dieser Sühne zuliebe die Tat begeht, und es ist natürlich in sich selbst unmöglich und ein Begriffszeugma trübster Art, Gott nicht nur unter dem Maß einer menschlichen Ethik und als deren abschreckendes Beispiel zu denken, sondern eben aus einer ethischen Anschauung, die vom Verhältnis der Menschen zu Gott bezogen und in ihm verwurzelt ist, das Verhältnis Gottes zu den Menschen darzustellen. Es soll auch nicht die dichterische Kraft der Verse, die auf solchem Gedankengrund gesprossen sind, gewertet, höchstens erwähnt sein, daß sie manchmal doch bedenklich an die Sprache der Neuzeit erinnern, indem ihre Sprecher zum Beispiel »daran« vergessen haben, daß sie eigentlich alte Juden sind. Alles in allem ist diesen Versen weniger der Ursprung schöpferischer Gnade als jener ehrenwerten Gesinnung abzumerken, die sie ins Weltall projiziert, wenngleich sie sich in der Proportion so gefährlich vermißt. Ohne zur Sühne dafür vor allen erhöht zu sein, ist dieser Dichter doch durch die redliche Mühe, die er an seine Arbeit wendet, vor den andern auserwählt, und wer wäre berufener, für Jaákobs Traum zu zeugen als einer, der jeweils sieben Jahre um die Muse geworben hat, und mögen es auch nicht die sieben fettesten gewesen sein. Und die Betriebsferne, in der solch eine Leistung zustande kommt, zeugt für ihn selbst, wie auch die nicht verkennbare Spur eines redlichen Willens, dem Wort nahezukommen. Eines ist darin enthalten, das, wenngleich es kein Kunstwerk ist, ganz gewiß seinen Autor wissend und bemüht zeigt um den Punkt, worin Gedanke und Wort (oder Nichtwort) sich zu rätselhaftem Ineinander verketten (oder verschlingen). Schlichter Dilettantismus würde den Vers nicht wagen, an dessen Ende es heißt:
– wohin Wort nicht mehr dringt.
Eine stärkere Stammsilbe als »Wort« ist nicht denkbar und sie ist hier doch so eingesunken, daß das »Nichtmehrhindringen« seine ganze Anschaulichkeit (im Nichthörbaren) eben von dieser Auslöschung des Wesentlichsten empfängt. Wobei es gewiß fraglich bleibt, ob die Artikellosigkeit von »Wort«, diese Leibhaftigkeit des Wortes, nicht ausschließlich zu dessen Verstärkung gereichen darf und ob überhaupt die Verneinung seiner Wirksamkeit durch die Versetzung ins Unbetonte erreichbar und möglich ist; ob das Nichthören so gestaltet sein kann, daß das Nichtgehörte auch nicht mehr gesehen wird, und ein Verlust noch fühlbar ist, wenn mit dem Wert auch dessen Anschauung verschwindet. Zu sprechen ist es nicht, weder bei völliger, dem Metrum angepaßter Versenkung von »Wort« noch bei erneut ansetzender Hebung, der doch wieder das »nicht mehr dringt« alle erstrebte Anschauung zum Opfer brächte. (Durch die Tonhebung wäre es das Muster einer kaum zu bewältigenden Jambuswidrigkeit, doch indem sie dem »Wort« als dem Vorgestellten den Ton zuweist und als dem Nichtgehörten die metrische Kürze, ein merkwürdiger Versuch, dem zweifältigen Erlebnis zu entsprechen. Ich hatte aus dem Gedächtnis zitiert. Ein Blick in den Text zeigt, daß die Tonhebung, die der Autor so oft durch das primitive Mittel des Sperrdrucks gegen das Versmaß durchsetzen will, tatsächlich nicht beabsichtigt ist. Im Gegenteil sperrt er, um nur ja die Entwertung von »Wort« zu sichern, das »nicht«. Im gegebenen Wortmaterial wäre ja vielleicht: »wo Wort nicht hin mehr dringt« eine Möglichkeit, die das Wesentliche der Entfernung und die Entfernung des Wesentlichen glücklicher paaren würde.) Immerhin ein lehrreicher Beleg für die Ansicht, daß ein künstlerischer Wille auch die völlige Tonverwandlung nicht scheut und daß er sich fast mehr an dem Wagnis als am Gelingen beweist.
Denn was kümmert es den Gedanken, daß eine Silbe als Stammmsilbe einen »deutlichen Nebenton« hat? Sie hat ihn eben nicht mehr. Sie ist eben nicht mehr »betont«. Nur die rationalistische Ansicht, die sie aus dem Gefüge herausnimmt, wird den Ton reklamieren, ihn vor Gericht stellen; und mit Recht, denn wenn die Silbe einmal draußen ist, so hat sie ihn zu haben. Aber sie hat ihn nur für die Wortforschung und nicht für die Sprache. Jene würde, da »farb« ja unter allen Umständen Stammsilbe ist, etwa nicht den geringsten Unterschied zwischen »farben« und »farbig« wahrnehmen; und doch liegt so viel dazwischen, daß, wenn es »rosinfarbig« hieße, wirklich bloß die Möglichkeit bestünde, das »sin« über zwei Verstakte zu erstrecken, da »farb« tatsächlich betont wäre. Nur eben, daß »rosinfarbig« das schlechtere Gedicht ist, und daß man das »sin« auch über vier Verstakte dehnen könnte, ohne die Farbe, auf die es ankommt, zu gewinnen. Sie gewinnt ihre Kraft durch das schwache »farben«, während das stärkere farbig und das scheinbar unveränderte »rosin« zusammen nicht mehr als ein zusammengesetztes Wort ergeben. In »farben« und in »farbig« ist die Silbe gleich stark; aber in diesem tritt die Farbe äußerlich hervor, jenes, erst in der Zusammensetzung mit der Farbe möglich und wirksam, ist der Hintergrund, auf dem sie in Erscheinung tritt. Es ist sonderbar wie alles, was sich durch die Sprache begibt, aber es ist so und es ist; es ist eben wunderbar. Bei einer Farbe, die weniger Farbe hat, würde sich »farben« mehr zur Geltung bringen, wie etwa bei »türkisfarben«, »opalfarben«, während rubin- oder rosinfarben ganz gefährliche Farben sind und so gell und grell brennen, daß das »farben« selbst verlöschen und verstummen muß. Dem Einwand, daß eben der Vokal der Endung »in« diesen Prozeß bewirke, kann nur mit der Versicherung begegnet werden, daß dies ganz richtig ist und daß die Sprache schon gewußt haben wird, warum sie diese Farben so ausklingen läßt. Ich könnte es zwar nicht beweisen, wohl aber beschwören, daß kein Wort anders aussieht als sein Inhalt klingt und daß jedes so schmeckt wie es riecht. Wenn ich meine, daß die letzten zwei Silben in dem Wort »smaragdfarben« mehr Ton und mehr Farbe behalten, weil sie weniger an die ersten abgeben müssen als in dem Wort »rosinfarben«, und wenn man mir darauf antwortet, daß eben der Wirbel der Konsonanten den Tonfall hemme und dadurch »farben« selbständiger werde als dort wo es einer stärkeren Anziehung durch die vorangehende Silbe ausgesetzt ist, so möchte ich mich, ohne dabei gewesen zu sein, auf den ersten Mund berufen, der »Smaragd« gesagt hat, als das erste Auge ihn sah, und gar nicht anders konnte als ihm diese Konsonanten abzusehen, diese Farbe abzuhören. Und könnte das Kind anders, wenn ihm die Verbildung von Generationen nicht die dichterische Kraft verkümmert hätte, Anschauungen zu Lautbildern zu formen? Jedes Wort ist ursprünglich ein Gedicht und was den Vollbegriff des Dings umfaßt, ist ihm nur abgelallt. Wäre es anders und wäre die Sprache wirklich das, wofür die Menschen sie halten, ein Mittel, sich nicht mit der Schöpfung, sondern über sie und über sie hinweg zu verständigen und dadurch zu solchem Einverständnis zu gelangen, das jegliche Zwietracht bedeutet, so wäre es gleich besser, sich jener Konventionen, jener akustischen Stenogramme zu bedienen, die auf einem Kongreß beschlossen werden, damit ein größerer Umkreis von Menschheit des Segens teilhaftig werde, vom Erlebnis der Natur entfernt zu sein. Solange aber Sprache keine Verabredung ist, wird sie dem Geist noch aufbewahren, was sie dem Verstande vorenthält, und wenn jener wissen wollte, warum der Purpur den Ton auf der ersten Silbe hat, so brauchte er nur den Purpur zu befragen. Aus dieser Eigentümlichkeit, die eben von seiner besonderen Farbe kommt, ergibt sich, daß wenn er sich mit dem Wort »farben« zusammensetzt, dieses wieder auftönt und also aufleuchtet; denn es hat Raum zur Entwicklung, während es an die in der letzten Silbe betonten Farbnamen alles abgibt. Wie auch ähnlich, wenngleich nicht so selbstlos an die einsilbigen (in »goldfarben« etwa dürfte eher eine Verteilung statthaben). Ein Beispiel dafür, welcher Kraft es in jener andern Verbindung fähig ist, ist Gerhart Hauptmanns
Laßt feuerfarbne Falter über ihr
am malachitnen Grün des Estrichs schaukeln.
Hier kann wahrlich nichts betonter sein als »farb«, wiewohl doch schon »feuer« genug brennt. Solchen Schicksalen ist das Wort, ist selbst die Silbe ausgesetzt. Je mehr ich »farb« in »rosinfarben« betonen wollte und wenn ich dafür auch »rosin« endlos dehnte, desto blasser würde dieses, jenes, beides zusammen. Doch »sin« ist nicht als gedehnt (oder gar gebrochen), sondern nur als gell eindringender Ton gedacht: dann verschwindet alles weitere von selbst und zu Gunsten des Sinn-Eindrucks, der erreicht werden soll.
Und wenn wir schon in diesem Turnier mit Silbenstechen und mit Haarespalten befangen sind – keinen stolzeren Sieg, keinen größeren Gewinn kann es geben als in solchem –, dann sollen auch gleich »Totschläger« den Ausgang fördern. Daran läßt sich vielleicht noch besser dartun, wie problematisch der absolute Tonwert einer »Stammsilbe« ist, mit dem schon vor dem Versgedanken der tägliche Hausbrauch fertig wird. Wieviel von den um ein Wort gelagerten Vorstellungen in den Gedanken eingeht, davon allein hängt seine Tonwertigkeit ab. Ganz außerhalb des Versgefüges ist in »Totschläger« die ganze Kraft der Vorstellung schon von der Silbe »Tot« absorbiert, ohne jede Rücksicht darauf, daß die zweite Silbe eine Stammsilbe vorstellt, die in dem Verbum »schlagen« noch von ausschlaggebender Wichtigkeit ist. Nur in einer einzigen Bedeutung wächst dieser Stammsilbe eine Kraft zu, die sogar der Stärke der Silbe »Tot« gleichkommt: in der Bezeichnung der Waffe, die »Totschläger« heißt, wo »Schläger« real erlebt ist, »Tot« nur ein Ornament, das den möglichen oder erstrebten Effekt der Waffe verherrlicht. Wer würde bei »Tondichter« behaupten, hier habe der Dichter den Ton? In »Schriftsteller« ist »stell« zweifellos eine an und für sich betonte Stammsilbe, aber sie hat auch nicht die Spur eines Eigenlebens mehr, da alle Vorstellung der Schrift und nicht dem Vorgang ihres »Stellens« eignet; zum Unterschied von »Schriftführer« und vollends von »Schriftsetzer«, wo alle Vorstellung, also auch alle Betonung dem »Setzen« angehört, so sehr, daß das »Setzen« (im Gegensatz zum Führen und gar zum Stellen) schon zureicht, um die Tätigkeit sichtbar zu machen. Es könnte also am Schluß eines jambischen Verses weit eher der halbwertige »Schriftsteller« als der vollwertige »Schriftsetzer« stehen (wiewohl dieser durch die Hilfe, die er jenem angedeihen läßt, mit der Zeit auch an Position einbüßen wird). Oder nehmen wir, um in der Sphäre der Literatur zu bleiben, das Beispiel »Einbrecher«. Gewiß hat die Silbe »brech« eine Kraft, in der ja das Handwerk als solches ursprünglich beruht. Trotzdem wird die Anschauung nur von der Silbe »Ein« regiert als von dem »Eindringen« ins Haus, wohin einer, um ein Einbrecher zu sein, ja auch ohne Zerstörung gelangen kann. »Einschleicher« dagegen, wo das Wort mit der Vorstellung noch kongruent ist, würde eine Entwertung der Stammsilbe keineswegs zulassen. (Ebensowenig »Ausbrecher«, woran die Vorstellung der unmittelbaren Kraftanwendung des Gefangenen haftet. Er bricht aus dem Kerker, jener gelangt in das Haus.) Welche Tonverschiebung – an und für sich und wie erst für die Position im Satz- oder Versbau – ein Wort durchmachen kann, zeigt es, wenn es zugleich einen Beruf und einen Namen bedeutet. Während etwa in »Buchhändler« mehr die Vorstellung des Buches, in »Buchbinder« mehr die des Bindens lebendig ist, kommt diesem als Namen weder die eine noch die andere Vorstellung mehr zu, wodurch sich die Betonung der Silbe »Buch« nur automatisch als der führenden ergibt. Der Name wäre am Schluß des zehnsilbigen jambischen Verses eher möglich als die Berufsbezeichnung. Ist in einem Namen wie »Goldberger«, der vielleicht noch die Vorstellung von Goldbesitz wecken kann, auch nur die Spur einer Anschauung goldener Berge oder des Bergens von Gold, wovon er sich herleiten mag, vorhanden? Nicht einmal im Wiener Tonfall, der sich auf der zweiten Silbe solcher Komposita auszuruhen pflegt. Wo trotz der begrifflichen Kluft zwischen Wort und Wort die äußere Betonung identisch ist, würde natürlich einzig und allein von der Vorstellungsfülle, die der Silbe innewohnt, die Entscheidung abhängen, welchen Ton sie im Vers empfängt. (Wer die Relativität des Silbenwerts leugnet, solange sie ihm unvorstellbar ist, braucht vor allem nur an das Vernichtungswerk erinnert zu werden, das der jeweilige genius loci an dem Vorstellungsinhalt von Straßennamen geleistet hat. Es gibt gar keinen Ort, der vom Sprecher so entfernt wäre wie die seinem Namen assoziierte Vorstellung von dessen ursprünglichem Sinn. Wenn der Wiener überall an den Franz Joseph gedacht hätte, am Franz Josephskai hat er es bestimmt nicht getan, und nie wären ihm auf dem Schottenring die Schottenpriester eingefallen, selbst wenn er eben noch in der Schottengasse sich ihrer vielleicht erinnert hätte. Der in der Gonzagagasse behütete Name dürfte dem Chef einer Inkassogesellschaft eignen und die Zelinkagasse, an die man wieder vor dem Zelinka-Denkmal nicht denkt, nach einem Engrossisten benannt sein. Hat jemand schon einmal in der Kärntnerstraße an das Land Kärnten gedacht, wenn nicht auf dem Umweg von der Sünde zur Alm, wo es keine gibt? Bei der Vorstellung des Bisambergs würde man eher vermuten, daß es dort Moschustiere gibt als daß das Wasser dort einmal bis am Berg gestanden ist, während das österreichische Gehör bei Vorarlberg eher ein Radl über den Berg gehen hört, als daß es sich ein vor dem Arlberg gelegenes Land vorstellt.) Es hängt alles davon ab, ob die Silbe dem erlebten oder dem gebrauchten Wort angehört, ob noch Vorstellungsmark oder nur terminologische Kruste vorhanden ist. In »Ausrufer« als einer Umschreibung für Sensationsjournalist hat »ruf« (analog in »Marktschreier«) keinen Ton mehr, wohl aber dort, wo die reale Vorstellung eines, der soeben etwas ausgerufen (auf den Markt geschrieen) hat, das Wort bildet. Und die schöpferische Kraft, die hier am Werk ist – im Ausdruck dessen, was erlebt wird –, ist keine andere als die, die den Vers bildet. Hier könnte sich freilich der Einwand melden, daß im echten Gedicht das Wort doch immer neu erlebt und wenn die Erlösung aus der Erstarrnis nicht mehr möglich ist, die Worthülse eben keinen Platz findet. Das ist so richtig wie falsch, und unbedingt wahr bleibt nur, daß der Dichter wie die Zeugenschaft des lebendigen Worts so auch die seines Absterbens hat, womit aber keineswegs gesagt ist, daß er nicht gerade da schöpferisch würde. Wie er ein neues Wort (was mit aller Verachtung des prinzipiellen Neugetönes gesagt sei) nur so ins Dasein bringen wird, daß es die Dagewesenheit schon mitbringt, und wie er das alte so setzen kann, als ob es just ins Leben getreten wäre, muß es ihm auch gelingen, das tote Wort so tot sein zu lassen, wie es die Sphäre gebietet, und ist die Erstorbenheit der Welt sein Erlebnis, dann hat er keine Phrase verwendet und keine jener Redensarten, die ein Ornament des Sprachgebrauchs und ein Aussatz der Kunst sind. Wo keine Vorstellung mehr ist, kann eben dies für die Wortwahl entscheidend sein und das Verblaßteste von eindringender Bildkraft. Der Dichter erlebt das Wort im Zustand der Wirksamkeit, die es in der Zeit hat, und er wäre keiner, wenn es im Gedicht lebloser wäre als in der Zeit. Darum bewährt das echte Gedicht auch die Fähigkeit, den Vorstellungsgehalt des Wortes durch die Schäden und Veränderungen eines Gebrauchs hindurch, der der Sprache ihre Jahresringe ansetzt, indem er die Assoziationskraft abschwächt, voll zu erhalten, wenngleich das so konservierte Wort nicht mehr die Macht hat, außerhalb des Gedichts zu wirken. Alle hier angeführten Beispiele für Tonkraft und deren Veränderlichkeit verstehen sich als Vorstellungsinventar nur vom Gesichtspunkt der Erbschaft, die die Generation angetreten hat. Für die Kunstfähigkeit des Worts entscheidet nichts außer der Fähigkeit des Künstlers: alt oder neu, tot oder lebendig, edel oder trivial, deutsch oder fremd – das Wort ist nie das, was es gilt, sondern was es im Gedicht wird, nicht wie es aussieht, sondern wo es steht. Doch auch außerhalb des Gedichts ist ein und dasselbe Wort ein verschiedenes Gedicht. Es kann hausgebacken und hausbacken sein: zu Haus erschaffen, besser als gewöhnliches Bäckerbrot, oder nüchtern, prosaisch wie nur alles was im Umlauf ist. (Aber wie ich's hier sage, verschränken sich Ding und Metapher. Betont wird das »Haus« eben dort sein, wo der Ausdruck die Gewöhnlichkeit bezeichnet; im realen Gebäck auch das »backen«.) Wie »altbacken« ist eben in diesem die Vorstellung, die einmal neu war! Auch die Stammsilbe »voll« kann sich nicht immer auf ihre Bedeutung verlassen. In »kraftvoll« hat sie nicht mehr die Kraft, die der ersten Silbe zukommt. Wie anders in »drangvoll«, wenngleich sich diese gedrängte Fülle beiweitem nicht mit jener vergleichen läßt, die »los« in »kraftlos« bewahrt, während es wieder in »rastlos« mehr an die führende Silbe verliert. Man beachte die Wertverschiebung, die zwischen »wertvoll« und »wertlos« vor sich geht. Hier wie in »kraftvoll« ist der Positivbegriff nur eine Fortsetzung der Kraft, in »kraftlos« muß sich der Negativbegriff gegen sie durchsetzen. Er ist deshalb so wenig »tonlos« wie in diesem selbst. »Stimmittel« und »Stimmlage«: sollte an und für sich »mitt« nicht wenigstens so stark sein wie »lag«? In Wahrheit wiegt jenes nichts im Vergleich zu diesem. Klar entscheidet die gedankliche Leistung, die das Wort zu jenem, mit dem es zusammengesetzt ist, beiträgt. »Stimmittel« ist mehr als »Stimmlage«, aber das »Mittel« führt begrifflich der Stimme nichts hinzu, die »Lage« alles: denn die Stimme ist schon das Mittel, aber hat erst die Lage; Stimmittel ist nur eine Determinierung der Stimme als akustischen Werts, also eine begriffliche Fortsetzung, Stimmlage ist fast eine Definition. Füglich könnte man wohl jenes Wort, aber nicht dieses daktylisch setzen. (Und schon gar nicht »Stimmfärbung«, wiewohl es doch meine Stammsilbe hat.) Ähnlich: »Parkmauer« und »Parkgitter«. Jene könnte begrifflich der Park selbst sein, der demnach den Ton trägt. Sie unterscheidet sich sogleich von andern Mauern. »Parkgitter« wird nicht von andern Gittern unterschieden, sondern von allem andern, was zum Park gehört. Hier tritt – in Verbindung mit Park – ausschließlich die Vorstellung des Gitters hervor, so wenig es sich als solches von anderen Gittern unterscheiden mag. Darum könnte wohl die Parkmauer, aber nicht das Parkgitter synekdochisch für »Park« gebraucht werden; es ist und bleibt ein Bestandteil, also ein Teil, der nicht fürs Ganze stehen kann. In »Blutgierig« ist so viel von Blut und so wenig von Gier mehr vorhanden, daß es in jenem Vers der Iphigenie nicht jambusgemäß heißen kann: Blut gierig wähnt – –. Läge ihm aber nicht bloß die Abstraktion des Gottes, der Blutopfer fordert, sondern die Anschauung eines Sadisten, der sich am Blut berauscht, zugrunde, so wäre diese Betonung oder Mitbetonung im Vers wohl möglich. Fast wäre es bei »geldgierig« der Fall, wo noch der persönliche Anteil des Gierigen gespürt wird. Solange der »Blutdürstige« nicht das Blut trinkt, ist seine Stammsilbe nicht ernst zu nehmen und nur das Blut, das er vergießt, beträchtlich. »Blutrünstig« würde die Senkung der zweiten Silbe nur in der gebräuchlichen aktiven, also in der falschen Bedeutung des Blutdürstigen vertragen, in der das Wort eine Redensart ist, jedoch nicht in der richtigen passiven des Verwundeten, an dem noch rinnendes Blut sichtbar ist. Stammsilbe da und dort – wenn sie verwelkt ist, der Begriff pflanzt sich schon seinen Ton. Wo käme er hin, wenn man nicht »ungescheut« mehrsilbige Wörter setzen dürfte, um gerade jene Silbe fallen zu lassen, die etymologisch den Ton hat?
Ungescheut will ich es wagen, dies Wort dort so zu betonen
und zu negieren den Rest, der sich die Scheu noch bewahrt.
Wenn aber einer es scheut, weil »scheut« ihm mehr imponiert hat,
klappt's mit der metrischen Scheu, aber er ist nicht
gescheut.
Wiewohl es sicher von allen Zuschriften, die ich – mit und ohne die trostlose Berufung auf »Druckfehler« – in Sprachdingen je empfing, die weitaus würdigsten und anregendsten gewesen sind.