
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
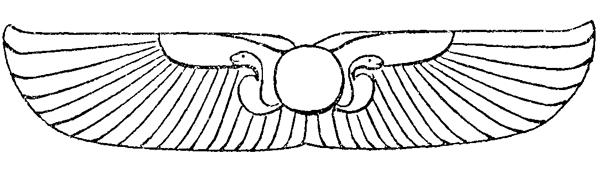
Oph, wie die alten Ägypter Theben, die tausendtorige Stadt nannten, schien unter der sengenden Sonne zu schlafen. Es war Mittag. Weißes, gleißendes Licht fiel vom Himmel auf die glühende Erde herab. Die Häuser, deren Mauern leicht geneigt waren, glühten wie Ziegel in einer Tonbrennerei. Alle Haustore waren fest verschlossen und die Fenster mit dichten Vorhängen verhängt. Gegen die Terrassen des Nils zu hoben sich Obelisken, Säulen und Dächer von der klaren Luft ab und boten mit ihren reichverzierten Kapitälen, die menschliche Antlitze und Lotosblumen darstellten, einen seltsamen Anblick.
Hier und dort neigten sich Palmen über eine Gartenmauer und breiteten ihre fächerartigen Blätter hinüber. Die Akazien, Mimosen und Feigenbäume um den Palast des Pharao warfen ihre bläulichen Schatten in das gleißende Licht. Diese kleinen grünen Inseln brachten Leben in das Bild des toten Häusermeeres.
Einige Sklaven aus dem Stamme der Mahasi, mit schwarzer Haut, affenartigem Gesicht und Gang, hatten sich der Hitze ausgesetzt, um für ihre Herren Wasser aus dem Nil zu schöpfen und trugen dieses nun in größeren Krügen an einer Stange über der Achsel heimwärts. Die Sklaven, die nur mit einer kurzen, gestreiften Hose bekleidet waren und deren schwarzglänzende Haare von Schweiß trieften, beschleunigten ihre Schritte, um ihre Fußsohlen nicht auf dem brennenden Pflaster zu versengen. Am Hafen des Flusses ruhten die Schiffsknechte in den Kabinen, in dem sicheren Bewußtsein, daß jetzt niemand kommen würde, um sich nach Memnonia überschiffen zu lassen. Hoch oben im Äther kreisten Raubvögel, deren Schreie durch die Stille tönten. Auf den Rändern der Monumente standen einige Ibisse auf einem Bein, den Schnabel in den Federn versteckt, unbeweglich, als wären sie tief in Gedanken versunken.
Durch den allgemeinen Schlaf, der über der Stadt zu liegen schien, klang aus den Mauern eines großen flachgedachten Palastes Musik. Gedämpft drangen die Töne auf die Straße, Töne eines Liedes voll sehnsüchtiger Trauer und bitterer Klage. Körperliche Müdigkeit und seelische Mutlosigkeit sprachen daraus, vielleicht auch die Langeweile dieses ewigen blauen Himmels und die phantastische Schlaffheit des glühenden Landes.
Die Sklaven, die an dem Palast vorbeigingen, vergaßen der Peitsche ihres Herrn und blieben gebannt stehen, um auf den Sang zu horchen, der von Heimweh und unausgesprochener Klage erklang und sie an die verlorene Heimat gemahnte, an ihre verlassenen Lieben und das unabwendbare Schicksal, dem sie unterworfen waren.
Woher kam dieser Gesang, dieser melodische Seufzer in der schlafenden Stadt? Welch unruhige Seele wachte hier, während alles ruhte.
Die Fassade des Palastes, von jener Ebenmäßigkeit der Linien, wie sie der ägyptischen Baukunst eigen ist, mündete auf einen großen freien Platz. Wie man an dem Reichtum des Materials, an der sorgfältigen Ausführung und den vielen Verzierungen ersehen konnte, mußte der Besitz einer Person von Adel oder einem Priester von hohem Rang angehören.
Über einem großen Erker, der in der Mitte der Fassade hervorsprang, waren kleine Galerien angebracht, die von Säulen gestützt wurden.
Der Grundstein dieser Säulen stellte offene Lotosblüten dar. Ebenso rankten sich steinerne Lotosblumen rings um die Schäfte hinauf, hier und dort ihre Blüten öffnend. Zwischen den Säulen waren kleine Fenster aus farbigem Glas angebracht.
In der Galerie, die um den Palast lief, waren große Vasen aufgestellt, deren Inneres mit bitteren Mandeln eingerieben war und die Nilwasser zur Abkühlung der Luft enthielten. Einige kleine Tischchen standen umher, beladen mit Früchten, Blumen und Bechern von verschiedener Form. Denn die Bewohner der Stadt liebten es, auf diese Weise im Freien zu essen und nahmen ihre Mahlzeiten gleichsam auf offener Straße ein.
Trat man über die Schwelle des Hauses, so gelangte man in eine viereckige Säulenhalle, in welche die Türen der einzelnen Wohnräume mündeten.
In der Mitte des Raumes befand sich ein großes, marmorumrahmtes Wasserbecken. Auf der Oberfläche des Wassers schwammen herzförmige Blätter roter und blauer Lotosblumen. Rings um das Becken waren Beete verschiedenartigster Blumen angelegt. Dazwischen spazierten vorsichtig und gravitätisch zwei zahme Störche umher, die ab und zu ihre Schnäbel wetzten und mit den Flügeln schlugen, als ob sie davonfliegen wollten. In den Ecken des Raumes entfalteten vier mächtige Bäume Zweige mit metallisch schimmernden Blättern. An der einen Seite der Halle sah man durch eine Öffnung einen langen Laubengang, an dessen Ende sich ein Kiosk von zierlicher Bauart erhob. Auf beiden Seiten dieses Ganges standen kegelförmig zugespitzte Zwergbäume und dazwischen einzelne Granatbäume, Sykomoren, Tamarisken und Akazien, deren Blüten sich gleich glitzernden Funken von dem dunklen Hintergrund der Blätter abhoben.
Jene sanften, trauervollen Weisen ertönten aus einem Gemach, dessen Türe in die Halle mündete. Obwohl die Sonne heiß in das Atrium niederbrannte, lag ein blauer, kühler Schatten über diesem Raum, so daß das eben noch von der Sonnenglut der Halle geblendete Auge die einzelnen Gegenstände nur nach und nach unterscheiden konnte. Die Wände waren von einem zarten Violett und oben prangte ein Fries in reichsten Farben. Vergoldete Palmenblätter, Abbildungen von Blumen und Tieren in schachbrettartiger Anordnung und Darstellungen aus dem ägyptischen Familienleben waren hier zu sehen.
Ganz im Hintergrund erhob sich ein Ruhebett von merkwürdiger Art. Es stellte ein Rind dar, dessen Kopf mit Straußfedern geschmückt war. Das Tier stand in gebückter Stellung, als wollte es eben den Schläfer oder die Schläferin auf seinen Rücken nehmen.
Seitwärts von diesem Ruhelager befand sich ein Schemel mit vier Stufen, am Kopfende ragte ein Gestell aus Alabaster empor, einem nach oben geöffneten Halbmond gleich, welches dazu diente, den Kopf der Schläferin zu stützen, ohne daß dabei ihr Haar in Unordnung geraten konnte. In der Mitte des Raumes erhob sich ein kleiner Tisch, eine entzückende Arbeit aus kostbarstem Holz. Eine Schale mit Lotosblumen stand darauf, ein Spiegel aus Bronze mit einem Gestell aus Elfenbein, ein Gefäß mit Antimon-Puder und dazu eine kleine Spachtel aus Sykomorenholz, eine unbekleidete Schwimmerin darstellend.
Neben diesem Tischchen, auf einem rot überzogenen und vergoldeten Lehnsessel, dessen Füße blau gestrichen waren und dessen Armlehnen stehende Löwen darstellten, saß ein Mädchen von wunderbarer Schönheit in lässiger, melancholischer Haltung. Ihre Züge zeigten den klassischen ägyptischen Typus in idealer Reinheit. Die großen dunklen, durch Antimon künstlich vergrößerten Augen gaben dem zarten und kindlichen Antlitz einen rätselhaften Ausdruck. Der leicht geöffnete Mund mit den köstlich gebogenen, granatroten Lippen verriet ebenso wie die Augen stille Trauer. Die Nase war ein wenig zu klein, verlief aber trotzdem in einer vollendet schönen Linie und das wie Elfenbein glänzende Kinn war von vollkommener Anmut.
Als Kopfbedeckung trug das Mädchen das künstliche Gebilde eines Vogels mit haubenartig gespreiztem Gefieder. Der weit vorgestreckte Kopf des Tieres bog sich in die Mitte der jungfräulichen Stirne herab, während die Schwanzfedern fächerartig in den Nacken des Mädchens fielen. Das bunte Gefieder des Vogels wurde von vielfarbigem Email vorgetäuscht und ein Gesteck aus Straußfedern vollendete diesen Kopfschmuck, der nur den Jungfrauen gestattet war.
Die schwarzen Haare waren in zahlreiche Zöpfe geflochten und fielen auf beiden Seiten, das Gesicht umrahmend, hinab. Zwischen den dunklen Wellen erglänzten zwei goldene Ohrgehänge, und zwei breite langgefranste Bänder, die an dem Kopfputz befestigt waren, flatterten über den Rücken. Eine kleine emaillierte Platte, verziert mit Goldperlen und Karneolen, mit goldenen Fischchen und Eidechsen geschmückt, bedeckte den Hals bis zum Ansatz der Brust, die zart und rosig aus dem Gewebe hervorschimmerte. Das großgewürfelte Kleid wurde durch einen Gürtel zusammengehalten und lief nach unten zu in einen Fransensaum aus. Drei Reihen Armbänder aus Goldperlen und Lapislazuli klirrten an den Handgelenken, die so zart waren, wie die eines Kindes. Die schmalen Füßchen, bekleidet mit goldgestickten Sandalen, ruhten auf einem Schemel aus Zedernholz.
Neben Tahoser – so hieß das Mädchen – kniete eine junge Harfenspielerin. Ein buntgestreiftes Tuch, lang nach rückwärts hinabwallend, verhüllte das Haar und rahmte das Antlitz ein. Ein einfaches, sackähnliches Kleid aus durchsichtigem Gewebe schmiegte sich eng an den schlanken, jungen Körper. Schultern und Brust waren unverhüllt. Die Saiten des Instrumentes klangen sanft unter den kleinen, schmalen Händen der Spielerin, die sich im Takte oftmals nach vorne neigte oder hin und her bog, als wollte sie sich von den Wellen der Musik tragen lassen.
Hinter ihr stand ein zweites Mädchen, welches in der Hand ein zierliches Saiteninstrument mit langem Hals und drei Saiten hielt. Man hätte glauben können, das Mädchen wäre unbekleidet, so zart und duftig war das Gewand, das sie trug. Ein drittes Weib schlug leise und rhythmisch auf eine Art Trommel, die von einem gebogenen Holzrahmen und der darüber gespannten Haut eines wilden Esels gebildet wurde.
Die Harfenspielerin sang ein Lied, klagend und von unbeschreiblicher Innigkeit. Die Worte erzählten von vergeblichem Hoffen, von Zweifel und Angst, von Liebe zu einem Unbekannten, von Trauer über die Unbeugsamkeit der Götter und die Tücken des Schicksals.
Tahoser, den Ellbogen auf den Löwen der Armlehne gestützt, mit ihren Fingerspitzen ihre Schläfe berührend, hörte aufmerksam zu, viel aufmerksamer, als es den Anschein hatte. Oftmals unterdrückte sie ein Seufzen, ihre Augen erglänzten von aufsteigenden Tränen und sie grub ihre Zähnchen in die Unterlippe, als ob sie sich der Rührung schämte, die sie bewegte.
»Saton«, rief sie endlich, in ihre Hände schlagend, um der Sängerin Schweigen zu gebieten. Augenblicklich verstummte das Lied und die Mädchen berührten mit ihren Handflächen die Instrumente, um die letzten Schwingungen der Töne zu ersticken. »Saton, Dein Lied beleidigt meine Nerven, es erfüllt mich mit Trauer und erweckt in mir das Gefühl, das ein zu starker Wohlgeruch hervorruft. Die Saiten Deiner Harfe spannen sich um mein Herz und erwecken tief in meinem Innern Schmerz. Du verwirrst und beschämst mich, denn meine Seele ist es, die da in Deinem Lied klagt und weint. Wer verriet Dir ihre Geheimnisse?«
»Herrin,« erwiderte die Sängerin, »Dichter und Musiker sind allwissend, die ewigen Götter offenbaren ihnen alle Geheimnisse. In ihren Gesängen, in ihren Gedichten geben sie den Regungen der Herzen Gestalt, die man vorher kaum erkannt hat und die man sich nun zögernd eingestehen muß. Doch da mein Lied Dich traurig gestimmt hat, will ich Dir ein anderes singen, das fröhlichere Bilder vor Dein Auge zaubern soll.« Und Saton schlug in die Saiten und entlockte ihnen eine fröhliche, kecke Melodie, die von dem Tympanon mit kleinen, scharfen Schlägen begleitet wurde. Das Lied kündete von den Vergnügen des Weintrinkens, der berauschenden Wohlgerüche und der Ekstase des Tanzes.
An den Wänden des Gemaches saßen und knieten noch andere Frauen, die während Satons erstem Gesang Gebärden der Trauer gezeigt hatten. Nun aber erzitterten sie unter der raschen Melodie, ihre Augen erglänzten, ihre Nüstern blähten sich und endlich sprangen einige auf und begannen zu tanzen.
Helmartige Kopfbedeckungen schmückten ihre Häupter. Darunter schlängelten sich ab und zu widerspenstige Locken in die unter der Lust des Tanzes erglühenden Wangen. Große Goldreifen umschlossen den Hals und durch die langen dünnen Schleierhemden, die oben mit Perlen eingefaßt waren, konnte man die schlanken geschmeidigen Körper in ständiger Bewegung erblicken. Die Tänzerinnen drehten sich, beugten sich vor und zurück, wiegten sich in den von einem engen Gürtel umspannten Hüften und legten den Kopf bald nach rechts, bald nach links, dabei mit wollüstiger Bewegung ihre eigenen Schultern berührend. Sie streckten ihre Hälse wie gurrende Tauben vor, knieten nieder, standen wieder auf, schlossen die Arme über der Brust und öffneten sie weit wie zum Flügelschlag. In allen, auch in den kleinsten Bewegungen ihrer Glieder gehorchten sie genau dem raschen Rhythmus der Musik.
Die übrigen Dienerinnen lehnten an den Wänden, um Raum für die Tanzenden zu lassen. Auch sie folgten den Weisen des Liedes mit Fingerspiel und Händeklatschen. Die meisten von ihnen waren gänzlich unbekleidet und trugen keinen einzigen Schmuck, bis auf ein Armband aus Email. Einige hatten um ihre Lenden einen enganliegenden Rock geschlungen, der von Bändern, die über den Schultern befestigt waren, getragen wurde.
Der Anblick des Tanzes hätte jeden Zuschauer entzücken können. Doch Tahosers Trauer schien durch das lustige Lied nur größer geworden zu sein. Eine Träne rollte über ihre Wange herab und während sie ihren zarten Kopf an die Schulter der Favoritin lehnte, die neben ihrem Sessel kniete, seufzte das Mädchen schwer auf.
»Oh, meine gute Nofre, ich bin so voll Trauer, so unglücklich!«
Nofre gab ein Zeichen und sofort zogen sich alle die Musikantinnen, die Tänzerinnen und die an den Wänden lehnenden Dienerinnen schweigend zurück. Als die letzte verschwunden war, beugte sich die Getreue zu ihrer Herrin und sprach wie eine Mutter, die den Schmerz ihres Kindes lindern will:
»Was kann Dir fehlen, geliebte Herrin? Bist Du nicht jung und schön und beneidet von allen Frauen? Unabhängig, denn dein Vater hat Dich zur Erbin über alle seine Güter eingesetzt. Dein Palast ist wundervoll, Deine Gärten sind groß – viele blühende Bäume und plätschernde Springbrunnen sind darin. Deine Schränke enthalten Schmuck von auserlesenster Arbeit! Die Zahl Deiner Gewänder und Deines Schmuckes ist größer als die Tage im Jahr. Hopi-Mou, der Vater der Gewässer, befeuchtet mit seinem befruchtenden Schlamm alljährlich Deine Felder, die so weit reichen, daß ein Reiher sie kaum zwischen zwei Sonnen überfliegen könnte und wenn er noch so schnell wäre. Doch anstatt Dein Herz freudig dem Leben zu öffnen, gleich der Knospe der Lotosblume im Monat der Hathor oder Chöi-ack, vergräbst Du Dich in Trauer und Klagen.«
Tahoser erwiderte ihr:
»Gewiß haben die Götter es gut mit mir gemeint, doch wozu können mir alle diese Dinge dienen, wenn ich das eine nicht habe, wonach mein Herz sich sehnt? Ein unerfüllter Wunsch macht den Reichsten zum Bettler inmitten seines vergoldeten, buntbemalten Palastes, samt seinen gefüllten Getreidespeichern, seinen Wohlgerüchen und Kostbarkeiten. Ärmer ist er als der armseligste Arbeiter von Memnonia, der die Erde mit Sägespänen von dem Blute der einbalsamierten Leichen reinigen muß, ärmer als der nackte Neger, der in der Glut der Sonne seine Papyrus-Barke quer durch den Nil rudern muß.«
Nofre lächelte mit einem Anflug von Schalkhaftigkeit und antwortete:
»Ist es möglich, o Herrin, daß einer Deiner Wünsche unerfüllt bleiben könnte? Du träumst von einem Geschmeide und schon hat der Goldschmied das dazu nötige Gold, die Karneolen und Mondsteine und bildet Dir, was Du befiehlst. Desgleichen geschieht es mit Gewändern und Wagen, mit Wohlgerüchen, Blumen und Musikinstrumenten. Deine Sklaven suchen für Dich von Philae bis Heliopolis nach den kostbarsten und seltensten Dingen und wenn Ägypten allein Deinen Wünschen nicht mehr nachkommen kann, dann setzen sich Karawanen in Bewegung, um Dir das Verlangte aus einem anderen Lande zu verschaffen.«
Die schöne Tahoser schüttelte ihr Haupt, unwillig darüber, daß ihre Dienerin sie nicht verstehen wollte.
»Verzeih, o Herrin«, sprach Nofre, die einzusehen begann, daß sie auf diesem Wege die Gebieterin nicht trösten würde. »Ich vergaß, daß der Pharao seit vier Monden in Äthiopien weilt und daß der schöne Offizier, der niemals an diesem Palaste vorbeiging, ohne seine Schritte zu verlangsamen und herauf zu blicken, mit dem Herrscher ausgezogen ist. Wie schmuck er in seiner Kriegskleidung ausgesehen hat, wie jung und kühn!«
Tahoser öffnete ein wenig ihre Rosenlippen, ein zarter Hauch flog über ihre Wangen, aber dann beugte sie den Kopf und das Wort blieb ungesprochen.
Die Dienerin fuhr fort:
»In diesem Fall, o Herrin, haben Deine Leiden ihr Ende gefunden. Heute morgens traf ein Läufer hier ein, um zu melden, daß der siegreiche König noch vor Sonnenuntergang seinen Einzug in die Stadt halten würde. Hörst Du nicht schon, wie hundert verschiedene Geräusche die mittägige Stille unterbrechen? Die Räder der Wagen rasseln über das Pflaster und zu Tausenden setzt das Volk über den Fluß, um gegen den Manöverplatz zu ziehen. Schüttle Deine Trauer ab, mische Dich in die Schar und genieße auch Du den prachtvollen Anblick des einziehenden Heeres. Wenn man verstimmt ist, muß man sich anderen Menschen zugesellen, denn die Einsamkeit vergrößert nur die Dunkelheit der Gedanken. Von seinem Kriegswagen herab wird Ahmosis Dir freudig zulächeln und Du wirst beglückt hieher zurückkehren.«
»Ahmosis liebt mich,« sprach Tahoser, »ich jedoch liebe ihn nicht.«
»Aus Dir spricht jungfräuliche Schüchternheit«, entgegnete Nofre. Ihr gefiel der junge Krieger sehr wohl und sie glaubte, daß die Gleichgültigkeit Tahosers nur eine gekünstelte sei. Denn Ahmosis war in der Tat wert, geliebt zu werden, seine Züge waren edel und von gleichmäßiger Schönheit, wie die eines Weibes. Seine leicht gebogene Adlernase, seine feurig schwarzen Augen, seine hohe elastische Gestalt waren ganz dazu geschaffen, auch die kältesten Frauen zu erobern. Und dennoch liebte ihn Tahoser nicht, wie immer auch Nofre darüber denken mochte.
Unvermittelt faßte Tahoser einen Entschluß. Sie schüttelte ihre Melancholie ab und erhob sich aus ihrem Lehnstuhl mit einer Lebhaftigkeit, die man von ihr nach der soeben noch gezeigten Niedergeschlagenheit kaum erwartet hätte. Auf einen Wink kniete Nofre vor ihr nieder und bekleidete ihre Füße mit Sandalen, deren lange Schnäbel nach rückwärts gebogen waren; sie schüttelte wohlriechendes Puder in das Haar der Herrin, holte aus einer Schachtel Armbänder in Schlangenform und Ringe, die Skarabäen glichen, bemalte ihre Wangen mit grüner Schminke, die erst durch die Wärme der Haut rosig wurde, gab den Fingernägeln Glanz und richtete die Falten des Überwurfes. Dann rief sie Diener herbei und gab Auftrag, das Schiff bereitzustellen, um Pferde und Wagen über den Fluß zu setzen.