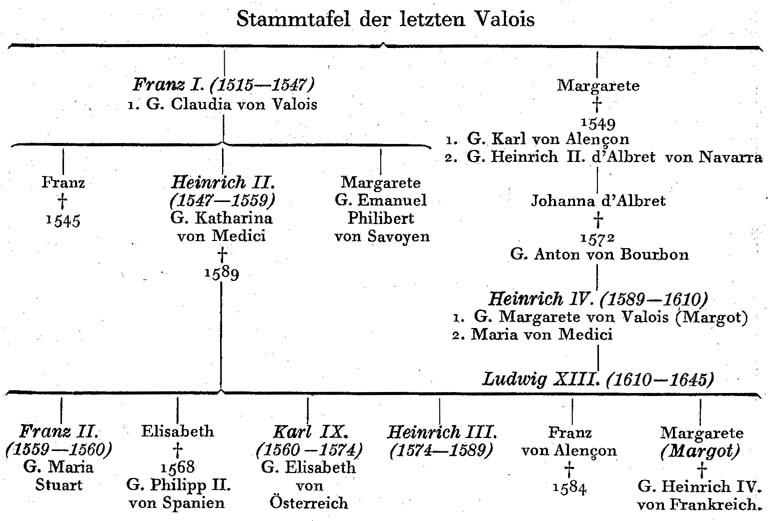|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Ein Jahr war seit dem Tode des Königs Karl des Neunten und der Thronbesteigung durch seinen Nachfolger vergangen.
König Heinrich der Dritte, von Gottes und seiner Mutter Katharina Gnaden glücklicher Herrscher von Frankreich, war zu einem feierlichen Bittgang gegangen, der zu Ehren der Notre-Dame de Cléry stattfinden sollte.
Er hatte sich mit der Königin, seiner Gemahlin und dem ganzen Hof zu Fuß dahinbegeben.
König Heinrich konnte sich wohl derlei Kurzweil gönnen, denn damals nahm ihn keine ernste Sorge in Anspruch. Der König von Navarra lebte, wie es seit langem sein sehnlichster Wunsch gewesen, in Navarra und beschäftigte sich dort, wie man erzählte, angelegentlichst mit einem schönen Mädchen aus der Familie Montmorency, die allgemein la Fosseuse genannt wurde. Margarete war bei ihm, düster und verschlossen. Die schönen Berge der Umgebung gewährten ihr zwar keine Zerstreuung, doch sie linderten wenigstens die zwei größten Schmerzen des Lebens, das Heimweh und den unersetzlichen Verlust.
Paris war sehr ruhig geworden, und die Königin-Mutter, seit der Thronbesteigung ihres lieben Sohnes Heinrich des Dritten die wahrhaftige Regentin von Frankreich, nahm ihren Aufenthalt bald im Louvre, bald im Palast Soissons, der damals auf der Stelle der heutigen Getreidehallen stand und von dem als Rest nur die vornehme Säule stehen geblieben ist, die man auch heute noch sehen kann.
Eines Abends war sie eifrig damit beschäftigt, mit René die Sternbilder zu betrachten. René, dessen kleine Verrätereien sie niemals durchschaut hatte, war seit der falschen Zeugenschaft, die er im Verfahren gegen Coconas und La Mole so zur rechten Zeit zur Geltung gebracht hatte, wieder in Gnaden aufgenommen worden. Während dieser Beschäftigung meldete man ihr, daß ein Mann, der ihr äußerst wichtige Nachrichten zu übermitteln hätte, in ihrem Betzimmer auf sie warte.
Sie eilte hastig in ihre Wohnung hinunter und fand hier den Herrn von Maurevel vor.
»Er ist hier in Paris!« rief ihr der ehemalige Kapitän der Petardenabteilung entgegen, indem er, der Hofsitte zu Trotz, Katharina gar nicht Zeit gelassen hatte, ihn zuerst anzusprechen.
»Wer ist ›er‹?«
»Wer soll denn das sein, Madame, wenn nicht der König von Navarra?«
»Hier?« sagte Katharina, »hier? . . . er . . . Heinrich? Und was will er denn hier, der Unvorsichtige?«
»Allem Anschein nach, wenn man es glaubt, will er Frau von Sauve besuchen, das ist alles. Wenn man aber Möglichkeiten in Betracht zieht, dann will er eine Verschwörung gegen den König anzetteln.«
»Und wieso wissen Sie, daß er sich hier befindet?«
»Gestern habe ich ihn in ein Haus eintreten gesehen und kurz nachher ist Frau von Sauve nachgekommen.«
»Sind Sie auch sicher, daß er es war?«
»Ich habe solange bei dem Hause gewartet, bis er wieder herausgekommen ist, also fast die halbe Nacht lang. Um drei Uhr früh haben sich die zwei Liebenden wieder auf den Heimweg gemacht. Der König hat Frau von Sauve bis an das kleine Eingangstor des Louvre begleitet. Hier wurde sie dank dem Pförtner, der jedenfalls von ihr bestochen ist, ohne Behelligung eingelassen. Der König ist dann, ein kleines Liedchen trällernd, zurückgekommen. Er ging so sicheren und gemächlichen Schrittes, als ob er sich in seinen Heimatbergen befände.
»Und wohin ging er?«
»In die Straße l'Arbre-Sec, Gasthof. ›Zum schönen Sternbild‹, zu demselben Gastwirt, bei dem die zwei Hexenmeister wohnten, die Eure Majestät im vorigen Jahr hinrichten ließen.«
»Warum haben Sie mir das nicht gleich gemeldet?«
»Weil ich meiner Sache noch nicht ganz sicher war.«
»Und jetzt?«
»Jetzt weiß ich alles ganz genau.«
»Hast du ihn gesehen?«
»So gut, wie nur möglich. Ich lag bei einem Weinhändler gerade gegenüber im Hinterhalt. Dann sah ich ihn in das gleiche Haus hineingehen, wie tags vorher. Da sich Frau von Sauve verspätete, beging er die Unvorsichtigkeit, bei einer Fensterscheibe im ersten Stock herauszulugen, und diesmal erkannte ich ihn ohne jeden Zweifel. Übrigens ist dann Frau von Sauve auch in das Haus gekommen.«
»Glaubst du, daß sie, wie in der vergangenen Nacht, bis drei Uhr in dem Hause bleiben werden?«
»Wo befindet sich dieses Haus?«
»Bei dem Kreuz des Petits-Champs, gegen Saint-Honoré.«
»Kennt Herr von Sauve Ihre Schrift?«
»Nein.«
»Setzen Sie sich hierher und schreiben Sie!«
Maurevel gehorchte und nahm eine Feder zur Hand.
»Ich bin bereit, Madame,«, sagte er.
Katharina diktierte: »Während der Baron von Sauve im Louvre Dienst tut, unterhält sich die Baronin in einem Hause neben dem Kreuz des Petits-Champs, in der Richtung Saint-Honoré, mit einem Schürzenjäger aus ihrem Freundeskreise. Der Baron von Sauve wird das Haus an einem roten Kreuz erkennen, das an der Wand angebracht ist.«
»Und weiter?« fragte Maurevel.
»Machen Sie eine Abschrift von diesem Briefe.«
Maurevel gehorchte schweigend.
»Jetzt,« sagte die Königin, »lassen Sie einen Brief durch einen geschickten Menschen Herrn von Sauve übermitteln. Den zweiten Brief aber soll dieser Bote in einem Gang des Louvre auf die Erde fallen lassen.«
»Das verstehe ich nicht ganz,« erwiderte Maurevel.
Katharina zuckte die Achseln.
»Sie verstehen nicht, daß sich ein Ehemann über einen derartigen Brief ärgern muß?«
»Mir kommt es aber vor, Madame, daß er sich zu Zeiten des Königs von Navarra gar nicht darüber ärgerte.«
»Was einem König nachgesehen wird, wird nicht immer einem gewöhnlichen Liebhaber nachgesehen. Wenn er sich übrigens nicht ärgert, dann werden Sie sich für ihn ärgern.«
»Ich?«
»Zweifelsohne. Sie werden sich vier Mann nehmen, sechs Mann, wenn es nötig ist, werden sich vermummen und werden so, als ob Sie der Bevollmächtigte des Barons wären, die Tür des Hauses einrennen. Dann werden Sie die Liebenden mitten in ihren Zärtlichkeiten überraschen und werden im Namen des Königs Gericht halten. Der Brief, der am nächsten Morgen im Louvre gefunden werden wird und den sicherlich irgendeine mitleidige Seele veröffentlichen wird, wird der Beweis dafür werden, daß sich der Gatte gerächt hat. Der Zufall wird es gefügt haben, daß der Liebhaber der König von Navarra war . . . wer konnte das aber wissen, da ihn doch jedermann in Pau glaubt?«
Mit Bewunderung sah Maurevel Katharina an, verbeugte sich und ging.
Zu gleicher Zeit, als Maurevel aus dem Palast Soissons ging, betrat Frau von Sauve das kleine Haus beim Kreuz des Petits-Champs.
Heinrich erwartete sie bei halboffener Tür.
Wie er sie die Stiege heraufkommen sah, fragte er: »Ist Ihnen niemand gefolgt?«
»Niemand,« sagte Charlotte, »wenigstens habe ich nichts bemerkt.«
»Ich glaube, daß mir jemand aufgelauert hat, nicht nur in der vorigen Nacht, sondern auch heute Abend.«
»Ach, mein Gott! erwiderte Charlotte. »Sie erschrecken mich, Sire, denn wenn so ein freundliches Gedenken, das Sie einer ehemaligen Freundin widmen, für Sie schlecht ausfallen sollte, wäre ich trostlos!«
»Beruhigen Sie sich, meine Liebste, drei blanke Degen wachen im Schatten über uns.«
»Drei nur? Das ist wenig, Sire!«
»Genug, wenn die Haudegen Mouy, Saucourt und Barthélemy heißen!«
»Herr von Mouy ist also mit Ihnen in Paris?«
»Natürlich!«
»Wagte er in die Hauptstadt zurückzukommen? Da muß er wohl wie Sie eine Frau hier haben, die in ihn verrückt ist?«
»Nein, aber einen Feind hat er hier, dem er den Tod geschworen hat. Außer der Liebe gibt es nur noch den Haß, liebe Freundin, die einen zu Dummheiten verführt.«
»Ich danke, Sire!«
»Oh!« meinte Heinrich, »das gilt nicht für augenblickliche Narrheiten, das gilt für die geschehenen und noch kommenden Dummheiten. Doch sprechen wir nicht mehr darüber, denn wir haben keine Zeit zu verlieren.«
»Sie reisen also ab?«
»Ja, noch heute nacht!«
»Die Angelegenheiten, die Sie in Paris besorgen wollten, sind also erledigt?«
»Ich bin doch nur Ihretwegen gekommen!«
»Gascogner!«
»Himmel und Hölle, das ist Wahrheit, meine Liebste! Doch lassen wir diese Erwägungen: mir bleiben noch zwei oder drei Stunden übrig, um glücklich zu sein, und dann kommt ohnehin eine ewige Trennung.«
»Ah, Sire,« erwiderte Frau von Sauve, »für mich gibt es nichts Ewiges, außer der Liebe!«
Heinrich hatte gerade gesagt, daß er nicht Zeit hätte, Betrachtungen anzustellen, er ging demnach darauf nicht ein. Er glaubte Frau von Sauve oder vielmehr – Zweifler, der er immer war – er tat so, als ob er ihr glauben könnte.
Mittlerweile waren Mouy und seine Begleiter, wie es der König gesagt hatte, in der Umgebung des Hauses auf ihrem Posten.
Es war vereinbart worden, daß Heinrich, statt um drei Uhr früh, schon um Mitternacht aus dem Hause herauskommen sollte. Dann würde man, wie am vorhergehenden Tage, Frau von Sauve zum Louvre begleiten, hierauf aber in die Straße de la Cerisaie gehen, wo Maurevel wohnte.
Erst während des verflossenen Tages hatte Mouy endlich mit Bestimmtheit erfahren können, wo sein Feind wohnte.
Beiläufig eine Stunde war vergangen, als die Versteckten einen Mann bemerkten, der in Begleitung von fünf anderen an die Tür des kleinen Hauses heranschlich und nacheinander mehrere Schlüssel in das Schloß steckte.
Mouy, der in der Türöffnung eines benachbarten Hauses versteckt war, war mit einem einzigen Satz bei diesem Mann und umschlang ihn mit den Armen.
»Einen Augenblick nur!« rief er. »Der Eintritt ist verboten.«
Der Mann machte einen Sprung nach rückwärts, sein Hut fiel auf die Erde.
»Mouy von Saint-Phale!« schrie er.
»Maurevel!« heulte der Hugenotte auf und hob seinen Degen.
»Dich suchte ich, du kamst mir entgegen, ich danke dir!
Doch im Zorn vergaß er Heinrich nicht, er wendete sich zu den Fenstern des Hauses und pfiff in der Weise der Bearner Hirten hinauf.
»Das wird genügen!« rief er Saucourt zu. »Jetzt kommt die Reihe an dich, du Mörder!«
Und er stürzte auf Maurevel los.
Der hatte Zeit gefunden, eine Pistole aus dem Gürtel zu ziehen.
»Ah! diesmal,« sagte der Töter im Namen des Königs, »diesmal bist du, wie mir scheint, ein toter Mann!« Und er zielte auf den jungen Mann.
Dann drückte er los, Mouy warf sich nach rechts und die Kugel flog, ohne ihn zu treffen, vorbei.
»Jetzt komme ich daran!« schrie der junge Mann.
Er versetzte Maurevel einen so starken Hieb, daß, obwohl er nur den Ledergürtel des Feindes traf, die Spitze des Degens durch das Hindernis drang und sich in das Fleisch des Gegners bohrte.
Der Mörder stieß einen wilden Schrei aus. Das deutete auf eine so schmerzhafte Verletzung hin, daß die begleitenden Häscher Maurevel zu Tode getroffen glaubten und erschreckt in die Richtung der Straße Saint-Honoré davonliefen.
Maurevel war kein Held. Angesichts eines Gegners wie Mouy und verlassen von seinen Genossen, fand er auch kein anderes Rettungsmittel als die Flucht. Er nahm denselben Weg wie seine Begleiter und schrie im Laufen: »Zu Hilfe, zu Hilfe!«
Mouy, Saucourt und Barthélemy folgten ihm in ihrer Wut.
Als sie in die Straße de Grenelle einbogen, um dem Flüchtigen den Weg abzuschneiden, öffnete sich ein Fenster des Hauses, und ein Mann sprang vom ersten Stockwerk auf die vom Regen frisch durchnäßte Erde herab.
Es war Heinrich.
Der Pfiff Mouys hatte ihn auf eine drohende Gefahr aufmerksam gemacht, und der Pistolenschuß hatte ihn in der Annahme, daß es sich um einen ernsten Kampf handle, bewogen, den Freunden so rasch wie möglich zu Hilfe zu eilen.
Mutvoll und rüstig setzte der König mit dem Degen in der Faust seinen Freunden nach.
Ein Schrei zeigte ihm die Richtung an. Er kam von dem Schranken der Stadtwache her. Er rührte von Maurevel her, der bedrängt durch Mouy seine vor Angst flüchtenden Genossen zu sich rief.
Er mußte schließlich seinem Gegner die Brust bieten, wenn er nicht von rückwärts erstochen werden wollte.
Maurevel nahm Stellung, kreuzte mit dem Feind die Waffe und versetzte gleich darauf dem jungen Mann einen so geschickten Hieb, daß er dessen Schärpe durchlöcherte. Doch Mouy gab den Hieb sofort zurück.
Wieder bohrte sich die Degenspitze in das Fleisch Maurevels, und eine doppelte Blutwelle schoß aus zweifacher Wunde hervor.
»Der Hieb sitzt!« rief Heinrich, der gerade herbeieilte. »Nur frisch darauf los, Mouy!«
Mouy bedurfte keiner Aufmunterung.
Er griff abermals Maurevel ungestüm an, doch der hielt ihm nicht mehr stand.
Mit der linken Hand auf der Wunde rannte er verzweifelt davon.
»Töte ihn, töte ihn rasch!« rief der König. »Dort stehen seine Soldaten, und die Verzweiflung von Feiglingen taugt nicht für Tapfere!«
Maurevel, dessen Lungen barsten, dessen Atem pfiff und der bei jedem Atemzug förmlich Blut schwitzte, fiel auf einmal entkräftet hin, richtete sich aber sogleich wieder auf und bot, auf einem Knie gestützt, Mouy die Spitze seines Degens.
»Freunde, Freunde!« rief er, »es sind ihrer nur zwei! Feuert auf sie!«
Tatsächlich waren Saucourt und Barthélemy bei der Verfolgung der zwei anderen Häscher in der Straße des Pouliers vom Wege abgekommen, und der König und Mouy fanden sich vier Feinden gegenüber.
»Feuer!« brüllte Maurevel unaufhörlich, während einer der Soldaten tatsächlich seinen Bruststutzen anschlug.
»Ja, aber vorerst: stirb, Verräter, stirb, Elender, stirb, verurteilt wie ein gemeiner Mörder!« rief Mouy.
Indem er mit der einen Hand den scharfen Degen Maurevels unerschrocken ergriff, stieß er seinen Degen mit der anderen Hand von oben bis unten durch die Brust seines Feindes, und zwar mit so gewaltiger Kraft, daß er ihn förmlich auf die Erde nagelte.
»Gib acht, gib acht!« schrie Heinrich.
Mouy machte einen Satz nach rückwärts und ließ seinen Degen im Körper Maurevels stecken, denn einer der Soldaten zielte aus nächster Nähe auf ihn.
Gleichzeitig bohrte aber schon Heinrich seinen Degen durch den Leib des Soldaten, der mit einem Schrei neben Maurevel nieder fiel.
»Komm, Mouy, komm!« rief Heinrich. »Wir dürfen keinen Augenblick verlieren, denn wenn man uns erkennt, sind wir verloren!«
»Warten Sie noch, Sire! Glauben Sie denn, daß ich meinen Degen im Leib dieses Elenden stecken lassen will?«
Er näherte sich Maurevel, der allem Anschein nach unbeweglich auf der Erde lag. Doch in dem Augenblick, als Mouy den Degengriff in die Hand nahm, packte er den Bruststutzen, den der Soldat fallen gelassen hatte, und schoß Mouy aus nächster Nähe mitten in die Brust.
Der junge Mann fiel nieder, ohne einen Schrei auszustoßen. Er war auf der Stelle tot.
Heinrich stürzte sich auf Maurevel. Doch der war auch schon zurückgesunken, und der Degen durchbohrte nur mehr eine Leiche.
Es war Zeit zu entfliehen. Der Lärm hatte eine Menge Menschen angelockt, die Nachtwache konnte gleich erscheinen. Heinrich suchte unter den herbeigelaufenen Neugierigen irgendeinen Bekannten und plötzlich schrie er freudig auf.
Er hatte Meister La Hurière erkannt.
Da sich der ganze Vorgang am Fuße des Kreuzes von Trahoir abgespielt hatte, also gewissermaßen gegenüber der Straße von Arbre-Sec, hatte unser alter Bekannter, der schon von Natur aus grämlich war, jetzt aber seit dem Tode Coconas und La Moles, seiner geliebten Gäste, besonders niedergeschlagen war, seine Bratöfen und Schüsseln in dem Augenblick verlassen, als er das Nachtmahl für den König von Navarra herrichtete, und war auf die Straße hinausgelaufen.
»Mein lieber La Hurière, ich überantworte Ihnen Herrn von Mouy, obwohl ich glaube, daß da nicht mehr viel zu helfen ist. Bringen Sie ihn in Ihre Wohnung und, falls er noch leben sollte, sparen Sie mit keiner Sorge. Hier haben Sie meine Börse. Was aber den anderen betrifft, so lassen Sie ihn in der Gosse liegen; dort mag er verfaulen wie ein Hund!«
»Und Sie?« fragte La Hurière.
»Ich habe noch jemand Lebewohl zu sagen und in zehn Minuten bin ich wieder bei Ihnen. Halten Sie meine Pferde bereit!«
Und Heinrich fing an, in die Richtung des Hauses beim Kreuz des Petits-Champs zu laufen. Als er aber gerade aus der Straße de Grenelle herauskam, blieb er mit dem Zeichen des Schreckens stehen.
Eine Menschenmenge hatte sich vor der Tür angesammelt.
»Was gibt es in dem Hause?« fragte Heinrich. »Was ist geschehen?«
»Oh!« antwortete der, an den er sich gewandt, »ein großes Unglück, mein Herr! Eine schöne junge Frau ist gerade von ihrem Mann erdolcht worden. Man hatte ihm ein Schreiben zugesteckt, nach dem seine Frau sich mit einem Liebhaber in diesem Hause befinden sollte!«
»Und der Ehemann?« rief Heinrich.
»Hat sich in Sicherheit gebracht.«
»Seine Frau?«
»Die ist noch da.«
«Tot?«
»Noch nicht, doch, Gott sei Dank, sie verdient wohl nichts Besseres!«
»Oh!« rief Heinrich, »so bin ich also verflucht!«
Er stürzte in das Haus hinein.
Das Zimmer war voll von Leuten, alle umstanden ein Bett, auf dem die arme Charlotte, durchbohrt von zwei Dolchstößen, lag.
Ihr Gatte, der seit zwei Jahren seine Eifersucht auf Heinrich von Navarra zu beherrschen und zu verheimlichen gewußt hatte, hatte jetzt die Gelegenheit ergriffen, sich an ihr zu rächen.
»Charlotte! Charlotte!« rief Heinrich, schob sich durch die Menge und fiel vor dem Bett nieder.
Charlotte öffnete ihre schönen Augen, über die schon der Schleier des Todes gebreitet lag. Sie stieß einen Schrei aus, versuchte sich zu erheben, während das Blut aus ihren zwei Brustwunden herabträufelte.
»Oh! ich wußte es ja, daß ich nicht sterben könnte, ohne ihn noch gesehen zu haben!« murmelte sie.
Und als ob sie nur auf den Augenblick gewartet hätte, vor Heinrich die Seele zu verhauchen, die er so geliebt, legte sie nun ihre Lippen an die Stirne des Königs von Navarra und seufzte noch ein letztes Mal »Ich liebe dich!«, um gleich darauf tot zurückzusinken.
Heinrich konnte nicht länger bleiben, ohne sich einer Gefahr auszusetzen. Er zog seinen Dolch und schnitt eine blonde Locke aus dem schönen Haar heraus, das er so oft gelöst hatte, um seine Länge zu bewundern. Dann ging er schluchzend davon, mitten durch die ebenfalls schluchzenden Anwesenden, die keine Ahnung davon hatten, daß sie zwei so hochstehende Unglückliche beweinten.
»Freundschaft, Liebe!« rief Heinrich bestürzt aus, »alles verläßt mich, alles läßt mich im Stich, alles geht mir auf einmal verloren!«
»Ja, Sire,« sagte ganz leise ein Mann, der sich von der Gruppe der Neugierigen vor dem kleinen Hause getrennt hatte und Heinrich gefolgt war, »ja, Sire, es bleibt Ihnen aber noch der Thron!«
»René!« staunte Heinrich.
»Ja, Sire, René, der über Sie wacht: der Elende hat sterbend Ihren Namen genannt. Man weiß, daß Sie in Paris sind, die Scharwache sucht Sie bereits, fliehen Sie, fliehen Sie!«
»Und du sagst, daß ich König sein werde, René? Ich, ein Flüchtling?«
»Sehen Sie dort hinauf, Sire,« sagte der Florentiner und zeigte dem König einen Stern, der sich gerade leuchtend und blitzend aus einem schwarzen Wolkenvorhang löste, »nicht ich sage es, sondern der dort oben!«
Heinrich seufzte tief auf und verschwand im Dunkel der Nacht.