
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Keine andere Abtheilung der Ordnung versteht es, so gründlich uns zu belehren, was Nager sind, als die, welche die Mäuse ( Murina ) umfaßt. Die Familie, welche neuerdings mit den beiden nächstfolgenden zu der Unterordnung der Mausnager ( Murida ) vereinigt wird, ist nicht bloß die an Sippen und Arten reichste, sondern auch bei weitem die verbreitetste, und, dank ihrer Anhänglichkeit an den Menschen, noch in steter Verbreitung begriffen, wenigstens was einzelne ihrer Arten anlangt. Ihre Mitglieder sind durchgängig kleine Gesellen; aber sie ersetzen durch ihre Anzahl, was den einzelnen an Größe abgeht, mehr als vollständig. Will man ein allgemeines Bild von der Gesammtheit geben, so kann man sagen, daß die spitze Schnauze, die großen schwarzen Augen, die breiten und hohlen, sehr spärlich behaarten Ohren, der lange, behaarte oder ebenso oft nacktschuppige Schwanz und die zierlichen Beine mit schmalen, feinen, fünfzehigen Pfoten sowie ein kurzer, weicher Pelz unsere Familie kennzeichnen. Doch nähern sich in ihrer Gesammtgestaltung viele Mäuse anderen Familien der Ordnung: stachliches Grannenhaar erinnert an die Stachelschweine, echte Schwimmfüße, kurze Ohren und Beine an die Biber, dick behaarter Schwanz an die Eichhörnchen etc. Mit solchen äußerlichen Abänderungen der allgemeinen Grundform steht der Bau des Gebisses mehr oder weniger im Einklange. Gewöhnlich sind die Nagezähne schmal und mehr dick als breit, mit scharfmeißlicher Schneide oder scharfer Spitze, an der Vorderseite glatt oder gewölbt, weiß oder gefärbt, auch wohl durch eine Längsrinne getheilt. Drei Backenzähne in jeder Reihe, welche von vorn nach hinten an Größe abnehmen, bilden regelmäßig das übrige Gebiß, ihre Anzahl sinkt aber auch auf zwei herab oder steigt bis aus vier im Oberkiefer. Sie sind entweder schmelzhöckerig, mit getrennten Wurzeln oder quergefaltet oder seitlich eingekerbt. Viele schleifen sich durch das Kauen ab, und dann erscheint die Fläche eben oder mit Faltenzeichnung. 12 oder 13 Wirbel tragen Rippen, 3 bis 4 bilden das Kreuzbein, und 10 bis 36 den Schwanz. Bei einigen Arten kommen wohl auch Backentaschen vor, bei anderen fehlen sie gänzlich; bei diesen ist der Magen einfach, bei jenen stark eingeschnürt etc.
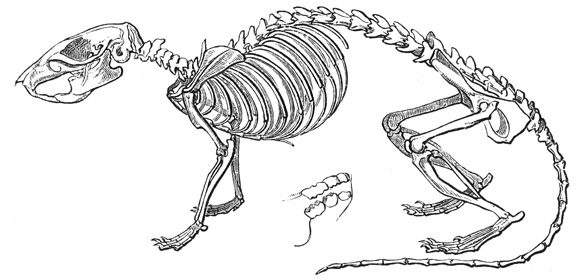
Geripp der Wanderratte. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
Die Mäuse sind Weltbürger, aber leider nicht im guten Sinne. Alle Erdtheile weisen Mitglieder aus dieser Familie auf, und jene glücklichen Inseln, welche bis jetzt noch von ihnen verschont blieben, werden im Laufe der Zeit sicher noch wenigstens von einer Art, deren Wanderlust schon gewaltige Erfolge erzielt hat, bevölkert werden. Die Mäuse bewohnen alle Gegenden und Klimate, ziehen zwar die Ebenen gemäßigter und wärmerer Länder dem rauhen Hochgebirge oder dem kalten Norden vor, finden sich aber doch so weit, als die Grenze des Pflanzenwuchses reicht, demzufolge auch noch in unmittelbarer Nähe des ewigen Schnees der Gebirge. Wohlbebaute Gegenden, Fruchtfelder, Pflanzungen bilden unbedingt ihre beliebtesten Aufenthaltsorte, sumpfige Strecken, Flußufer und Bäche bieten ihnen jedoch ebenfalls genug, und selbst dürre, trockene, mit wenig Gras und Buschwerk bewachsene Ebenen gewähren ihnen noch die Möglichkeit zu leben. Einige meiden die Nähe menschlicher Ansiedelungen, andere drängen sich dem Menschen als ungebetene Gäste auf und folgen ihm überall hin, wo er neue Wohnorte gründet, selbst über das Meer. Sie bevölkern Haus und Hof, Scheuer und Stall, Garten und Feld, Wiese und Wald, allerorten mit gefräßigem Zahne Schaden und Unheil anrichtend. Nur die wenigsten leben einzeln oder paarweise, die meisten lieben die Geselligkeit, und manche Arten wachsen zuweilen zu ungeheuren Scharen an. Bei fast allen ist die Vermehrung eine ganz außerordentliche; denn die Anzahl der Jungen eines einzigen Wurfs schwankt zwischen sechs und einundzwanzig, und die allermeisten pflanzen sich mehrmals im Jahre, ja selbst im Winter fort.
Die Mäuse sind in jeder Weise geeignet, den Menschen zu plagen und zu quälen, und ihre Eigenschaften scheinen sie besonders hierzu zu befähigen. Gewandt und behend in ihren Bewegungen, können sie vortrefflich laufen, springen, klettern, schwimmen, verstehen es, durch die engsten Oeffnungen sich zu zwängen, oder, wenn sie keine Zugänge finden, mit ihrem scharfen Gebisse solche Wege zu eröffnen. Sie sind ziemlich klug und vorsichtig, ebenso aber auch dreist, frech, unverschämt, listig und muthig, ihre Sinne durchgehends fein, obschon Geruch und Gehör die übrigen bei weitem übertreffen. Ihre Nahrung besteht aus allen eßbaren Stoffen des Pflanzen- und Thierreichs. Samen, Früchte, Wurzeln, Rinde, Kräuter, Gras, Blüten, welche ihre natürliche Nahrung bilden, werden nicht minder gern von ihnen verzehrt als Kerbthiere, Fleisch, Fett, Blut und Milch, Butter und Käse, Haut und Knochen, und was sie nicht fressen können, zernagen und zerbeißen sie wenigstens, so Papier und Holz. Wasser trinken sie im allgemeinen nur selten; dagegen sind sie äußerst lüstern auf alle nahrungsreicheren Flüssigkeiten und verstehen es, derselben in der listigsten Weise sich zu bemächtigen. Dabei verwüsten sie regelmäßig weit mehr, als sie verzehren, und werden hierdurch zu den allerunangenehmsten Feinden des Menschen, welche nothwendigerweise dessen ganzen Haß heraufbeschwören und sogar die Grausamkeiten, welche er sich bei ihrer Vertilgung zu Schulden kommen läßt, wenn auch nicht verzeihlich, so doch erklärlich machen. Nur sehr wenige sind harmlose, unschädliche Thiere, und haben wegen ihrer zierlichen Gestalt, der Anmuth ihrer Bewegungen und ihres ansprechenden Wesens Gnade vor unseren Augen gefunden. Hierher gehören namentlich auch die Baukünstler unter dieser Familie, welche die kunstreichsten Nester unter allen Säugethieren überhaupt anlegen und durch ihre geringe Anzahl und den unbedeutenden Nahrungsverbrauch wenig lästig werden, während andere, welche in ihrer Weise auch Baukünstler sind und sich größere oder kleinere Höhlen anlegen, gerade hierdurch sich verhaßt machen. Einige Arten, welche die kälteren und gemäßigten Gegenden bewohnen, halten einen Winterschlaf und tragen vorher Nahrungsvorräthe ein; andere unternehmen zeitweilig in ungeheuren Scharen Wanderungen, welche ihnen aber gewöhnlich verderblich werden.
Für die Gefangenschaft eignen sich wenige Arten; denn bloß der geringste Theil aller Mäuse erfreut durch leichte Zähmbarkeit und Verträglichkeit mit anderen seiner Art. Die übrigen bleiben auch im Käfige unangenehme, unverträgliche, bissige Geschöpfe, welche die ihnen gewidmete Freundschaft und Pflege schlecht vergelten. Eigentlichen Nutzen gewähren die Mäuse nie; denn wenn man auch von dieser oder jener Art das Fell benutzt oder selbst das Fleisch ißt, kommt beides doch nicht in Betracht gegen den außerordentlichen Schaden, welchen die Gesammtheit der Familie anrichtet.
Die Rennmäuse bilden eine Unterabtheilung der ersten Hauptgruppe und werden deshalb in einer besondern Unterfamilie ( Merionides ) von der Verwandtschaft getrennt. Ihr Leib ist eher untersetzt als gestreckt, der Hals kurz und dick, der Kopf ziemlich kurz, hinten breit, nach vorn zu verschmälert, die Schnauze zugespitzt, der Schwanz fast von Körperlänge, regelmäßig dicht behaart, zuweilen sogar gepinselt, niemals nackt. Die hinteren Glieder sind etwas länger als die vorderen, die Füße fünfzehig; doch ist der vordere Daumen eigentlich nur eine Warze mit glattem Nagel, während die übrigen Zehen kurze, schwach gekrümmte und zugespitzte Krallen tragen. Ohren und Augen sind sehr groß. Der Pelz ist dicht, glatt anliegend und weich, auf der Oberseite regelmäßig rostigbraun oder fahl, auf der Unterseite heller oder weiß, ohne daß sich jedoch diese Färbung scharf von der obern absetzt. Die Nagezähne sind meist gefurcht und dunkel gefärbt, die Backenzähne, drei in jeder Reihe, nehmen nach hinten an Größe ab. Der Schädel ähnelt bis auf die stark aufgetriebenen Paukenknochen dem der Ratten; die Wirbelsäule besteht aus 7 Hals-, 12 bis 13 rippentragenden, 6 bis 7 rippenlosen, 4 Kreuz- und 20 bis 31 Schwanzwirbeln.
Das Verbreitungsgebiet der Rennmäuse beschränkt sich auf Afrika, das südliche Asien und das südöstliche Europa. Sie leben am liebsten in den angebauten Gegenden, finden sich aber auch in den dürrsten Ebenen und Steppen, oft in außerordentlicher Menge. Manche Arten sind gesellig
und vereinigen sich zu Scharen, welche dann ebenso schädlich werden wie unsere Feldmäuse. Die meisten graben sich ziemlich seichte, unterirdische Gänge, in denen sie den Tag verbringen. Mit Einbruch der Dämmerung kommen sie hervor, um nach Nahrung auszugehen. Ihre Bewegungen sind außerordentlich rasch und lebhaft; einzelne sollen im Stande sein, bedeutende Sätze zu machen. Scheu und furchtsam, wie die übrigen Mäuse, flüchten sie bei der geringsten Störung eiligst nach ihren Löchern. Ihre Nahrung besteht in allerlei Samen und Wurzeln, namentlich auch in Getreide. Auf bebauten Feldern richten sie arge Verwüstungen an, beißen die Aehren ab und schleppen sie nach ihrer Wohnung, wo sie dieselben ungestört und gemächlich verzehren oder ausdreschen, um die Körner für ungünstige Zeiten aufzuspeichern. Die Vorräthe, welche sie sich eintragen, sind so bedeutend, daß arme Leute durch Ausgraben derselben eine ziemlich reiche Ernte halten können; denn man findet oft in einem Umkreise von zwanzig Schritten mehr als einen Scheffel der schönsten Aehren unter der Erde verborgen. Wie unseren Ratten, ist den Rennmäusen aber auch thierische Nahrung willkommen, und vorzüglich die Kerbthiere haben in ihnen Feinde. Es scheint, daß sie das Wasser zu entbehren im Stande sind; wenigstens findet man sie nicht selten in dürren Ebenen, meilenweit von Bächen oder Brunnen entfernt, ohne daß man ihnen Mangel anmerken könnte.
Wegen der Verwüstungen, welche die Rennmäuse in den Feldern anrichten, werden sie von den Einwohnern ihrer Heimat ebenso gehaßt und verfolgt wie unsere Ratten. Sie zu vertreiben, ist nicht möglich, so eifrig man ihnen auch nachstellen mag; denn ihre Vermehrung ist so bedeutend, daß alle Niederlagen, welche der Mensch etwa einer Art beibringen kann, bald durch deren Fruchtbarkeit wieder ausgeglichen sind. Genaueres über ihre Fortpflanzung im Freien ist nicht bekannt; man weiß nur, daß die Weibchen mehrmals im Jahre ziemlich zahlreiche Nachkommenschaft zur Welt bringen.
Von einigen Arten rühmt man ihr angenehmes Betragen in der Gefangenschaft. Sie sollen sich ebenso durch Beweglichkeit und Reinlichkeit wie durch Sanftmuth und Verträglichkeit auszeichnen, letztere jedoch nur so lange, als ihnen nichts abgeht, bethätigen, entgegengesetztenfalls, zumal wenn sie Mangel leiden, jedoch ebenfalls als räuberische Thiere erweisen.
Die Sandrennmaus ( Psammomys obesus ) hat etwa die Größe unserer Wanderratte, aber einen weit kürzern Schwanz, da derselbe bei 32 Centim. Gesammtlänge nur 13 Centim. mißt, und ist oben röthlich sandfarben, schwarz gesprenkelt, an den Seiten und unten lichtgelb. Die Wangen sind gelblich weiß, fein schwarz gestrichelt, die Ohren hellgelb, die Pfoten licht ockerfarben. Von den Schnurren sind einige schwarz, andere weiß, einige endlich an der Wurzel schwarz und an der Spitze licht. Das wesentliche Merkmal der Sippe bilden die nicht gefurchten Schneidezähne, welche nur am Innenrande eine mehr angedeutete als ausgebildete Rinne zeigen.
In Egypten sieht man diese Maus auf sandigen Stellen der Wüste, besonders häufig auch auf jenen Schuttbergen, welche alle Städte des Pharaonenlandes umgeben. Sie legt sich vielfach verzweigte, ziemlich tiefe Röhren und Gänge an, am liebsten unter und zwischen dem niedern Gestrüpp und den wenigen kriechenden Pflanzen, welche ihre Wohnorte spärlich genug bedecken und ihr zugleich das tägliche Brot bieten. Da sie auch am Tage vor dem Baue erscheint, kann man sie leicht beobachten. Oft sieht man ihrer zehn bis fünfzehn umherrennen, mit einander spielend verkehren, von dieser und jener Pflanze naschen. Ein herannahender Mensch oder ein herrenloser Hund verscheucht die ganze Gesellschaft augenblicklich; aber es dauert nicht lange, und hier und da guckt wieder ein Köpfchen aus den Löchern hervor, und wenn alles ruhig bleibt, ist die ganze Gesellschaft in kurzem wieder außerhalb der sicheren Baue. Ob sie ihrem Namen besondere Ehre macht, lasse ich dahingestellt sein; ich habe nicht wahrgenommen, daß sie durch besondere Schnelligkeit im Laufen sich auszeichnet. Ueber ihr Familienleben habe ich keine Beobachtungen gemacht.
Die Araber sehen in den Rennmäusen unreine Thiere und verfolgen sie nicht. Um so eifriger beschäftigen sich die Straßenhunde mit der Jagd solch leckern Wildes, und oft sieht man einen dieser Köter mit der innigsten Theilnahme und lebhaftesten Spannung vor einem der Ausgänge stehen.
Das Gefangenleben hat Dehne am besten und ausführlichsten beschrieben. »Im Käfige«, sagt er, »muß man diese Thiere sehr warm halten, weil sie gegen die Kälte im hohen Grade empfindlich sind. An mehreren Orten, z. B. im Berliner Thiergarten, haben sie sich fortgepflanzt, sind aber noch immer selten in den Sammlungen der Liebhaber oder in den Museen. Ich erhielt ein Männchen ohne Angabe des Alters aus Berlin; es starb aber sehr bald, weil es zu fett geworden war. Es fraß Pflaumen, Aepfel, Kirschen, Birnen, Himbeeren, Erdbeeren, Mais, Hafer, Hanfsamen, Brod, Milch, Semmel, Zwieback etc. An gekochten Kartoffeln, Runkelrüben, Möhren nagte es nur dann und wann aus langer Weile; aber Pflaumenkerne wurden begierig geöffnet, um zu deren Inhalte zu gelangen, welcher ihm zur Arznei, vielleicht zur Beförderung der Verdauung zu dienen schien. Das Thier war reinlich und hatte im Käfige ein besonderes Plätzchen für seinen Unrath, welcher im Verhältnis zu seiner Größe sehr klein, kaum etwas größer als der von der Hausmaus war. Einen üblen Geruch verbreitete es nicht, harnte überhaupt so wenig, daß die untergestreuten Sägespäne stets trocken blieben. An den Drähten des Käfigs nagte es stundenlang, versuchte aber nie eine Oeffnung zu machen. Wenn es sich auf die Hinterfüße setzte, erinnerte es an die bekannten Stellungen der Springmäuse. Die Vorderfüße waren beinahe unter dem langen, seidenartigen Pelze versteckt. Eine eigentliche Stimme habe ich nie von ihm gehört, sondern nur manchmal einen in Zwischenräumen von mehreren Sekunden wiederholten Ton, welcher wie unterdrücktes Husten klang. Später bekam ich ein halb ausgewachsenes Weibchen. Es ist weit lebhafter als das Männchen. Die ganze Nacht läuft es im Käfige hin und her; den Tag verbringt es mit Schlafen. Im Schlafe sitzt es auf den Hinterfüßen, den Kopf zwischen die Schenkel gesteckt und den Schwanz kreisförmig unter den Kopf gelegt.
»Am 1. September warf eine Sandrennmaus sechs Junge. Ich entfernte das Männchen aus dem Käfige und gab der Mutter frisches Heu, woraus sie sich alsbald ein bequemes Nest verfertigte. Die neugeborenen Jungen hatten das Aussehen junger Wanderratten, schienen aber um ein wenig größer zu sein. Ihre Mutter war sehr besorgt um sie und verdeckte sie, wenn sie das Lager verließ, mit Heu. Manchmal, namentlich in der ihr sehr wohlthuenden Mittagshitze, legte sie sich beim Säugen auf die Seite, so daß man die Jungen gut beobachten konnte. Diese waren sehr lebhaft und saugten mit Begierde. Vier Tage nach ihrer Geburt waren sie schon ganz grau, am sechsten Tage ihres Lebens hatten sie die Größe der Zwergmäuse, und der ganze Oberkörper war mit einem außerordentlich feinen Flaum von schieferblauer Farbe bedeckt. Ihr Wachsthum ging rasch von statten. Am dreizehnten Tage waren sie überall mit kurzen Haaren bedeckt, der Oberkörper hatte schon die eigenthümliche, rehfahle Farbe der Alten, und die schwarze Schwanzspitze konnte man bereits deutlich erkennen. Sie liefen manchmal, wenn auch noch etwas unbeholfen und schwerfällig, um ihr Lager und machten, obgleich noch blind, öfters Männchen und putzten sich. Die Mutter versuchte sie aber immer der Beobachtung zu entziehen, nahm eine nach der andern ins Maul, brachte sie eiligst nach dem Neste zurück und verbarg sie dort sorgfältig. Wenn man längere Zeit in ihrer Nähe verweilte, wurde sie sehr ängstlich und lief mit der größten Schnelligkeit im Käfige herum, eines oder das andere der Jungen im Maule tragend. Man glaubte, befürchten zu müssen, daß sie die zarten Thierchen verletzen möchte; doch war dies nie der Fall, und die Jungen gaben auch kein Zeichen des Schmerzes oder Unbehagens. Am sechszehnten Tage ihres Lebens wurden sie sehend. Nun benagten sie schon Hafer, Gerste, Mais, und einige Tage später konnte man sich auch durch das Gehör von der Thätigkeit ihrer Nagezähne überzeugen. Am einundzwanzigsten Tage hatten sie die Größe der Hausmäuse, am fünfundzwanzigsten die der Waldmäuse. Jetzt saugten sie nur selten, doch bemerkte ich dies von einigen noch, nachdem sie über einen Monat alt geworden waren. Sie fraßen schon von allem, was ihre Mutter zur Nahrung bekam: in Wasser gequellte Semmel, Zwieback, Brod, Hafer, Gerste, Mais. Der letztere behagte ihnen
vorzüglich, wenn er frisch abgenommen und noch etwas weich war. Hanfsamen, Kürbißkörner liebten sie sehr; aus Birnen, Aepfeln und anderem Obste schienen sie sich wenig zu machen: sie kosteten nur zuweilen etwas davon.
»Am 5. Oktober gab das seit dem 1. September abgesperrte Männchen zum erstenmale deutlich wahrnehmbare Töne von sich. Sie bestanden aus girrenden, trillernden Strophen, in denen zum Theil etwas Melodie lag, ähnlich denen des Meerschweinchens, nur schwächer. Dieser Gesang dauerte wohl eine Viertelstunde; früher hatte ich nie etwas ähnliches von meinem Gefangenen vernommen. Am 6. Oktober bemerkte ich zu meinem großen Erstaunen, daß die Mutter der zur Welt gekommenen Jungen schon wieder fünf Kleine geboren hatte. Sie war demnach sechsunddreißig Tage trächtig gegangen und hatte sich also gleich nach ihrer Entbindung wieder mit ihrem Männchen begattet.
»Man kann die Sandrennmaus den hübschesten Thieren beizählen, welche man aus der Ordnung der Nager zum Vergnügen hält. Sie wird ungemein zahm, verläßt den Käfig, läuft sorglos auf dem Tische umher und läßt sich ergreifen und nehmen, ohne Miene zum Beißen zu machen. Ihre großen, nicht sehr vorstehenden Augen und ihr schöner Pelz tragen viel zum angenehmen Eindrucke bei, welchen sie auf den Beschauer macht; selbst ihr dichtbehaarter Schwanz mit schwarzer Endquaste gereicht ihr sehr zur Zierde.
»Da die Sandrennmaus, als Nachtthier, vorzugsweise von der Abend- bis zur Morgendämmerung ihr Wesen treibt, ihrer Nahrung nachgeht und unter Hüpfen, Laufen und Spielen die Zeit hinbringt, bietet ihr natürlich der enge Käfig zu wenig Raum dar, um unbeschadet des Nestes die mannigfaltigen Körperübungen vorzunehmen. Daher sah man auch von dem Neste, so lange die Jungen blind waren, in der Nacht fast keine Spur, und alles war gleichförmig zusammengetreten. Die Jungen waren zugedeckt, und man würde, wenn sie nicht zuweilen sich durch eine Bewegung bemerklich gemacht hätten, kaum geglaubt haben, daß außer der Mutter noch lebende Junge im Käfige sich befanden.«
Die Ur- und Vorbilder der Familie, die Mäuse im engern Sinne (Murina), sind infolge ihrer Zudringlichkeit als Gäste des Menschen in ihrem Treiben und Wesen nur zu bekannt. Unter ihnen finden sich jene Arten, welche sich mit den Menschen über die ganze Erde verbreitet und gegenwärtig auch auf den ödesten Inseln angesiedelt haben. Es ist noch nicht so lange her, daß diese Weltwanderung der Thiere stattfand; ja man kennt an vielen Orten noch genau die Jahreszahl, in welcher sie zuerst auftraten: gegenwärtig aber haben sie ihre Rundreise um den Erdball vollendet. Nirgends dankt ihnen der Mensch die unverwüstliche Anhänglichkeit, welche sie an seine Person, an sein Haus und seinen Hof an den Tag legen, überall verfolgt und haßt er sie auf das schonungsloseste, alle Mittel setzt er in Bewegung, um sich von ihnen zu befreien: und dennoch bleiben sie ihm zugethan, treuer noch als der Hund, treuer als irgend ein anderes Thier. Leider sind diese anhänglichen Hausfreunde abscheuliche Hausdiebe, wissen sich mit ihren spitzbübischen Werkzeugen überall einzunisten und bereiten ihrem Gastfreunde nur Schaden und Verlust. Hieraus erklärt sich, daß alle wahren Mäuse schlechtweg häßliche, garstige Thiere genannt werden, obgleich sie dies in Wahrheit durchaus nicht sind, im Gegentheile vielmehr als schmucke, anmuthige, nette Gesellen bezeichnet werden müssen.
Im allgemeinen kennzeichnen die Mäuse, welche man in einer zweiten Unterfamilie vereinigt, die spitze, behaarte Schnauze, die breite, gespaltene Oberlippe, die in fünf Reihen geordneten, langen und starken Schnurren, die großen, runden, tiefschwarzen Augen, die frei aus dem Pelze hervorragenden Ohren und vor allem der lange, nackte, bloß spärlich mit steifen Härchen bekleidete, anstatt der Behaarung mit viereckigen und verschoben viereckigen Schuppen bedeckte Schwanz. Die Vorderfüße haben vier Zehen und eine Daumenwarze, die Hinterfüße sind fünfzehig. Im Gebisse finden sich drei Backenzähne in jedem Kiefer, welche von vorn nach hinten zu an Größe abnehmen. Ihre Kaufläche ist höckerig, schleift sich aber mit der Zeit mehr und mehr ab, und dann entstehen quere Schmelzbänder, welche in hohem Alter ebenfalls verschwinden können. Der Pelz besteht aus kurzem, wolligen Grundhaar und längeren, steifen Grannen, welche abgeplattet erscheinen. In der Pelzfärbung sind Schwarzbraun und Weißgelb vorwiegend.
Schon im gewöhnlichen Leben unterscheidet man zwei Hauptgruppen, die Ratten und Mäuse, und diese Unterscheidung nimmt auch die Wissenschaft an. Die Ratten sind die plumperen und häßlicheren, die Mäuse die leichteren und zierlicheren Gestalten. Bei jenen hat der Schwanz zwischen 200 und 260 Schuppenringe, bei diesen nur zwischen l20 und 180; dort sind die Füße dick und kräftig, hier schlank und fein; die Ratten werden im ausgewachsenen Zustande über 30 Centim., die Mäuse nur gegen 24 Centimeter lang; jene haben getheilte Querfalten im Gaumen, bei diesen sind die Querfalten erst von der zweiten an in der Mitte getheilt. Man ersieht hieraus, daß diese Unterscheidungsmerkmale immerhin einer ziemlich sorgfältigen Prüfung bedürfen und eigentlich nur für den Forscher von Fach besonderen Werth haben. In ihrem Leben dagegen unterscheiden sich die eigentlichen Ratten von den wahren Mäusen auffallend genug.
Mit ziemlicher Sicherheit dürfen wir annehmen, daß die Ratten, welche gegenwärtig in Europa hausen, ursprünglich hier nicht heimisch waren, vielmehr einwanderten. In den Schriften der Alten findet sich nur eine einzige Stelle, welche auf Ratten bezogen werden kann; es bleibt aber unklar, welche Art Amyntas, dessen Mittheilungen Aelian widergibt, gemeint haben mag. Nachweislich fand sich die Hausratte zuerst in Europa und Deutschland ein oder vor; ihr folgte die Wanderratte und dieser endlich in der neuesten Zeit die aus Egypten stammende Dachratte (Mus alexandrinus). Zur Zeit wohnen die erstgenannten beiden, hier und da auch wohl alle drei Arten noch nebeneinander; die Wanderratte, als die stärkste von allen, vertreibt und vernichtet jedoch die beiden Verwandten und bemächtigt sich mehr und mehr der Alleinherrschaft. Hoffen wir, daß wir es nicht noch mit anderen reiselustigen Gliedern der Familie zu thun bekommen, daß wir insbesondere verschont bleiben von einer Einwanderung der Hamsterratte ( Mus oder Cricetomys Gambianus), welche unsere Ratten nicht allein an Größe, sondern auch hinsichtlich ihrer Thätigkeit bei weitem übertrifft und gegenwärtig den Kaufleuten Sansibars mehr zu schaffen macht als alle europäischen Ratten zusammengenommen: wir würden, käme dieses Thier zu uns, erst erfahren, was eine Ratte zu leisten vermag!
Einstweilen genügt es, wenn ich die beiden bekanntesten Arten, die Haus- und die Wanderratte, schildere, so gut ich vermag.
Die Hausratte ( Mus Rattus ) erreicht 16 Centim. Leibes-, 19 Centim. Schwanz-, also 35 Centim. Gesammtlänge und ist oberseits dunkel braunschwarz, unterseits ein wenig heller grauschwarz gefärbt. Das an der Wurzel schwarzgraue Haar zeigt grünlichen Metallschimmer. Die Füße haben graubraune, seitlich etwas lichtere Färbung. An dem verhältnismäßig schlanken Schwanze zählt man 260 bis 270 Schuppenringe. Weißlinge sind nicht selten.
Wann diese Art zuerst in Europa erschienen ist, läßt sich mit Gewißheit nicht bestimmen. Albertus Magnus ist der erste Thierkundige, welcher sie als deutsches Thier aufführt; demnach war sie also im zwölften Jahrhundert bereits bei uns heimisch. Geßner behandelt sie als ein Thier, welches »manchem mer bekannt dann jm lieb«; der Bischof von Autun verhängt, anfangs des fünfzehnten Jahrhunderts, den Kirchenbann über sie; in Sondershausen setzt man ihretwegen einen Buß- und Bettag an. Möglicherweise stammt sie aus Persien, wo sie noch gegenwärtig in unglaublicher Anzahl vorkommt. Bis in die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts genoß sie in Europa die Alleinherrschaft; von dieser Zeit an hat ihr die Wanderratte das Gebiet streitig gemacht. Anfangs haben beide eine Zeitlang neben einander gewohnt; bald aber ist jene überwiegend geworden und sie in demselben Maße verschwunden, wie die Wanderratte vordrang. Doch ist sie zur Zeit noch so ziemlich über alle Theile der Erde verbreitet, kommt aber nur selten in geschlossenen Massen, sondern fast überall einzeln vor. Auch sie folgte dem Menschen in alle Klimate der Erde, wanderte mit ihm zu Lande und Meere durch die Welt. Unzweifelhaft war sie früher in Amerika, Australien und Afrika nicht heimisch; aber die Schiffe brachten sie an alle Küsten, und von den Küsten aus wanderten sie weiter und weiter ins Innere. Gegenwärtig findet man sie auch in den südlichen Theilen von Asien, zumal in Persien und Indien, in Afrika, vorzüglich in Egypten und der Berberei, sowie am Kap der guten Hoffnung, in Amerika aller Orten und in Australien nicht nur in jeder europäischen Ansiedelung, sondern auch auf den Inseln des Stillen Weltmeeres.

Hausratte ( Mus Rattus). [2/3] natürl. Größe.
Die Wanderratte ( Mus decumanus, Mus hibernicus, silvestris und aquaticus, Glis norwagicus) ist um ein beträchtliches größer, nämlich einschließlich des 18 Centim. messenden Schwanzes 42 Centim. lang, und ihre Färbung auf der Ober- und Unterseite des Leibes verschieden. Der Obertheil des Körpers und Schwanzes ist bräunlichgrau, die Unterseite scharf abgesetzt grauweiß, die Mittellinie des Rückens gewöhnlich etwas dunkler als die Seite des Leibes, welche mehr ins Gelblichgraue spielt. Der Haargrund ist oben braungrau, unten lichter, meist blaßgrau. Der Schwanz hat etwa 210 Schuppenringe. Zuweilen finden sich auf der Oberseite der Vorderfüße bräunliche Härchen; auch kommen Weißlinge mit rothen Augen vor.

Wanderratte ( Mus decumanus). ½ natürl. Größe.
Mit großer Wahrscheinlichkeit läßt sich annehmen, daß das ursprüngliche Vaterland der Wanderratte Mittelasien, und zwar Indien oder Persien gewesen ist. Möglicherweise hat bereits Aelian ihrer gedacht, indem er erzählt, daß die »kaspische Maus« zu gewissen Zeiten in unendlicher Menge einwandert, ohne Furcht über die Flüsse schwimmt und sich dabei mit dem Maule an den Schwanz des Vordermannes hält. »Kommen sie auf die Felder«, sagt er, »so fällen sie das Getreide und klettern auf die Bäume nach den Früchten, werden aber häufig von Raubvögeln, welche wie Wolken herbeifliegen, und von der Menge der dortigen Füchse vertilgt. Sie geben in der Größe dem Ichneumon nichts nach, sind sehr wild und bissig und haben so starke Zähne, daß sie damit selbst Eisen zernagen können, wie die Mäuse Canautanes bei Babylon, deren zarte Felle nach Persien geführt werden und zum Füttern der Kleider dienen.« Erst Pallas beschreibt die Wanderratte mit Sicherheit als europäisches Thier und berichtet, daß sie im Herbste 1727 nach einem Erdbeben in großen Massen aus den kaspischen Ländern und von der kumänischen Steppe aus in Europa eingerückt sei. Sie setzte bei Astrachan in großen Haufen über die Wolga und verbreitete sich von hier rasch nach Westen hin. Fast zu derselben Zeit, im Jahre 1732 nämlich, wurde sie auf Schiffen von Ostindien aus nach England verschleppt, und nunmehr begann sie auch von hier aus ihre Weltwanderung. In Ostpreußen erschien sie im Jahre 1750, in Paris bereits 1753, in Deutschland war sie schon 1780 überall häufig; in Dänemark kennt man sie erst seit ungefähr siebzig Jahren und in der Schweiz erst seit dem Jahre 1809 als einheimisches Thier. Im Jahre 1755 wurde sie nach Nordamerika verschleppt und erlangte hier ebenfalls in kürzester Zeit eine unglaublich große Verbreitung; doch war sie im Jahre 1825 noch nicht weit über Kingston hinaus in Oberkanada vorgedrungen, und noch vor wenigen Jahren hatte sie den oberen Missouri noch nicht erreicht. Wann sie in Spanien, Marokko, Algerien, Tunis, Egypten, am Kap der guten Hoffnung und in anderen Häfen Afrikas erschien, läßt sich nicht bestimmen; soviel aber steht fest, daß sie gegenwärtig auch über alle Theile des großen Weltmeeres verbreitet und selbst auf den ödesten und einsamsten Inseln zu finden ist. Größer und stärker als die Hausratte, bemächtigt sie sich überall der Orte, wo diese früher ruhig lebte, und nimmt in demselben Grade zu, wie jene abnimmt. Glaubwürdige Beobachter versichern, daß sie noch gegenwärtig zuweilen in Scharen von einem Orte zum anderen zieht. »Mein Schwager«, schreibt mir Dr. Helms, »traf einmal an einem frühen Herbstmorgen im Vördenschen einen solchen wandernden Zug, den er auf mehrere tausend Stück schätzen mußte.«
In der Lebensweise, in den Sitten und Gewohnheiten, im Vorkommen etc. stimmen beide Ratten so sehr überein, daß man die eine schildert, indem man die andere beschreibt. Wenn man festhalten will, daß die Wanderratte mehr in den unteren Räumlichkeiten der Gebäude und namentlich in feuchten Kellern und Gewölben, Abzugsgräben, Schleußen, Senkgruben, Flethen und an Flußufern sich eingenistet hat, während die Hausratte den obern Theil des Hauses, die Kornböden, Dachkammern etc. vorzieht, wird nicht viel mehr übrig bleiben, was beiden Arten nicht gemeinsam wäre. Die eine wie die andere Art dieses Ungeziefers bewohnt alle nur möglichen Räumlichkeiten der menschlichen Wohnungen und alle nur denkbaren Orte, welche Nahrung versprechen. Vom Keller an bis zum Dachboden hinauf, vom Prunkzimmer an bis zum Abtritt, vom Palast an bis zur Hütte, überall sind sie zu finden. An den unsaubersten Orten nisten sie sich ebenso gern ein als da, wo sie sich erst durch ihren eigenen Schmutz einen zusagenden Wohnort schaffen müssen. Sie leben im Stalle, in der Scheuer, im Hofe, im Garten, an Flußufern, an der Meeresküste, in Kanälen, den unterirdischen Ableitungsgräben größerer Städte etc., kurz überall, wo sie nur leben können, obschon die Hausratte ihrem Namen immer Ehre zu machen sucht und sich möglichst wenig von der eigentlichen Wohnung der Menschen entfernt. Ausgerüstet mit allen Begabungen in leiblicher und geistiger Hinsicht, welche sie zu Feinden des Menschen machen können, sind sie unablässig bemüht, diesen zu quälen, zu plagen, zu peinigen, und fügen ihm ohne Unterbrechung den empfindlichsten Schaden zu. Gegen sie schützt weder Hag noch Mauer, weder Thüre noch Schloß: wo sie keinen Weg haben, bahnen sie sich einen; durch die stärksten Eichenbohlen und durch dicke Mauern nagen und wühlen sie sich Gänge. Nur, wenn man die Grundmauern tief einsenkt in die Erde, mit festem Cement alle Fugen zwischen den Steinen ausstreicht und vielleicht zur Vorsorge noch zwischen dem Gemäuer eine Schicht von Glasscherben einfügt, ist man vor ihnen ziemlich sicher. Aber wehe dem vorher geschützten Raume, wenn ein Stein in der Mauer locker wird: von nun an geht das Bestreben dieser abscheulichen Thiere sicher dahin, nach dem bisher verbotenen Paradiese zu gelangen.
Und dieses Zerstören der Wohnungen, dieses abscheuliche Zernagen und Durchwühlen der Wände ist doch das geringste Unheil, welches die Ratten anrichten. Weit größern Schaden verursachen sie durch ihre Ernährung. Ihnen ist alles genießbare recht. Der Mensch ißt nichts, was die Ratten nicht auch fräßen, und nicht beim Essen bleibt es, sondern es geht auch an das, was der Mensch trinkt. Es fehlt bloß noch, daß sie sich in Schnaps berauschten, dann würden sie sämmtliche Nahrungs- und Genußmittsl, welche das menschliche Geschlecht verbraucht, aufzehren helfen. Nicht zufrieden mit dem schon so reichhaltigen Speisezettel, fallen die Ratten ebenso gierig über andere Stoffe, zumal auch über lebende Wesen her. Die schmutzigsten Abfälle des menschlichen Haushaltes sind ihnen unter Umständen noch immer recht; verfaulendes Aas findet an ihnen Liebhaber. Sie fressen Leder und Horn, Körner und Baumrinde, oder besser gesagt, alle nur denkbaren Pflanzenstoffe, und was sie nicht fressen können, zernagen sie wenigstens. Es sind verbürgte Beispiele bekannt, daß sie kleine Kinder bei lebendigem Leibe angefressen haben, und jeder größere Gutsbesitzer hat erfahren, wie arg sie seinen Hofthieren nachstellen. Sehr fetten Schweinen fressen sie Löcher in den Leib, dicht zusammengeschichteten Gänsen die Schwimmhäute zwischen den Zehen weg, junge Enten ziehen sie ins Wasser und ersäufen sie dort, dem Thierhändler Hagenbeck tödteten sie drei junge afrikanische Elefanten, indem sie diesen gewaltigen Thieren die Fußsohlen zernagten.
Wenn sie mehr als gewöhnlich an einem Orte sich vermehren, ist es wahrhaftig kaum zum Aushalten. Und es gibt solche Orte, wo sie in einer Menge auftreten, von welcher wir uns glücklicherweise keinen Begriff machen können. In Paris erschlug man während vier Wochen in einem einzigen Schlachthause 16,000 Stück, und in einer Abdeckerei in der Nähe dieser Hauptstadt verzehrten sie binnen einer einzigen Nacht fünfunddreißig Pferdeleichen bis auf die Knochen. Sobald sie merken, daß der Mensch ihnen gegenüber ohnmächtig ist, nimmt ihre Frechheit in wahrhaft erstaunlicher Weise zu; und wenn man sich nicht halb zu Tode ärgern möchte über die nichtswürdigen Thiere, könnte man versucht sein, über ihre alles Maß überschreitende Unverschämtheit zu lachen. Während meiner Knabenzeit hatten wir in unserer baufälligen Pfarrwohnung einige Jahre lang keine Katzen, welche auf Ratten gingen, sondern nur schlechte, verwöhnte, welche höchstens einer Maus den Garaus zu machen wagten. Da vermehrten sich die Ratten derart, daß wir nirgends mehr Ruhe und Rast vor ihnen hatten. Wenn wir mittags auf dem Vorsale speisten, kamen sie lustig die Treppe herabspaziert, bis dicht an unsern Tisch heran und sahen, ob sie nicht etwas wegnehmen könnten. Standen wir auf, um sie zu vertreiben, so rannten sie zwar weg, waren aber augenblicklich wieder da und begannen das alte Spiel von neuem. Nachts rasselte es unter allen Dächern und unter dem Fußboden, als ob ein wildes Heer in Bewegung wäre. Im ganzen Hause spukte es. Das waren Hausratten, also noch immer die bessere Sorte dieses Ungeziefers; denn die Wanderratten treiben es noch viel schlimmer. Las Cases erzählt, daß Napoleon am 27. Juni 1816 nebst seinen Gefährten ohne Frühstück bleiben mußte, weil die Ratten in der vergangenen Nacht in die Küche eingedrungen waren und alles fortgeschleppt hatten. Sie waren dort in großer Menge vorhanden, sehr böse und außerordentlich unverschämt. Gewöhnlich brauchten sie nur wenige Tage, um die Mauern und Breterwände der armseligen Wohnung des Kaisers zu durchnagen. Während der Mahlzeit Napoleons kamen sie in den Saal, und nach dem Essen wurde förmlich Krieg mit ihnen geführt. Als der Kaiser einst abends seinen Hut wegnehmen wollte, sprang eine große Ratte aus diesem heraus. Die Stallleute wollten gern Federvieh halten, mußten aber darauf verzichten, weil die Ratten es wegfraßen. Diese holten das Geflügel nachts sogar von den Bäumen herunter, auf welchen es schlief. Seeleute sind dieser Nager halber oft sehr übel daran. Es gibt kein größeres Schiff ohne Ratten. Auf den alten Fahrzeugen sind sie nicht auszurotten, und die neuen besetzen sie augenblicklich, sobald die erste Ladung eingenommen wird. Auf langen Seereisen vermehren sie sich, zumal, wenn sie genug zu fressen haben, in bedeutender Menge, und dann ist kaum auf dem Schiffe zu bleiben. Als Kane's Schiff bei seiner Polarreise in der Nähe des 80. Breitengrades festgefroren war, hatten die Ratten so überhand genommen, daß sie fürchterlichen Schaden thaten. Endlich beschloß man, sie zu Tode zu räuchern. Man schloß alle Luken und brannte unten im Schiffe ein Gemisch von Schwefel, Leder und Arsenik an. Die Mannschaft brachte die kalte Nacht des letzten Septembers auf dem Deck zu. Am nächsten Morgen sah man, daß dieses furchtbare Mittel gar nichts geholfen hatte. Die Ratten waren noch munter. Jetzt brannte man eine Menge von Holzkohlen an und gedachte, die Thiere durch das sich entwickelnde Gas zu vergiften. In kurzer Zeit war auch der geschlossene Raum so stark mit Gas erfüllt, daß zwei Leute, welche sich unvorsichtiger Weise hinabgewagt hatten, sofort besinnungslos zu Boden fielen und nur mit großer Mühe aufs Deck gebracht werden konnten. Eine hinabgesenkte brennende Laterne verlosch augenblicklich; allein plötzlich gerieth an einer andern Stelle des Fahrzeugs ein Kohlenvorrath und mit ihm ein Theil des Schiffes in Glühen, und nur mit der größten Anstrengung, ja mit wirklicher Lebensgefahr des Schiffsführers, gelang es, das Feuer zu löschen. Am folgenden Tage fand man bloß achtundzwanzig Rattenleichen, und die überlebenden vermehrten sich bis zum nächsten Winter in so großer Menge, daß man nichts mehr vor ihnen retten konnte. Sie zerfraßen Pelze, Kleider, Schuhe, nisteten sich in die Betten, zwischen die Decken und Handschuhe ein, nahmen Herberge in Mützen und Vorrathskisten, verzehrten die Vorräthe und wichen allen Nachstellungen mit List und Schlauheit aus. Man verfiel auf ein neues Mittel. Der klügste und tapferste Hund wurde in ihre eigentliche Herberge, in den Schiffsraum hinabgelassen, um dort Ordnung zu stiften; aber bald verrieth sein jämmerliches Heulen, daß nicht er über die Ratten, sondern sie über ihn Herr wurden. Man zog ihn heraus und fand, daß die gehaßten Nager ihm die Haut von den Fußsohlen abgefressen hatten. Später erbot sich ein Eskimo, die Ratten allmählich mit Pfeilen zu erschießen, und war auch so glücklich, daß Kane, welcher sich die Beute kochen ließ, während des langen Winters beständig frische Fleischbrühe hatte. Zufällig fing man einen Fuchs und sperrte ihn in den Schiffsraum: dieser endlich räumte auf.
In allen Leibesübungen sind die Ratten Meister. Sie laufen rasch und geschickt, klettern vortrefflich, sogar an ziemlich glatten Wänden empor, schwimmen meisterhaft, führen mit Sicherheit ziemlich weite Sprünge aus und graben recht leidlich, wenn auch nicht gern ausdauernd nacheinander. Die stärkere Wanderratte scheint noch geschickter zu sein als die Hausratte, wenigstens schwimmt sie bei weitem besser. Ihre Tauchfähigkeit ist beinahe eben so groß wie die echter Wasserthiere. Sie darf dreist auf den Fischfang ausgehen; denn sie ist im Wasser behend genug, den eigentlichen Bewohnern der feuchten Tiefe nachzustelleu. Manchmal thut sie gerade, als ob das Wasser ihre wahre Heimat wäre. Erschreckt, flüchtet sie sich augenblicklich in einen Fluß, Teich oder Graben, und, wenn es sein muß, schwimmt sie in einem Zuge über die breiteste Wasserfläche oder läuft minutenlang auf dem Grunde des Beckens dahin. Die Hausratte thut dies bloß im größten Nothfalle, versteht jedoch die Kunst des Schwimmens ebenfalls recht gut.
Unter den Sinnen der Ratten stehen Gehör und Geruch obenan; namentlich das erstere ist vortrefflich, aber auch das Gesicht nicht schlecht, und der Geschmack wird nur allzuoft in Vorrathskammern bethätigt, wo die Ratten sicher immer die leckersten Speisen auszusuchen wissen. Ueber ihre geistigen Fähigkeiten brauche ich nach dem Angegebenen nicht mehr viel zu sagen. Verstand kann man ihnen wahrlich nicht absprechen, noch viel weniger aber eine berechnende List und eine gewisse Schlauheit, mit welcher sie sich den Gefahren der verschiedensten Art zu entziehen wissen.
Wie bereits bemerkt, herrscht zwischen den beiden Rattenarten ein ewiger Streit, welcher regelmäßig mit dem Untergänge der schwächeren Art endet; doch auch die einzelnen Ratten unter sich kämpfen und streiten beständig. Nachts hört da, wo sie häufig sind, das Poltern und Lärmen keinen Augenblick auf; denn der Kampf währt auch dann noch fort, wenn ein Theil bereits die Flucht ergreift. Recht alte, bissige Männchen werden zuweilen von der übrigen Gesellschaft verbannt und suchen sich dann einen stillen, einsamen Ort auf, wo sie mürrisch und griesgrämig ihr Leben verbringen.
Die Paarung geht unter lautem Lärmen und Quieken und Schreien vor sich; denn die verliebten Männchen kämpfen heftig um die Weibchen. Ungefähr einen Monat nach der Begattung werfen die letzteren fünf bis einundzwanzig Junge, kleine, allerliebste Thierchen, welche jedermann gefallen würden, wären sie nicht Ratten. »Am 1. März 1852«, berichtet Dehne, »bekam ich von einer weißen Ratte sieben Junge. Sie hatte sich in ihrem Drahtkäfige ein dichtes Nest von Stroh gemacht. Die Jungen hatten die Größe der Maikäfer und sahen blutroth aus. Bei jeder Bewegung der Mutter ließen sie ein feines, durchdringendes Piepen oder Quietschen hören. Am 8. waren sie schon ziemlich weiß; vom 13. bis 16. wurden sie sehend. Am 18. abends kamen sie zum ersten Male zum Vorschein; als aber die Mutter bemerkte, daß sie beobachtet wurden, nahm sie eine nach der anderen ins Maul und schleppte sie in das Nest. Einzelne kamen jedoch wieder aus einem andern Loche hervor. Allerliebste Thierchen von der Größe der Zwergmäuse, mit ungefähr drei Zoll langen Schwänzen! Am 2l. hatten sie schon die Größe gewöhnlicher Hausmäuse, am 28. die der Waldmäuse. Sie saugten noch dann und wann (ich sah sie sogar noch am 2. April saugen), spielten miteinander, jagten und balgten sich auf die gewandteste und unterhaltendste Weise, setzten sich auch wohl zur Abwechselung auf den Rücken der Mutter und ließen sich von derselben herumtragen. Sie übertrafen an Possirlichkeit bei weitem die weißen Hausmäuse. Am 9. April trennte ich die Mutter von ihren Jungen und setzte sie wieder zum Männchen; am 11. Mai warf sie abermals eine Anzahl Junge.
»Von den am 1. März zur Welt gekommenen hatte ich seit Anfang April ein Pärchen in einem großen Glase mit achtzölliger Mündung abgesondert gehalten, und schon am 11. Juni nachmittags, also im Alter von hundert und drei Tagen, gebar das Weibchen sechs Junge. Trotz der Weite des Glases schien der Mutter doch der Raum für ihre Jungen zu eng zu sein. Sie bemühte sich vergebens, ein weiteres Nest zu machen, wobei sie öfters die armen Kleinen so verscharrte, daß man nichts mehr von ihnen sah; doch fand sie dieselben immer bald wieder zusammen. Sie säugte ihre Jungen bis zum 23. ganz gut, und sie wurden bereits etwas weiß; auf einmal aber waren sie alle verschwunden: die Mutter hatte sie sämmtlich gefressen!
»Am Tage und nach Mitternacht schlafen die Wanderratten; früh und abends sieht man sie in größter Thätigkeit. Sehr gern trinken sie Milch; Kürbiskörner und Hanf gehören zu ihren Leckerbissen. Für gewöhnlich bekommen sie Brod, welches mit Wasser oder Milch oberflächlich angefeuchtet wurde; dann und wann erhalten sie auch gekochte Kartoffeln: letztere fressen sie sehr gern. Fleisch und Fett, Lieblingsgerichte für sie, entziehe ich ihnen sowie allen anderen Nagern, welche ich in der Gefangenschaft ernähre, gänzlich, da nach solchen Speisen ihr Harn und selbst ihre Ausdünstung stets einen widrigen, durchdringenden Geruch bekommt. Der eigenthümliche, so höchst unangenehme Geruch, welchen die gewöhnlichen Mäuse verbreiten und allen Gegenständen, die damit in Berührung kommen, dauernd mittheilen, fehlt den weißen Wanderratten gänzlich, wenn man sie in der angegebenen Weise hält.
»Die Wanderratten verrathen viel List. Wenn ihre hölzernen Käfige von außen mit Blech beschlagen sind, versuchen sie das Holz durchzunagen, und wenn sie eine Zeitlang genagt haben, greifen sie mit den Pfoten durch das Gitter, um die Stärke des Holzes zu untersuchen und zu sehen, ob sie bald durch sind. Beim Reinmachen der Käfige wühlen sie mit Rüssel und Pfoten den Unrath an die Oeffnung, um auf diese Weise desselben sich zu entledigen.
»Sie lieben die Gesellschaft ihres Gleichen. Oft machen sie sich ein gemeinschaftliches Nest und erwärmen sich gegenseitig, indem sie darin dicht zusammenkriechen; stirbt aber eine von ihrem, so machen sich die übrigen gleich über sie her, beißen ihr erst den Hirnschädel auf, fressen den Inhalt und verzehren dann nach und nach die ganze Leiche mit Zurücklassung der Knochen und des Felles. Die Männchen muß man, wenn die Weibchen trächtig sind, sogleich absperren; denn sie lassen diesen keine Ruhe und fressen auch die Jungen am ersten. Die Mutter hat übrigens viel Liebe zu ihren Kindern; sie bewacht dieselben sorgfältig, und diese erwidern ihr die erwiesene Zärtlichkeit auf alle nur mögliche Weise.
»Außerordentlich groß ist die Lebenszähigkeit dieser Thiere. Einst wollte ich eine ungefähr ein Jahr alte weiße Wanderratte durch Ersäufen tödten, um sie von einem mir unheilbar scheinenden Leiden, einer offenen, eiternden Wunde, zu befreien. Nachdem ich sie bereits ein halbes Dutzend Mal in eiskaltes Wasser mehrere Minuten lang getaucht hatte, lebte sie noch und putzte sich mit ihren Pfötchen, um das Wasser aus den Augen zu entfernen. Endlich sprang sie, indem ich den Topf öffnete, in den Schnee und suchte zu entfliehen. Nun setzte ich sie in einen Käfig auf eine Unterlage von Stroh und Heu und brachte sie in die warme Stube. Sie erholte sich bald so weit, daß man sah, das kalte Bad habe ihr nichts geschadet. Ihre Freßlust hatte gegen früher eher zu-, als abgenommen. Nach einigen Tagen setzte ich sie wieder aus der warmen Stube in ein ungeheiztes Zimmer, gab ihr aber Heu, und sie bereitete sich daraus auch alsbald ein bequemes Lager. Zu meinem Erstaunen bemerkte ich nun, daß der offene Schaden von Tag zu Tag kleiner wurde; die Entzündung schwand immer mehr, und nach ungefähr vierzehn Tagen war die Heilung vollständig erfolgt. Hier hatte also offenbar das eiskalte Bad die Entzündung gehoben und dadurch die Genesung bewerkstelligt. Kaum glaube ich, daß ein anderer verwandter Nager ein solches wiederholtes Bad ohne tödtlichen Ausgang überstanden haben würde, und nur aus der Lebensweise und Lebenszähigkeit der Wanderratten, deren zweites Element das Wasser ist, läßt sich ein so glücklicher Erfolg erklären.
»Die untern Nagezähne wachsen zahmen Ratten oft bis zu einer unglaublichen Länge und sind dann schraubenförmig gewunden. Ich habe auch gesehen, daß sie durch das Backenfell gewachsen waren und die Thiere derart am Fressen verhinderten, daß sie endlich verhungern mußten.«
Solche, im engen Gewahrsam gehaltene, gut gepflegte Ratten werden so zahm, daß sie sich nicht bloß berühren oder von Kindern als Spielzeug verwenden, sondern auch zum Aus- und Eingehen in Haus, Hof und Garten gewöhnen lassen, ihren Pflegern wie Hunde nachfolgen, auf den Ruf herbeikommen, kurz zu Haus- oder Stubenthieren im besten Sinne werden.
Im Freileben kommt unter den Ratten zuweilen eine eigenthümliche Krankheit vor. Mehrere von ihnen verwachsen unter einander mit den Schwänzen und bilden dann den sogenannten Rattenkönig, den man sich in früheren Zeiten freilich ganz anders vorstellte als gegenwärtig, wo man ihn in diesem oder jenem Museum sehen kann. Früher glaubte man, daß der Rattenkönig, geschmückt mit goldner Krone, auf einer Gruppe innig verwachsener Ratten throne und von hier aus den ganzen Rattenstaat regiere. Soviel ist sicher, daß man zuweilen eine größere Anzahl fest mit den Schwänzen verwickelter Ratten findet, welche, weil sie sich nicht bewegen können, von Mitleidigen ihrer Art ernährt werden müssen. Man glaubt, daß eine eigenthümliche Ausschwitzung der Rattenschwänze ein Aufeinanderkleben derselben zur Folge habe, ist aber nicht im Stande, etwas sicheres darüber zu sagen. In Altenburg bewahrt man einen Rattenkönig auf, welcher von siebenundzwanzig Ratten gebildet wird; in Bonn, bei Schnepfenthal, in Frankfurt, in Erfurt und in Lindenau bei Leipzig hat man andere aufgefunden. Der letztere ist von Amtswegen genau beschrieben worden, und ich halte es nicht für überflüssig, den Inhalt der betreffenden Akten hier folgen zu lassen.
»Am 17. Januar 1774 erscheint bei der Landstube zu Leipzig
Christian Kaiser, Mühlknappe zu Lindenau,
und bringt an:
Was maaßen er an vergangener Mittwoche frühe einen Rattenkönig von sechszehn Stück Ratten, welche mit den Schwänzen ineinander verflochten, in der Mühle zu Lindenau gefangen habe, welchen er, weil dieser auf ihn losspringen wollen, sofort todtgeschmissen. Diesen Rattenkönig habe
Johann Adam Faßhauer zu Lindenau
von seinem Herrn, Tobias Jägern, Müllern zu Lindenau, unter dem Vorwande: daß er solchen abmalen wolle, abgeholt, und nunmehr wolle er den Rattenkönig nicht wieder hergeben, habe auch seit der Zeit viel Geld damit verdient; er wolle daher gehorsamst bitten, Faßhauern cum expensis anzudeuten, daß er ihm sofort seinen Rattenkönig wiedergeben und das damit verdiente Geld bezahlen solle etc.
Am 22. Februar 1774 erscheint bei der Landstube
Christian Kaiser, Mühlknappe zu Lindenau, und sagt aus:
Es sei wirklich der Wahrheit gemäß, daß er am 12. Januar einen Rattenkönig von sechszehn Stück Ratten in der Mühle zu Lindenau gefangen habe. Besagten Tages habe er in der Mühle und zwar bei einer Treppe in einem Unterzuge ein Geräusch gehört, worauf er da die Treppe hinaufgegangen, einige Ratten bei sothanem Unterzuge gucken sehen, welche er mit einem Stück Holz todtgeschlagen. Hierauf hätte er eine Leiter an gedachten Ort angelegt, um zu sehen, ob noch mehr Ratten wären, und diesen Rattenkönig mit Beihülfe einer Axt auf den Platz geschmissen, und hätten viele noch gelebt, weil sie heruntergefallen, welche er aber nach einiger Zeit auch todtgeschmissen. Sechszehn Stück Ratten wären aneinander feste geflochten gewesen, und zwar fünfzehn Stück mit den Schwänzen, die sechszehnte aber mit einer anderen auf dem Rücken mit dem Schwanze in ihren Haaren eingeflochten gewesen. Durch das Herunterfallen von dem berührten Unterzuge wäre keine von der anderen abgelöst gewesen; auch hätten nachher noch viele einige Zeit gelebt und gesprungen, sich aber nicht von einander durch das Springen losmachen können. So feste wären sie ineinander geflochten gewesen, daß er nicht glaubte, daß es möglich gewesen, wenigstens mit schwerer Mühe, sie von einander zu reißen etc.«
Nun folgen noch einige andere Zeugenberichte, welche wesentlich dasselbe feststellen. Und endlich findet sich die Beschreibung des Arztes und des Wundarztes, welche auf Wunsch der Landstube die Sache genauer untersuchten. Der betreffende Arzt theilt darüber folgendes mit:
»Um zu untersuchen, was von der von Vielen sehr fabelhaft erzählten Geschichte des Rattenkönigs zu halten sei, habe ich mich am 16. Januarii nach Lindenau begeben und daselbst gefunden, daß in der Schenke zum Posthorn in einem kühlen Zimmer auf einem Tische eine Anzahl von sechszehn todten Ratten gelegen, davon fünfzehn Stück mit den Schwänzen, gleich als ein aus vielen Enden bestehender Strick, in einen großen Knoten ineinander so verwickelt, daß einige dieser Schwänze ganz in den Knoten bis ungefähr ein bis zwei Zoll von dem Rumpfe an verknüpft gewesen. Ihre Köpfe waren nach der Peripherie, die Schwänze nach dem Centro, so der aus ihnen bestehende Knoten ausmachte, gerichtet. Neben diesen aneinander hangenden Ratten lag die sechszehnte, die nach Vorgeben des dabei stehenden Malers Faßhauer von einem Studioso von der Verwickelung mit denen übrigen losgerissen worden.
»Meine Neugierde beschäftigte sich am allerwenigsten mit Fragen, besonders, da denen nach uns häufig beikommenden Bewunderern auf vielerlei Fragen die ungereimtesten und lächerlichsten Antworten gegeben wurden, sondern ich untersuchte bloß die Körper und Schwänze der Ratten und fand 1) daß alle diese Ratten an ihrem Kopfe, Rumpfe und vier Füßen ihre natürliche Gestalt hatten; 2) daß sie ihrer Farbe nach einige aschgrau, andere etwas dunkler und wieder andere fast ganz schwarz waren; 3) daß einige ihrer Größe nach einer guten Spanne; 4) daß ihre Dicke und Breite nach ihrer Länge proportionirt war, doch so, daß sie mehr abgehungert als gemästet zu sein schienen; 5) daß ihre Schwänze von [1/4] bis ½ Leipziger Elle lang, wenig darüber oder darunter gerechnet werden konnten, an welchen etwas Unreinigkeit und Feuchtigkeit anzutreffen war.
»Als ich vermittels eines Stückchen Holzes den Knoten und die an demselben hängenden Ratten in die Höhe heben wollte: so bemerkte ich gar deutlich, daß es mir nicht schwer fallen würde, einige der verwickelten Schwänze auseinander zu zerren, wovon ich aber von dem dabeistehenden Maler mit einigem Unwillen abgehalten wurde. An der oben erwähnten sechzehnten Ratte habe ich deutlich wahrgenommen, daß ihr Schwanz, ohne die geringste Verletzung erlitten zu haben, noch an ihr befindlich, und sie also mit leichter Mühe von dem Knoten der übrigen losgelöst worden.
»Nachdem ich nun alle diese Umstände mit vielem Fleiß erwogen, so bin ich vollkommen überzeugt worden, daß besagte sechszehn Ratten kein aus einem Stück bestehender Rattenkönig, sondern daß es eine Anzahl von Ratten, so von verschiedener Größe, Stärke und Farbe und (nach meiner Meinung) auch von verschiedenem Alter und Geschlecht gewesen. Die Art und Weise, wie oft gedachte Ratten sich miteinander so verwickelt haben, stelle ich mir also vor. In der wenig Tage vor der Entdeckung dieser häßlichen Versammlung eingefallenen sehr strengen Kälte haben diese Thiere sich in einem Winkel zusammenrottirt, um durch ihr Neben- und Uebereinanderliegen sich zu erwärmen; ohnfehlbar haben sie eine solche Richtung genommen, daß sie die Schwänze mehr nach einer freien Gegend und die Köpfe nach einer vor Kälte mehr geschützten Gegend zugewendet haben. Sollten nicht die Excrementa der oben gesessenen Ratten, welche nothwendig auf die Schwänze der unteren gefallen, Gelegenheit gegeben haben, daß die Schwänze haben zusammenfrieren müssen? Ist es auf diese Art nicht möglich, daß die an den Schwänzen aneinandergefrorenen Ratten, sobald sie nach ihrer Nahrung gehen wollen und mit ihren angefrorenen Schwänzen nicht loskommen können, eine so feste Verwickelung bewerkstelligt haben müssen, daß sie auch bei bevorstehender Lebensgefahr sich nicht mehr losreißen können?
»Auf Verlangen der Hochlöblichen Landstube E. E. Hochweisen Rathes allhier habe diese meine Gedanken nebst dem, was ich laut dieses Berichts zugleich mit Herrn Eckolden bei der Untersuchung angetroffen, hiermit aufrichtigst anzuzeigen nicht anstehen wollen, so ich mit ihm eigenhändig unterschrieben habe.«
Es ist möglich, daß derartige Verbindungen öfter vorkommen, als man annimmt; die wenigsten aber werden gefunden, und an den meisten Orten ist der Aberglaube noch so groß, daß man einen etwa entdeckten Rattenkönig gewöhnlich sobald als möglich vernichtet. Hierzu gibt Lenz einen für sich selbst redenden Beleg. In Döllstedt, einem zwei Meilen von Gotha gelegenen Dorfe, wurden im December des Jahres 1822 zwei Rattenkönige zu gleicher Zeit gefangen. Drei Drescher, welche in der Scheuer des Forsthauses ein lautes Quieken vernahmen, suchten mit Hülfe des Knechtes nach und fanden, daß der starke Tragbalken des Stalles von oben ausgehöhlt war. In dieser Höhle sahen sie eine Menge lebender Ratten, wie sich nachher herausstellte, ihrer zweiundvierzig Stück. Das Loch im Balken war offenbar von den Ratten hineingenagt worden. Es hatte ungefähr fünfzehn Centim. an Tiefe, war reinlich gehalten und auch nicht von Ueberbleibseln der Nahrung und dergleichen umgeben. Der Zugang war für die alten Ratten, welche dort ihre Brut gefüttert haben mußten, sehr bequem, weil das ganze Jahr hindurch über dem Stalle und seinem Tragbalken eine große Masse Stroh gelegen hatte. Der Knecht übernahm das Geschäft, die Ratten, welche ihren Wohnsitz nicht verlassen wollten oder nicht verlassen konnten, hervorzuholen und auf die Scheuertenne hinabzubringen. Dort sahen dann die vier Leute mit Staunen, daß achtundzwanzig Ratten mit ihren Schwänzen fest verwachsen und um diesen Schwanzknäuel regelmäßig vertheilt im Kreise waren. Die übrigen vierzehn Ratten waren genau ebenso verwachsen und vertheilt. Alle zweiundvierzig schienen von argem Hunger geplagt zu sein und quiekten fortwährend, sahen aber durchaus gesund aus; alle waren von gleicher und zwar so bedeutender Größe, daß sie jedenfalls vom letzten Frühjahre sein mußten. Ihrer Färbung nach zu schließen, waren es Hausratten. Sie sahen rein und glatt aus, und man konnte kein Anzeichen bemerken, daß etwa vorher welche gestorben waren. Ihrer Gesinnung nach waren sie vollkommen friedlich und gemüthlich, ließen alles über sich ergehen, was das vierköpfige Gericht über sie beschloß, und musicirten bei jeder über sie verhängten Handlung in gleicher Melodie. Der Vierzehnender ward lebend in die Stube des Forstaufsehers getragen, und dahin kamen dann unaufhörlich Leute, um das wunderbare Ungeheuer zu beschauen. Nachdem die Schaulust der Dorfbewohner befriedigt war, endete das Schauspiel damit, daß die Drescher ihren Gefangenen im Triumph auf die Miststätte trugen und ihn dort unter dem Beifall der Menge so lange draschen, bis er seine vierzehn Geister aufgab. Sie packten die Ratten nun noch mit zwei Mistgabeln, stachen fest ein und zerrten mit großer Gewalt nach zwei Seiten, bis sie drei von den übrigen losgerissen. Die drei Schwänze zerrissen dabei nicht, hatten auch Haut und Haare noch, zeigten aber die Eindrücke, welche sie von den anderen Schwänzen bekommen hatten, ganz wie Riemen, welche lange miteinander verflochten gewesen sind. Den Achtundzwanzigender trugen die Leute in den Gasthof und stellten ihn dort den immer frisch andrängenden Neu- und Wißbegierigen zur Schau aus. Zum Beschluß des Festes wurde auch dieser Rattenkönig jämmerlich gedroschen, todt auf den Düngerhaufen geworfen und nicht weiter beachtet. Hätten die guten Leute gewußt, daß diese Rattenkönige sie sammt und sonders zu reichen Leuten hätten machen können, sie würden sicherlich ängstlich über das Leben der so eigenthümlich verbundenen gewacht und sie öffentlich zur Schau Deutschlands gestellt haben!
Unzählbar sind die Mittel, welche man schon angewandt hat, um die Ratten zu vertilgen. Fallen aller Art werden gegen sie aufgestellt, und eine Zeitlang hilft auch die eine und die andere Art der Rattenjagd wenigstens etwas. Merken die Thiere, daß sie sehr heftig verfolgt werden, so wandern sie nicht selten aus, kommen aber wieder, wenn die Verfolgung nachläßt. Und wenn sie sich einmal von neuem eingefunden haben, vermehren sie sich in kurzer Zeit so stark, daß die alte Plage wieder in voller Stärke auftritt. Die gewöhnlichsten Mittel zu ihrer Vertilgung bleiben Gifte verschiedener Art, welche man an ihren Lieblingsorten aufstellt; aber ganz abgesehen davon, daß man die vergifteten Thiere auf eine greuliche Weise zu Tode martert, bleiben diese Mittel immer gefährlich; denn die Ratten brechen gern einen Theil des Gefressenen wieder aus, vergiften unter Umständen Getreide oder Kartoffeln und können dadurch anderen Thieren und auch den Menschen sehr gefährlich werden. Besser ist es, ihnen ein Gemisch von Malz und ungelöschtem Kalk vorzusetzen, welches, wenn sie es gefressen haben, ihren Durst erregt und den Tod herbeiführt, sobald sie das zum Löschen des Kalkes erforderliche Wasser eingenommen haben.
Die besten Vertilger der Ratten bleiben unter allen Umständen ihre natürlichen Feinde, vor allen Eulen, Raben, Wiesel, Katzen und Pintscher, obgleich es oft vorkommt, daß die Katzen sich nicht an Ratten, zumal an Wanderratten, wagen. Dehne sah in Hamburg vor den Flethen Hunde, Katzen und Ratten unter einander herumspazieren, ohne daß eines der betreffenden Thiere daran gedacht hätte, dem andern den Krieg zu erklären, und mir selbst sind viele Beispiele bekannt, daß die Katzen sich nicht um die Ratten bekümmern. Es gibt, wie unter allen Hausthieren, auch unter den Katzen gute Familien, deren Glieder mit wahrer Leidenschaft der Rattenjagd obliegen, obgleich sie anfangs viele Mühe haben, die bissigen Nager zu überwältigen. Eine unserer Katzen fing bereits Ratten, als sie kaum den dritten Theil ihrer Größe erreicht hatte, und verfolgte dieselben mit solchem Eifer, daß sie sich einstmals von einer starken Ratte über den ganzen Hof weg und an einer Mauer emporschleppen ließ, ohne ihren Feind loszulassen, bis sie endlich mit einem geschickten Bisse denselben kampfunfähig machte. Von jenem Tage an ist die Katze der unerbittlichste Feind der Ratten geblieben und hat den ganzen Hof von ihnen fast gereinigt. Uebrigens ist es gar nicht so nothwendig, daß eine Katze wirklich eifrig Ratten fängt; sie vertreibt dieselben schon durch ihr Umherschleichen in Stall und Scheuer, Keller und Kammer. Es ist sicherlich höchst ungemüthlich für die Ratten, diesen Erzfeind in der Nähe zu haben. Sie sind da keinen Augenblick lang sicher. Unhörbar schleicht er herbei im Dunkel der Nacht, kein Laut, kaum eine Bewegung verräth sein Nahen, in alle Löcher schauen seine unheimlich leuchtenden, grünlichen Augen, neben den bequemsten Gangstraßen sitzt und lauert er, und ehe sie es sich recht versehen, fällt er über sie her und packt mit den spitzen Klauen und den scharfen Zähnen so fest zu, daß selten Rettung möglich. Das erträgt selbst eine Ratte nicht: sie wandert lieber aus und an Orte, wo sie unbehelligter wohnen kann. Somit bleibt die Katze immer der beste Gehülfe des Menschen, wenn es gilt, so lästige Gäste zu vertreiben. Kaum geringere Dienste leisten Iltis und Wiesel, ersterer im Hause, letzteres im Garten und an den hinteren Seiten der Ställe. Gegen diese Raubgesellen, welche sich ab und zu auch ein Ei, ein Küchlein, eine Taube oder auch wohl eine Henne holen, kann man sich schützen, wenn man den Stall gut verschließt, gegen die Ratten aber ist jeder Schutz umsonst, und deshalb sollte man die schlanken Räuber hegen und schirmen, wo man nur immer kann.
An einzelnen Ratten hat man bei großer Gefahr eine besondere List beobachtet. Sie stellen sich todt, wie das Opossum thut. Mein Vater hatte einst eine Ratte gefangen, welche, ohne sich zu rühren, in der Falle lag und sich in derselben hin- und herwerfen ließ. Das noch glänzende Auge war aber zu auffallend, als daß solch ein Meister in der Beobachtung sich hätte täuschen sollen. Mein Vater schüttete die Künstlerin auf dem Hofe aus, aber in Gegenwart ihrer schlimmen Feindin, der Katze, und siehe da – die scheinbar Todte bekam sofort Leben und Besinnung, wollte auch so schnell als möglich davon laufen, allein Miez saß ihr auf dem Nacken, noch ehe sie zwei Meter durchmessen hatte.
Schließlich will ich zu Nutz und Frommen mancher meiner Leser eine Falle beschreiben, welche zwar dem menschlichen Herzen nicht eben Ehre macht, aber wirksam ist. An besuchten Gangstraßen der Ratten, etwa zwischen Ställen, in der Nähe von Abtritten, Schleußen und an ähnlichen Orten legt man eine anderthalb Meter tiefe Grube an und kleidet sie innen mit glatten Steinplatten aus. Eine viereckige Platte von einem Meter im Geviert bildet den Grund, vier andere, oben schmälere, stellen die Seiten her. Die Grube muß oben halb so weit sein als unten, so daß die Wände nach allen Seiten hin überhangen und ein Heraufklettern der hineingegangenen Ratten unmöglich machen. Nun gießt man auf dem Boden geschmolzenes Fett, mit Wasser verdünnten Honig und andere stark riechende Stoffe aus, setzt ein thönernes Gefäß, welches oben eine enge Oeffnung hat, hinein, tränkt es mit Honig und füllt es mit Mais, Weizen, Hanf, Hafer, gebratenem Speck und anderen Leckerbissen an. Dann kommt etwas Heckerling auf den Boden der Grube und endlich ein Gitter über den Eingang, damit nicht zufällig ein Huhn oder ein anderes junges, ungeschicktes Hausthier hineinfalle. Nunmehr kann man das Ganze sich selbst überlassen. »Der liebliche Duft und der warme Heckerling«, sagt Lenz, »verleiten den bösen Feind, lustig und erwartungsvoll in den Abgrund zu springen. Dort riecht alles gar schön nach Speck, Honig, Käse, Körnern; man muß sich aber mit dem bloßen Geruche begnügen, weil das Innere nicht zugänglich ist, und so bleibt nichts anderes übrig, als daß ein Gefangener immer den anderen auffrißt.« Die erste Ratte, welche hinabfällt, bekommt selbstverständlich bald Hunger und müht und mattet sich vergeblich ab, dem entsetzlichen Gefängnisse zu entgehen. Da stürzt eine zweite von oben hernieder. Man beschnoppert sich gegenseitig, berathet wohl auch gemeinschaftlich, was da zu thun ist; aber der erste Gefangene ist viel zu hungrig, als daß er sich auf lange Verhandlungen einlassen könnte. Ein furchtbares Balgen, ein Kampf auf Leben und Tod beginnt, und einer der Gefangenen mordet den anderen. Blieb der erste Sieger, so macht er sich augenblicklich über die Leiche des Gefährten her, um ihn aufzufressen; siegte der zweite, so geschieht dasselbe wenige Stunden später. Nur höchst selten findet man drei Ratten zu gleicher Zeit in dieser Falle, am folgenden Tage aber sicherlich immer eine weniger. Kurz, ein Gefangener frißt den anderen auf, und die Grube bleibt ziemlich reinlich, obgleich sie eine Mordhöhle in des Wortes furchtbarster Bedeutung ist.
Weit lieblicher, anmuthiger und zierlicher als diese häßlichen, langgeschwänzten Hausdiebe sind die Mäuse, obwohl auch sie trotz ihrer schmucken Gestalt, ihres heitern und netten Wesens arge Feinde des Menschen sind und fast mit demselben Ingrimme wie ihre größeren und häßlicheren Verwandten von ihm verfolgt werden. Man darf behaupten, daß jedermann eine im Käfige eingesperrte Maus reizend finden wird, und daß selbst Frauen, welche gewöhnlich einen zwar vollkommen ungerechtfertigten, aber dennoch gewaltigen Schrecken empfinden, wenn in der Küche oder im Keller eine Maus ihnen über den Weg läuft, diese, wenn sie genauer mit ihr bekannt werden, für ein hübsches Geschöpf erklären müssen. Aber freilich, die spitzigen Nagezähne und die Leckerhaftigkeit der Mäuse sind zwei Dinge, welche auch ein mildes Frauenherz mit Zorn und Rachegefühlen erfüllen können. Es ist gar zu unangenehm, für alle Lebensmittel beständig fürchten zu müssen, selbst wenn dieselben unter Schloß und Riegel liegen; es ist gar zu empörend, eigentlich keinen Ort im Hause zu haben, wo man allein Herr sein darf und von den zudringlichen, kleinen Gästen nicht belästigt wird. Und weil nun die Mäuse sich überall einzudrängen wissen und sich selbst an den Ratten unzugänglichen Orten einfinden, haben sie gegen sich einen Verfolgungskrieg heraufbeschworen, welcher schwerlich jemals enden wird.
In Deutschland leben vier echte Mäuse: die Haus-, Wald-, Feld- und Zwergmaus. Namentlich die erstere und die letztere verdienen eine ausführlichere Beschreibung, obgleich auch Feld- und Waldmaus nur zu oft dem Menschen ins Gehege kommen und ihre Kenntnis deshalb nothwendig erscheint. Die drei ersteren werden überall ziemlich schonungslos verfolgt; die letzte aber hat, solange sie sich nicht unmittelbar dem Menschen aufdrängt, wegen ihrer ungemein zierlichen Gestalt, ihrer Anmuth und ihrer eigenthümlichen Lebensweise Gnade vor seinen Augen gefunden.
Die Hausmaus ( Mus Musculus, M. islandicus und domesticus) hat in ihrer Gestalt noch immer einige Aehnlichkeit mit der Hausratte, ist jedoch weit zarter und ebenmäßiger gebaut und bedeutend kleiner. Ihre Gesammtlänge beträgt ungefähr 18 Centim., wovon 9 Centim. auf den Körper kommen. Der Schwanz hat 180 Schuppenringe. Sie ist einfarbig: die gelblich grauschwarze Oberseite des Körpers und des Schwanzes geht ganz allmählich in die etwas hellere Unterseite über; Füße und Zehen sind gelblichgrau.
Die Waldmaus ( Mus sylvaticus, Musculus dichrurus) wird 20 Centim. lang, der Schwanz, welcher ungefähr 150 Schuppenringe hat, mißt 11,5 Centim. Sie ist zweifarbig, die Oberseite des Körpers und Schwanzes braungelblich grau, die Unterseite nebst den Füßen und Zehen scharf abgesetzt weiß.
Beide Arten kann man wegen ihrer längeren Ohren von der folgenden trennen. Bei dieser erreicht das Ohr nur ungefähr den dritten Theil der Kopfeslänge und ragt, an die Kopfseiten anhaus gedrückt, nicht bis zum Auge hervor, während es bei jenen die halbe Kopfeslänge hat und, an die Kopfseiten angedrückt, bis zum Auge vorragt.
Die Brandmaus ( Mus agrarius, M. rubeus) wird 18 Centim. lang, der Schwanz mißt 8 Centim. Sie ist dreifarbig: die Oberseite des Körpers braunroth mit schwarzen Längsstreifen über den Rücken, die Unterseite nebst den Füßen scharf abgesetzt weiß. Der Schwanz hat ungefähr 120 Schuppenringe.
Alle diese Mäuse ähneln sich in ihrem Aufenthalte, ihrem Wesen und Betragen ungemein, obgleich die eine oder die andere ihr Eigenthümliches hat. In einem stimmen alle vier überein: sie zeigen, wenigstens zeitweilig, große Vorliebe für den Menschen. Alle Arten, wenn auch die Hausmaus regelmäßiger als die übrigen, finden sich, zumal im Winter, häufig in den Häusern, vom Keller an bis zum Boden hinauf. Keine einzige ist ausschließlich an die Orte gebunden, auf welche ihr Name hindeutet: die Waldmaus lebt ebensowohl zeitweilig in der Scheuer oder im Hause wie auf dem Felde, und die Feldmaus ist ebensowenig allein aufs Feld beschränkt wie die Hausmaus auf die Wohnung des Menschen.

Hausmaus ( Mus Musculus). [3/4] natürl. Größe.
Die Hausmaus soll schon seit den ältesten Zeiten der treueste Genosse des Menschen gewesen sein. Bereits Aristoteles und Plinius thun ihrer Erwähnung, Albertus Magnus kennt sie genau. Gegenwärtig ist sie über die ganze Erde verbreitet. Sie wanderte mit dem Menschen und folgte ihm bis in den höchsten Norden und bis in die höchstgelegenen Alphütten. Wahrscheinlich gibt es gegenwärtig nur wenige Orte, wo sie fehlt, und jedenfalls hat man sie da bloß noch nicht beobachtet. Auf den Sundainseln z. B. soll sie nicht vorkommen. Ihre Aufenthaltsorte sind alle Theile der menschlichen Wohnungen. Auf dem Lande haust sie zeitweilig auch im Freien, d. h. im Garten oder in den nächsten Feldern und Wäldchen, in der Stadt beschränkt sie sich auf das Wohn- und seine Nebengebäude. Hier bietet ihr jede Ritze, jede Höhle, mit einem Worte jeder Winkel, wo sie sich verstecken kann, genügendes Obdach, und von hier aus unternimmt sie ihre Streifzüge.

Brandmaus ( Mus agrarius) und Waldmaus ( Mus sylvaticus). [5/6] natürl. Größe.
Mit größter Schnelligkeit rennt sie auf dem Boden dahin, klettert vortrefflich, springt ziemlich weit und hüpft oft längere Zeit nacheinander in kurzen Sätzen fort. An zahmen kann man beobachten, wie geschickt sie alle Bewegungen unternimmt. Läßt man sie auf einem schief aufwärts gespannten Bindfaden oder auf einem Stöckchen gehen, so schlingt sie, sobald sie zu fallen fürchtet, ihren Schwanz schnell um das Seil, nach Art der echten Wickelschwänzler, bringt sich wieder in das Gleichgewicht und läuft weiter; setzt man sie auf einen sehr biegsamen Halm, so klettert sie auf demselben bis zur Spitze empor, und wenn der Halm sich dann niederbiegt, hängt sie sich auf der unteren Seite an und steigt hier langsam herunter, ohne jemals in Verlegenheit zu kommen. Beim Klettern leistet ihr der Schwanz wesentliche Dienste: zahme Mäuse, denen man, um ihnen ein drolliges Aussehen zu geben, die Schwänze kurz geschnitten hatte, waren nicht mehr im Stande, es ihren beschwänzten Mitschwestern gleich zu thun. Ganz allerliebst sind auch die verschiedenen Stellungen, welche sie einnehmen kann. Schon wenn sie ruhig sitzt, macht sie einen ganz hübschen Eindruck; erhebt sie sich aber, nach Nagerart auf das Hintertheil sich stützend, und putzt und wäscht sie sich, dann ist sie geradezu ein bezauberndes Thierchen. Sie kann sich auf den Hinterbeinen aufrichten, wie ein Mensch, und sogar einige Schritte gehen. Dabei stützt sie sich nur dann und wann ein klein wenig mit dem Schwanze. Das Schwimmen versteht sie auch, obwohl sie nur im höchsten Nothfalle in das Wasser geht. Wirft man sie in einen Teich oder Bach, so sieht man, daß sie fast mit der Schnelligkeit der Zwergmaus oder der Wasserratte, welche beide wir später kennen lernen werden, die Wellen durchschneidet und dem ersten trockenen Orte zustrebt, um an ihm empor zu klettern und das Land wieder zu gewinnen. Ihre Sinne sind vortrefflich: sie hört das feinste Geräusch, riecht scharf und auf weite Entfernungen, sieht auch gut, vielleicht noch besser bei Tage als bei Nacht. Ihr geistiges Wesen macht sie dem, welcher das Leben des Thieres zu erkennen trachtet, zum wahren Lieblinge. Sie ist gutmüthig und harmlos und ähnelt nicht im geringsten ihren boshaften, tückischen und bissigen Verwandten, den Ratten; sie ist neugierig und untersucht alles mit der größten Sorgfalt; sie ist lustig und klug, merkt bald, wo sie geschont wird, und gewöhnt sich hier mit der Zeit so an den Menschen, daß sie vor seinen Augen hin- und herläuft und ihre Hausgeschäfte betreibt, als gäbe es gar keine Störung für sie. Im Käfige benimmt sie sich schon nach wenigen Tagen liebenswürdig; selbst alte Mäuse werden noch leidlich zahm, und jung eingefangene übertreffen wegen ihrer Gutmüthigkeit und Harmlosigkeit die meisten anderen Nager, welche man gefangen halten kann. Wohllautende Töne locken sie aus ihrem Verstecke hervor und lassen sie alle Furchtsamkeit vergessen. Sie erscheint bei hellem Tage in den Zimmern, in denen gespielt wird, und Räume, in denen regelmäßig Musik ertönt, werden zuletzt ihre Lieblingsaufenthaltsorte. In neuerer Zeit ist in verschiedenen Zeitschriften über sogenannte »Singmäuse« berichtet worden, und auch ich habe mehrere Zuschriften über denselben Gegenstand erhalten. Alle Berichte stimmen darin überein, daß hier und da und dann und wann Hausmäuse beobachtet werden, welche ihr natürliches Piepen und Zwitschern in einer an Vogelgesang erinnernden Weise vernehmen lassen. Das Ungewöhnliche der Beobachtung scheint die meisten Berichterstatter zu Vergleichen verleitet zu haben, welche schwerlich richtig sind. Einzelne sprechen mit Begeisterung von dem Gesange der Maus und stellen ihn dem Schlag des Kanarienvogels und selbst dem des Sprossers zur Seite; andere urtheilen nüchterner und wahrscheinlich richtiger. Lehrer Schacht, ein ebenso verläßlicher als kenntnisreicher Beobachter, pflegte längere Zeit eine solche Singmaus, welche ihren Gesang meist in der Dämmerung, oft auch erst in der Nacht ertönen ließ. Mit dem hellen Schlage eines Kanarienvogels oder mit dem tiefen Rollen eines Sprossers hatte derselbe nicht die geringste Aehnlichkeit. Es war nur »ein Gezwitscher, ein Mischmasch von ziehenden, surrenden und quietschenden Tönen«, welche man in der Stille der Nacht noch auf zwanzig Schritte vernehmen konnte. »Um einen Vergleich zwischen dem Gesange des Vierfüßlers und dem eines Vogels zu ziehen«, meint Schacht, »läßt sich sagen, daß das Gepräge der Weise die größte Aehnlichkeit mit den leisen Tönen einer jungen Klappergrasmücke hatte, welche im Nachsommer, tief im Gebüsch versteckt, ihr Liedchen einübt«. Der »Gesang« einer anderen vom Oberlehrer Dr. Müller beobachteten Singmaus bestand »aus auf einander folgenden weichen, pfeifenden Tönen, welche bald langsamer, bald lebhafter ausgestoßen wurden und in letzterem Falle deutlich an den Gesang eines Vogels erinnerten, nur daß sie wesentlich schwächer waren.« Letztere Singmaus wurde durch Musik angeregt und fing zuweilen auch am Tage an zu Pfeifen, wenn sie Klänge eines im gegenüberliegenden Hause befindlichen Klaviers vernahm. Beide von nur erwähnten Singmäuse waren Männchen, und es scheint somit wenigstens nicht undenkbar, daß des Gesanges süße Gabe auch in diesem Falle vorzugsweise dem männlichen Geschlechts verliehen ist.
Alle angenehmen Eigenschaften unserer Hausgenossin werden leider durch ihre Lüsternheit und Genäschigkeit sehr beeinträchtigt. Man kann sich schwerlich ein naschhafteres Geschöpf denken als eine Hausmaus, welche über eine gut gespickte Speisekammer verfügen kann. Sie sucht sich sicher immer die besten Bissen aus und beweist dadurch auf das schlagendste, daß der Sinn des Geschmackes bei ihr vortrefflich entwickelt ist. Süßigkeiten aller Art, Milch, Fleischspeisen, Käse, Fette, Früchte und Körner werden von ihr unbedingt bevorzugt, und wo sie die Wahl hat, kürt sie sich unter dem Guten immer das Beste. Die spitzen Nagezähne kommen hinzu, um sie verhaßt zu machen. Wo sie etwas Genießbares wittert, weiß sie sich einen Zugang zu verschaffen, und es kommt ihr eben nicht darauf an, eine oder mehrere Nächte angestrengt zu arbeiten und selbst feste, starke Thüren zu durchnagen. Findet sie viele Nahrung, welche ihr besonders mundet, so trägt sie sich auch noch einen Vorrath davon in ihre Schlupfwinkel und sammmelt mit der Hast eines Geizigen an der Vermehrung ihrer Schätze. »An Orten, wo sie wenig Störung erleidet«, sagt Fitzinger, »findet man zuweilen ganze Haufen von Wall- oder Haselnüssen bis zu einer halben Elle hoch in Winkeln aufgethürmt und so regelmäßig und zierlich fest aneinander geschlossen und mit allerlei Abfällen von Papier oder Kleiderstoffen überdeckt, daß man hierin kaum ein Werk der Hausmaus vermuthen möchte.« Wasser trinkt sie, wenn sie andere saftige Stoffe haben kann, gar nicht und auch bei trockenem Futter nur selten, schlürft dagegen süße Getränke aller Art mit Wollust aus. Daß sie sich, wie die Waldmaus es zuweilen thut, auch über geistige Getränke hermacht, beweist eine Beobachtung, welche mir erst vor kurzem mitgetheilt wurde. »Etwa im Jahre 1843«, schreibt mir Förster Block, »wurde ich einmal beim Schreiben durch ein Geräusch gestört und erblickte eine Maus, welche an den glatten Füßen eines Tischchens emporkletterte. Bald war sie oben und suchte emsig nach den Brosamen, welche auf dem Frühstücksteller lagen. In der Mitte des Tellers stand ein ganz leichtes, glockenförmiges Schnapsgläschen, zur Hälfte mit Kümmel gefüllt. Mit einem Sprunge saß das Mäuschen oben auf dem Glase, bog sich vorn über, leckte eifrig und sprang sodann herunter, nahm aber noch eine Gabe von dem süßen Gifte zu sich. Durch ein Geräusch meinerseits gestört, sprang sie mit einem Satze vom Tische herab und verschwand hinter einem Glasschranke. Jetzt mochte der Geist über sie kommen; denn gleich darauf war sie wieder da und führte die spaßhaftesten Bewegungen aus, versuchte auch, obwohl vergeblich, den Tisch nochmals zu ersteigen. Ich stand auf und ging auf sie zu, behelligte sie aber nicht; ich holte eine Katze herbei, die Maus lief auf einen Augenblick davon, war aber gleich wieder da. Von meinem Arme herab sprang die Katze zu, und das trunkene Mäuschen hing an den Krallen ihrer Tatze.«
Der Schaden, welchen die Hausmaus durch Wegfressen verschiedener Speisevorräthe anrichtet, ist im ganzen gering; ihre hauptsächliche Schädlichkeit beruht in dem abscheulichen Zernagen werthvoller Gegenstände. In Bücher- und Naturaliensammlungen hausen die Mäuse auf die verderblichste Weise und können, wenn ihrer Zerstörungslust nicht mit allen Kräften Einhalt gethan wird, unschätzbaren Schaden anrichten. Es scheint, daß sie manchmal aus bloßem Uebermuthe etwas benagen, und soviel ist sicher, daß dies öfter geschieht, wenn sie durstig sind, als wenn sie immer zu trinken bekommen. Deshalb pflegt man ihr in Bibliotheken außer Körnern, welche man für sie aufspeichert, auch Gefäße mit Wasser hinzustellen, sie also geradezu zu speisen und zu tränken.
Die Hausmaus vermehrt sich außerordentlich stark. Sie wirft 22 bis 24 Tage nach der Paarung vier bis sechs, nicht selten aber auch acht Junge und in Jahresfrist sicherlich fünf bis sechsmal, so daß die unmittelbare Nachkommenschaft eines Jahres mindestens dreißig Köpfe beträgt. Eine weiße Maus, welche Struve in der Gefangenschaft hielt, warf am 17. Mai sechs, den 6. Juni sechs, den 3. Juli acht Junge. Sie wurde am 3. Juli vom Männchen getrennt und am 28. Juli wieder mit ihm zusammen gethan. Nun warf sie am 21. August wieder sechs Junge, am 1. Oktober ebenfalls sechs und am 24. Oktober fünf. Während des Winters ging sie gelte. Am 17. März kamen wieder zwei Junge zur Welt. Eins von den am 6. Juni geborenen Weibchen bekam die ersten Jungen, und zwar gleich vier, am 18. Juli. Die Mutter schlägt ihr Wochenbett in jedem Winkel auf, welcher ihr eine weiche Unterlage bietet und einigermaßen Sicherheit gewährt. Nicht selten findet man das Nest in ausgehöhltem Brode, in Kohlrüben, Taschen, Todtenköpfen, ja selbst in Mausefallen. Gewöhnlich ist es aus Stroh, Heu, Papier, Federn und anderen weichen Stoffen sorgfältig zusammengeschleppt; doch kommt es auch vor, daß bloß Holzspäne oder selbst Nußschalen die Unterlage abgeben müssen. Die Jungen sind, wenn sie zur Welt kommen, außerordentlich klein und förmlich durchsichtig, wachsen aber rasch heran, bekommen zwischen dem siebenten und achten Tag Haare, öffnen aber erst am dreizehnten Tage die Augen. Nun bleiben sie nur noch ein paar Tage im Neste; dann gehen sie selbständig auf Nahrungserwerb aus. Die Alte behandelt sie mit großer Zärtlichkeit und gibt sich ihrethalben selbst Gefahren preis. Weinland erzählt ein rührendes Beispiel ihrer Mutterliebe. »In dem weichen Bette, welches eine Hausmaus ihren Jungen bereitet hatte, entdeckte man sie und ihre neun Kinder. Die Alte konnte entrinnen, aber sie macht keine Bewegung zur Flucht! Man schiebt die Jungen auf eine Schaufel und die Alte mit ihnen, sie rührt sich nicht. Man trägt sie frei auf der Schaufel fort, mehrere Treppen hinunter, bis in den Hof, und sie harrt zu ihrem Verderben bei ihren Kindern aus.«
Der schlimmste aller Feinde der Hausmaus ist und bleibt die Katze. In alten Gebäuden hilft die Eule dem Vierfüßler treulich mit, und auf dem Lande leisten Iltis und Wiesel, Igel und Spitzmaus gute Dienste, bessere jedenfalls als Fallen aller Art.
Wald- und Feldmaus theilen die meisten Eigenschaften der Hausmaus. Erstgenannte ist, etwa mit Ausnahme der hochnordischen Gegenden, durch ganz Europa und Mittelasien verbreitet und steigt im Gebirge bis zu 2000 Meter über das Meer empor. Sie lebt in Wäldern, an Waldrändern, in Gärten, seltener auch in weiten, baumleeren Feldern und kommt im Winter gern in Häuser, Keller und Speisekammern, steigt aber bald möglichst nach oben hinauf und treibt sich in Bodenkammern und unter den Dächern umher. In ihren Bewegungen ist sie mindestens ebenso gewandt wie die Hausmaus, unterscheidet sich jedoch dadurch von ihr, daß sie meist in Bogensprüngen dahinhüpft, nach Art der Springmäuse mehrere Sätze nacheinander macht und erst dann ein wenig ruht. Nach Radde's Beobachtungen scheint der Gesichtssinn nicht besonders entwickelt zu sein; denn man kann sich ihr, vorsichtig vorwärts schreitend, bis auf etwa 60 Centim. nahen und sie ohne besondere Mühe tödten. Im Freien frißt sie Kerbthiere und Würmer, selbst kleine Vögel, oder Obst, Kirschkerne, Nüsse, Eicheln, Bucheckern und in der Noth wohl auch die Rinde junger Bäume. Sie trägt sich ebenfalls einen Wintervorrath ein, hält aber keinen Winterschlaf und nascht bloß an trüben Tagen von ihren aufgespeicherten Schätzen. »Als wir unsere Wohnung im Bureja-Gebirge vollendet hatten«, erzählt Radde, »stellte sich die Waldmaus für den Winter in großer Anzahl bei uns ein und spielte uns manchen Streich, indem sie selbst die Tische besuchte und Unfug auf ihnen trieb. Sie vermied die gelegten, vergifteten Talgpillen und hielt sich am meisten zu den Buchweizenvorräthen in unserem Speicher; auch war sie es, welche die Erbsen verschleppte und sich davon starke Vorräthe anlegte. Am Tage wurde sie nie angetroffen, in der Dämmerungsstunde aber war sie sehr lebhaft und ungemein dreist.« Auch bei uns zu Lande bringt sie im Hause oft empfindlichen Schaden und hat ganz eigene Gelüste: so dringt sie nachts in Käfige, tödtet Kanarienvögel, Lerchen, Finken. Häufchen von Leckerbissen, welche sie nicht gut wegschleppen kann, bedeckt sie mit Halmen, Papierstückchen und dergl. Von ihrem guten Geschmacke erzählt Lenz ein hübsches Beispiel. Eine seiner Schwestern hörte abends im Keller ein eigenes, singendes Piepen, suchte mit der Laterne und fand eine Waldmaus, welche neben einer Flasche Malaga saß, der hereinkommenden Dame freundlich und ohne Scheu ins Gesicht sah und sich in ihrem Gesange dabei gar nicht stören ließ. Die junge Dame ging fort, holte Hülfe, und es wurde mit Heeresmacht in den Keller gezogen; die Maus war mit ihrem Liedchen noch nicht fertig, blieb ruhig sitzen und war sehr verwundert, als sie mit einer eisernen Zange beim Schopfe gefaßt wurde. Bei weiterer Untersuchung fand sich nun, daß die Flasche etwas auslief, und daß um den Fleck, wo die Tropfen herausliefen, ein ganzer Kranz von Mäusemist lag, woraus der Schluß gezogen wurde, daß die hier als Trunkenbold verhaftete Maus schon länger ihre Gelage gefeiert haben mochte.
Die Waldmaus wirft jährlich zwei oder dreimal vier bis sechs, seltener auch acht nackte Junge, welche ziemlich langsam wachsen und den schönen, rein rothgelben Anflug des Pelzes erst im zweiten Jahre erhalten.
Die Brandmaus ist auf einen geringeren Verbreitungskreis beschränkt als die verwandten Arten: sie lebt zwischen dem Rheine und Westsibirien; Nord-Holstein und der Lombardei. In Mitteldeutschland ist sie überall gemein, im Hochgebirge fehlt sie. Ihre Aufenthaltsorte sind Ackerfelder, Waldränder, lichte Gebüsche und im Winter die Getreidefeimen oder die Scheuern und Ställe. Beim Mähen des Getreides sieht man sie im Herbste scharenweise über die Stoppeln flüchten. Pallas erzählt, daß sie in Sibirien zuweilen regellose Wanderungen anstellt. In ihren Bewegungen ist sie ungeschickter, in ihrem Wesen weit gutmüthiger oder dümmer als ihre Verwandten. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Getreide, Sämereien, Pflanzen, Knollen, Kerbthieren und Würmern. Sie trägt sich ebenfalls Vorräthe ein. Im Sommer wirft sie drei bis viermal zwischen vier und acht Junge, welche, wie die der Waldmaus, erst im folgenden Jahre vollständig ausgefärbt sind. Ueber ihre Fortpflanzung erzählt Lenz folgendes: »Vor nicht langer Zeit nahm ich ein Brandmausweibchen nebst seinen Jungen, welche eben zu sehen begannen, in die Stube, that die Familie ganz allein in ein wohl verwahrtes Behältnis und fütterte sie gut. Die Alte machte sich ein Nestchen und säugte darin ihre Jungen sehr eifrig. Fünfzehn Tage nach dem, an welchem die Familie eingefangen und eingesperrt worden war, als eben die Jungen selbständig zu werden begannen, warf die Alte unvermuthet wieder sieben Junge, mußte sich also schon im Freien, nachdem sie die vorigen geheckt, wieder gepaart haben. Lustig war es mit anzusehen, wenn ich die alte Brandmaus, während sie die Jungen säugte, so störte, daß sie weglief. Die Jungen, welche gerade an ihren Zitzen hingen, blieben dann daran, sie mochte so schnell laufen, wie sie wollte, und sie kam mit der bedeutenden Last doch immer schnell vom Flecke. Ich habe auch im Freien Mäuse gesehen, welche ihre Jungen, wenn ich sie störte, so wegschafften.«
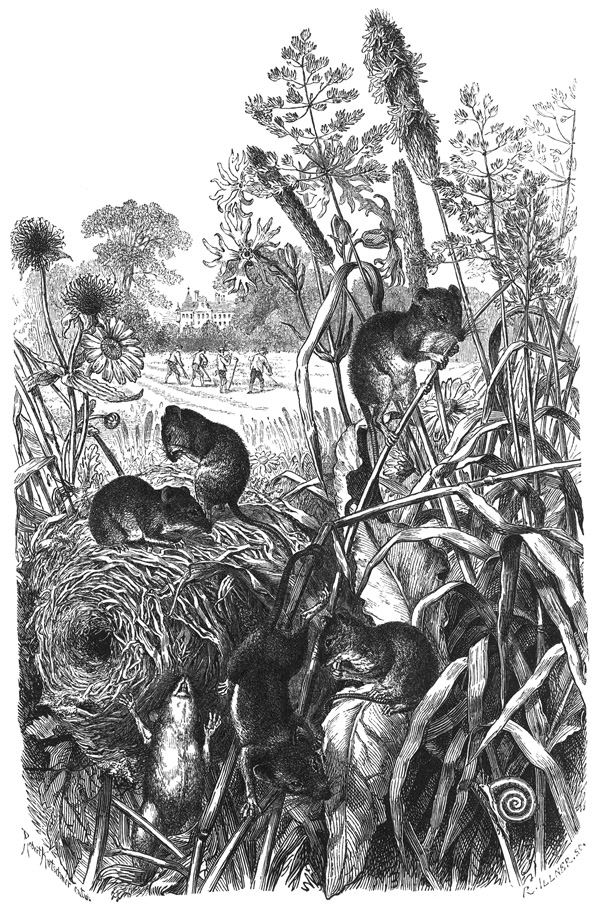
Zwergmaus.
So schmuck und nett alle kleinen Mäuse sind, so allerliebst sie sich in der Gefangenschaft betragen: das kleinste Mitglied der Familie, die Zwergmaus ( Mus minutus, Mus pendulinus, soricinus, parvulus, campestris, pratensis und messorius, Micromys agilis) übertrifft jene doch in jeder Hinsicht. Sie ist beweglicher, geschickter, munterer, kurz ein viel anmuthigeres Thierchen als alle übrigen. Ihre Länge beträgt 13 Centim., wovon fast die Hälfte auf den Schwanz kommt. Die Pelzfärbung wechselt. Gewöhnlich ist sie zweifarbig, die Oberseite des Körpers und der Schwanz gelblich braunroth, die Unterseite und die Füße scharf abgesetzt weiß; es kommen jedoch dunklere und hellere, röthlichere und bräunlichere, grauere und gelbere vor; die Unterseite steht nicht so scharf im Gegensatze mit der oberen; junge Thiere haben andere Körperverhältnisse als die alten und noch eine ganz andere Leibesfärbung, nämlich viel mehr Grau auf der Oberseite.
Von jeher hat die Zwergmaus den Thierkundigen Kopfzerbrechen gemacht. Pallas entdeckte sie in Sibirien, beschrieb sie genau und bildete sie auch ganz gut ab; aber fast jeder Forscher nach ihm, welchem sie in die Hände kam, stellte sie als eine neue Art auf, und jeder glaubte in seinem Rechte zu sein. Erst fortgesetzte Beobachtung ergab als unumstößliche Wahrheit, daß unser Zwerglein wirklich von Sibirien an durch ganz Rußland, Ungarn, Polen und Deutschland bis nach Frankreich, England und Italien reicht und nur ausnahmsweise in manchen Gegenden nicht vorkommt. Sie lebt in allen Ebenen, in denen der Ackerbau blüht, und keineswegs immer auf den Feldern, sondern vorzugsweise im Schilfe und im Rohre, in Sümpfen und in Binsen etc. In Sibirien und in den Steppen am Fuße des Kaukasus ist sie gemein, in Rußland und England, in Schleswig und Holstein wenigstens nicht selten. Aber auch in den übrigen Ländern Europas kann sie zuweilen häufig werden.
Während des Sommers findet man das niedliche Geschöpf in Gesellschaft der Wald- und Feldmaus in Getreidefeldern, im Winter massenweise unter Feimen oder auch in Scheuern, in welche sie mit der Frucht eingeführt wird. Wenn sie im freien Felde überwintert, bringt sie zwar einen Theil der kalten Zeit schlafend zu, fällt aber niemals in völlige Erstarrung, und trägt deshalb während des Sommers Vorräthe in ihre Höhlen ein, um davon leben zu können, wenn die Noth an die Pforte klopft. Ihre Nahrung ist die aller übrigen Mäuse: Getreide und Sämereien von verschiedenen Gräsern, Kräutern und Bäumen, namentlich aber auch kleine Kerbthiere aller Art.
In ihren Bewegungen zeichnet sich die Zwergmaus vor allen anderen Arten der Familie aus. Sie läuft, ungeachtet ihrer geringen Größe, ungemein schnell und klettert mit größter Fertigkeit, Gewandtheit und Zierlichkeit. An den dünnsten Aesten der Gebüsche, an Grashalmen, welche so schwach sind, daß sie mit ihr zur Erde beugen, schwebend und hängend, läuft sie empor, fast ebensoschnell an Bäumen, und der zierliche kleine Schwanz wird dabei so recht geschickt als Wickelschwanz benutzt. Auch im Schwimmen ist sie wohlerfahren und im Tauchen sehr bewandert. So kommt es, daß sie überall wohnen und leben kann.
Ihre größte Fertigkeit entfaltet die Zwergmaus aber doch noch in etwas anderem. Sie ist eine Künstlerin, wie es wenige gibt unter den Säugethieren, eine Künstlerin, welche mit den begabtesten Vögeln zu wetteifern versucht; denn sie baut ein Nest, das an Schönheit alle anderen Säugethiernester weit übertrifft. Als hätte sie es einem Rohrsänger abgesehen, so eigenthümlich wird der niedliche Bau angelegt. Das Nest steht, je nach des Orts Beschaffenheit, entweder auf zwanzig bis dreißig Rietgrasblättern, deren Spitzen zerschlissen und so durcheinandergeflochten sind, daß sie den Bau von allen Seiten umschließen, oder es hängt, zwischen ½ bis 1 Meter hoch über der Erde, frei an den Zweigen eines Busches, an einem Schilfstengel und dergleichen, so daß es aussieht, als schwebe es in der Luft. In seiner Gestalt ähnelt es am meisten einem stumpfen Eie, einem besonders rundlichen Gänseeie z. B., dem es auch in der Größe ungefähr gleichkommt. Die äußere Umhüllung besteht immer aus gänzlich zerschlitzten Blättern des Rohrs oder Rietgrases, deren Stengel die Grundlage des ganzen Baues bilden. Die Zwergmaus nimmt jedes Blättchen mit den Zähnen in das Maul und zieht es mehrere Male zwischen den nadelscharfen Spitzen durch, bis jedes einzelne Blatt sechs-, acht- oder zehnfach getheilt, gleichsam in mehrere besondere Faden getrennt worden ist; dann wird alles außerordentlich sorgfältig durcheinandergeschlungen, verwebt und geflochten. Das Innere ist mit Rohrähren, mit Kolbenwolle, mit Kätzchen und Blütenrispen aller Art ausgefüttert. Eine kleine Oeffnung führt von einer Seite hinein, und wenn man da hindurch in das Innere greift, fühlt sich dieses oben wie unten gleichmäßig geglättet und überaus weich und zart an. Die einzelnen Bestandtheile sind so dicht mit einander verfitzt und verwebt, daß das Nest einen wirklich festen Halt bekommt. Wenn man die viel weniger brauchbaren Werkzeuge dieser Mäuse mit dem geschickten Schnabel der Künstlervögel vergleicht, wird man jenen Bau nicht ohne Verwunderung betrachten und die Arbeit der Zwergmaus über die Baukunst manches Vogels stellen.
Jedes Nestchen wird immer zum Haupttheile aus den Blättern derselben Pflanzen gebildet, welche es tragen. Eine nothwendige Folge hiervon ist, daß das Aeußere auch fast oder ganz dieselbe Färbung hat wie der Strauch selber, an dem es hängt. Nun benutzt die Zwergmaus jeden einzelnen ihrer Paläste bloß zu ihrem Wochenbette, und das dauert nur ganz kurze Zeit: so sind die Jungen regelmäßig ausgeschlüpft, ehe das Blätterwerk um das Nest verwelken und hierdurch eine auffällige Färbung annehmen konnte.
Man glaubt, daß jede Zwergmaus jährlich zwei bis drei Mal Junge wirft, jedes Mal ihrer fünf bis neun. Aeltere Mütter bauen immer künstlichere und vollkommenere Nester als die jüngeren; aber auch in diesen zeigt sich schon der Trieb, die Kunst der alten auszuüben. Bereits im ersten Jahre bauen die Jungen ziemlich vollkommene Nester, um darin zu ruhen. Gewöhnlich verweilen sie so lange in ihrer prächtigen Wiege, bis sie sehen können. Die Alte hat sie jedesmal warm zugedeckt oder vielmehr die Thüre zum Neste verschlossen, wenn sie die Wochenstube verlassen muß, um sich Nahrung zu holen. Sie ist inzwischen wieder mit dem Männchen ihrer Art zusammengekommen und gewöhnlich bereits von neuem trächtig, während sie ihre Kinder noch säugen muß. Kaum sind dann diese soweit, daß sie zur Noth sich ernähren können, so überläßt sie die Alte sich selbst, nachdem sie höchstens ein paar Tage lang ihnen Führer und Rathgeber gewesen ist.
Falls das Glück einem wohl will und man gerade dazu kommt, wenn die Alte ihre Brut zum ersten Male ausführt, hat man Gelegenheit, sich an einem der anziehendsten Familienbilder aus dem Säugethierleben zu erfreuen. So geschickt die junge Schar auch ist, etwas Unterricht muß ihr doch werden, und sie hängt auch noch viel zu sehr an der Mutter, als daß sie gleich selbständig sein und in die weite, gefährliche Welt hinausstürmen möchte. Da klettert nun ein Junges an diesem, das andere an jenem Halme; eines zirpt zu der Mutter auf, eines verlangt noch die Mutterbrust; dieses wäscht und putzt sich, jenes hat ein Körnchen gefunden, welches es hübsch mit den Vorderfüßen hält und aufknackt; das Nesthäkchen macht sich noch im Innern des Baues zu schaffen, das beherzteste und muthigste Männchen hat sich schon am weitesten entfernt und schwimmt vielleicht bereits unten in dem Wasser herum: kurz, die Familie ist in der lebhaftesten Bewegung und die Alte gemüthlich mittendrin, hier helfend, dort rufend, führend, leitend, die ganze Gesellschaft beschützend.
Man kann dieses anmuthige Treiben gemächlich betrachten, wenn man das ganze Nest mit nach Hause nimmt und in einen enggeflochtenen Drahtbauer bringt. Mit Hanf, Hafer, Birnen, süßen Aepfeln, Fleisch und Stubenfliegen sind die Zwergmäuse leicht zu erhalten, vergelten auch jede Mühe, welche man sich mit ihnen gibt, durch ihr angenehmes Wesen tausendfach. Allerliebst sieht es aus, wenn man eine Fliege hinhält. Alle fahren mit großen Sprüngen auf sie los, packen sie mit den Füßchen, führen sie zum Munde und tödten sie mit einer Hast und Gier, als ob ein Löwe ein Rind erwürgen wolle; dann halten sie ihre Beute allerliebst mit den Vorderpfoten und führen sie damit zum Munde. Die Jungen werden sehr bald zahm, aber mit zunehmendem Alter wieder scheuer, falls man sich nicht ganz besonders oft und fleißig mit ihnen abgibt. Um die Zeit, wo sie sich im Freien in ihre Schlupfwinkel zurückziehen, werden sie immer sehr unruhig und suchen mit Gewalt zu entfliehen, gerade so, wie die im Käfige gehaltenen Zugvögel zu thun pflegen, wenn die Zeit der Wanderung herannaht. Auch im März zeigen sie dasselbe Gelüste, sich aus dem Käfige zu entfernen. Sonst gewöhnen sie bald ein und bauen lustig an ihren Kunstnestern, nehmen Blätter und ziehen sie mit den Pfoten durch den Mund, um sie zu spalten, ordnen und verweben sie, tragen allerhand Stoffe zusammen, kurz, suchen sich so gut als möglich einzurichten.
Eine der schönsten Arten der Unterfamilie ist die Streifen- oder Berbermaus ( Mus barbarus , Golunda barbara), ein Thierchen, welches einschließlich des 12 Centim. langen Schwanzes etwa 22 Centim. an Länge erreicht. Ein schönes Gelblichbraun oder Röthlichlehmgelb ist die Grundfarbe des Körpers. Vom Kopfe, welcher schwarz gesprenkelt ist, zieht sich ein schwarzbrauner Längsstreifen bis zur Schwanzwurzel herab, und viele ähnliche Streifen verlaufen längs der Seiten, aber in etwas ungerader Richtung. Die Unterseite ist rein weiß. Die Ohren sind röthlichgelb behaart, die schwarzen Schnurren endigen größtentheils in eine weiße Spitze. Der Schwanz ist oben schwarzbraun, unten gelblichbraun.
Die Streifenmaus lebt in Nord- und Mittelafrika, besonders häufig in den Atlasländern, kommt jedoch auch in den inneren Steppen nicht selten vor. Ich beobachtete sie mehrmals in Kordofân, sah sie jedoch immer nur auf Augenblicke, wenn sie zwischen dem hohen Grase der Steppe dahinhuschte. »Wie alle übrigen Verwandten, welche die Steppe bewohnen«, schildert Freund Buvry, »wird die berberische Maus von den Arabern schlechtweg als »Maus der Wildnis« bezeichnet, verachtet und wenig beobachtet; die Eingeborenen wissen deshalb nichts von ihr zu berichten. Man trifft sie längs der ganzen Küste Algeriens, vorzugsweise in steinigen Gegenden, zumal da, wo dürre Höhenzüge fruchtbare Ebenen begrenzen. In den Gehängen der Hügel gräbt sie sich Röhren, welche zu einer tiefer liegenden Kammer führen; in dieser speichert sie sich im Herbste Vorräthe, Kornähren und Gräser auf und zehrt von ihnen nach Bedürfnis bei kaltem oder nassem Wetter. Die beim Zernagen der Aehren abfallende Spreu wird zur Ausfütterung der Kammer benutzt. Je nach der Jahreszeit besteht die Nahrung in Getreide und Sämereien oder in anderen Pflanzenstoffen. Früchte, namentlich Obstsorten, sind ihr ein gesuchter Leckerbissen: in den Fallen, welche ich aufstellte und mit einem Stück Wassermelone köderte, fing ich viele. Ob sie auch Kerbthiere fängt und verzehrt, weiß ich nicht.
»In ihrem Wesen erinnert die Streifenmaus vielfach an die Ratten. Sie ist gefräßig, aber auch bissig, und scheut sich nicht, wenn die Liebe zum Gatten oder Kinde ins Spiel kommt, auf den überlegenen Feind loszugehen, in der Absicht, ihn zurückzuschrecken. Im übrigen ist sie eine echte Maus und zeigt dieselbe Gelenkigkeit, Zierlichkeit und Gewandtheit in ihren Bewegungen wie andere Verwandte. Ueber ihre Fortpflanzung ist mir nichts bekannt geworden.«
Ihrer schmucken Gestalt wegen hat man die Berbermaus öfters nach Europa gebracht. Sie verträgt unser Klima recht gut, da sie in ihrem Vaterlands ja auch, wenigstens zeitweilig, ziemlich bedeutende Kälte ertragen muß. Nur wenn man sie reichlich mit Futter versieht, darf man sie ohne Scheu mit anderen ihrer Art zusammenlassen; im entgegengesetzten Falle greift die stärkere die schwächere an und frißt sie auf.

Streifenmaus ( Mus barbarus). Natürliche Größe.
Die letzte Unterfamilie, welche wir berücksichtigen können, enthält die Hamstermäuse ( Criceti ), mehr oder weniger plump gebaute, meist auch große Mäuse mit gespaltenen Lippen, großen Backentaschen und drei Backenzähnen in jedem Kiefer.
Unser Hamster bildet mit noch etwa einem Dutzend gleichgestalteten und gleichgesinnten Thieren die bekannteste Sippe ( Cricetus ), deren hauptsächlichste Kennzeichen liegen in dem plumpen, dicken Leibe mit dem sehr kurzen, dünnhaarigen Schwanze und den kurzen Gliedmaßen, von denen die Hinterfüße fünf, die Vorderfüße vier Zehen und eine Daumenwarze besitzen. Das Gebiß besteht aus sechzehn Zähnen, zwei Paar auffallend großen Nagezähnen und drei Backenzähnen in jeder Reihe, welche einfach sind und eine höckerige Kaufläche haben. Getreidefelder in fruchtbaren Gegenden des gemäßigten Europa und Asien bilden die Aufenthaltsorte dieser Thiere. Hier graben sie sich tiefe Baue mit mehreren Kammern, in denen sie im Herbste Nahrungsvorräthe aufspeichern, und in diesen Bauen bringen sie ihr Leben hin, dessen Lust und Leid wir kennen lernen, wenn wir das unseres einheimischen Hamsters erforschen.
Dieses leiblich recht hübsche, geistig aber um so häßlichere, boshafte und bissige Geschöpf ( Cricetus frumentarius, Mus cricetus, Porcellus frumentarius, Cricetus vulgaris) erreicht eine Gesammtlänge von ungefähr 30 Centim., wovon auf den Schwanz etwa 5 Centim. kommen. Der Leib ist untersetzt, der Hals dick, der Kopf ziemlich zugespitzt; die häutigen Ohren sind mittellang, die Augen groß und hell, die Beine kurz, die Füße und Zehen zierlich, die lichten Krallen kurz; der Schwanz ist kegelförmig zugespitzt, aber etwas abgestutzt. Die dichte, glatt anliegende und etwas glänzende Behaarung besteht aus kürzeren und weichen Wollhaaren und längeren und steiferen, auch dünner stehenden Grannenhaaren. Gewöhnlich ist die Färbung des Oberkörpers ein lichtes Braungelb, welches wegen der schwarzspitzigen Grannen ins Grauliche spielt. Die Oberseite der Schnauze und Augengegend sowie ein Halsband sind rothbraun, ein Fleck auf den Backen ist gelb, der Mund weißlich, die Unterseite, auch die Beine bis zu den Füßen herab und die Hinterbeine wenigstens innen, sowie ein Streifen über der Stirn sind schwarz, die Füße dagegen weiß. Meist stehen noch gelbe Flecken hinter den Ohren und vor und hinter den Vorderbeinen. Es gibt aber die verschiedensten Spielarten: manche sind ganz schwarz, andere schwarz mit weißer Kehle, grauem Scheitel, die hellen Spielarten blaß graugelb mit dunkelgrauer Unterseite und blaßgelbem Schulterfleck, andere oben matt fahl, unten lichtgrau, an den Schultern weißlich; auch vollständige Weißlinge werden zuweilen gefunden.

Hamster ( Cricetus frumentarius). [2/5] natürl. Größe.
Fruchtbare Getreidefelder vom Rheine bis an den Ob gewähren dem Hamster Aufenthalt und Nahrung. In Deutschland fehlt er in den südlich und südwestlich gelegenen Ländern und Provinzen, ebenso in Ost- und Westpreußen, ist dagegen häufig in Thüringen und Sachsen. Ein Boden, welcher mäßig fest, trocken und dabei fruchtbar ist, scheint die Hauptbedingung für sein Wohlbefinden zu sein. Er verlangt, daß die Baue, welche er gräbt, dauerhaft sind, und meidet aus diesem Grunde alle sandigen Gegenden; aber er will sich auch nicht sehr anstrengeu beim Graben und verschont deshalb sehr festen und steinigen Boden mit seinen Ansiedelungen. Gebirge und Waldungen meidet er, auch wasserreiche Niederungen liebt er nicht. Wo er vorkommt, tritt er häufig, manchmal in ganz unglaublichen Scharen auf.
Seine Baue bestehen aus einer großen Wohnkammer, welche in einer Tiefe von 1 bis 2 Meter liegt, einer schrägen Ausgangs- und einer senkrechten Eingangsröhre. Durch Gänge steht diese Wohnkammer mit dem Vorrathsraume in Verbindung. Je nach Geschlecht und Alter des Thieres werden die Baue verschieden angelegt, die junger Hamster sind die flachsten und kürzesten, die des Weibchens bedeutend größer, die des alten Rammlers die größten. Man erkennt den Hamsterbau leicht an dem Erdhaufen, welcher vor der Ausgangsröhre liegt und gewöhnlich mit Spreu und Hülsen bestreut ist. Das Fallloch geht immer senkrecht in die Erde hinein, bisweilen so gerade, daß man einen langen Stock in dasselbe stecken kann; doch fällt es nicht in die Kammer ein, sondern biegt sich nach unten bald in wagrechter, bald in schiefer Richtung nach derselben hin. Das Schlupfloch dagegen läuft selten in gerader Richtung, sondern mehr gebogen der Kammer zu. An den Gängen kann man sehr leicht ersehen, ob ein Bau bewohnt ist oder nicht. Findet sich in ihnen Moos, Schimmel oder Gras, oder sehen sie auch nur rauh aus, so sind sie entschieden verlassen; denn jeder Hamster hält sein Haus und seine Hausthüre außerordentlich rein und in Ordnung. Länger bewohnte Gänge werden beim Aus- und Einfahren so durch das Haar geglättet, daß ihre Wände glänzen. Außen sind die Löcher etwas weiter als in ihrem Fortgange; dort haben sie meistens 5 bis 8 Centim. im Durchmesser. Unter den Kammern ist die glattwandige Wohnkammer die kleinere, auch stets mit sehr feinem Stroh, meistens mit den Scheiden der Halme angefüllt, welche eine weiche Unterlage bilden. Drei Gänge münden in sie ein, der eine vom Schlupf-, der andere vom Fallloche und der dritte von der Vorrathskammer kommend. Diese ähnelt der ersten Kammer vollständig, ist rundlich oder eiförmig, oben gewölbt, inwendig glatt und gegen den Herbst hin ganz mit Getreide ausgefüllt. Junge Hamster legen bloß eine an, die alten aber, namentlich die Rammler, welche den ganzen Sommer hindurch nur einschleppen, graben sich drei bis fünf solche Speicher, und hier findet man denn auch ebensoviele Metzen Frucht. Manchmal verstopft der Hamster den Gang vom Wohnzimmer aus zur Vorrathskammer mit Erde, zuweilen füllt er ihn auch mit Körnern an. Diese werden so fest zusammengedrückt, daß der Hamstergräber, wenn er die Kammern ausbeuten will, sie gewöhnlich erst mit einem eisernen Werkzeuge auseinanderkratzen muß. Früher behauptete man irrthümlicherweise, daß der Hamster jede Getreideart besonders aufschichte; er trägt jedoch die Körner ein, wie er sie findet, und hebt sie unter der Erde auf. Selten sind sie ganz rein von Aehrenhülsen oder Schalen. Wenn man in einem Baue die verschiedenen Getreidearten wirklich getrennt findet, rührt dies nicht von dem Ordnungssinne des Thieres her, sondern weil es zur betreffenden Zeit eben nur diese und dann nur jene Getreideart fand. In dem Gange, welcher nach dem Schlupfloche führt, weitet sich oft kurz vor der Kammer eine Stelle aus, wo der Hamster seinen Mist abzulegen pflegt. Der Nestbau des Weibchens weicht in mancher Hinsicht von dem beschriebenen ab; er hat nur ein Schlupfloch, aber zwei bis acht Falllöcher, obgleich von diesen, so lange die Jungen noch klein sind, gewöhnlich nur eins recht begangen wird. Das Wochenbett ist rundlich, hat ungefähr 30 Centim. im Durchmesser, ist 8 bis 13 Centim. hoch und besteht aus sehr weichem Stroh. Von der Nestkammer aus gehen zu allen Falllöchern besondere Röhren, manchmal verbinden auch wieder Gänge diese unter sich. Vorrathskammern finden sich sehr selten im Nestbaue; denn das Weibchen trägt, so lange es Junge hat, nichts für sich ein.
Der Hamster ist trotz seiner scheinbaren Plumpheit ein ziemlich gewandtes Thier. Sein kriechender, dem des Igels ziemlich ähnlicher Gang, bei welchem der Unterleib fast auf der Erde schleppt, besteht aus kleinen Schritten. Im Zorne bewegt er sich heftiger und vermag dann auch ziemlich weite Sprünge und hohe Sätze auszuführen. Wo er Widerhalt findet, namentlich an solchen Stellen, wo er sich auf beiden Seiten anstemmen kann, klettert er in die Höhe, in den Ecken von Kisten z. B. oder zwischen Schränken und der Wand, auch an Vorhängen klimmt er sehr rasch empor. Mit einem seiner Beine vermag er sich an einer Kante festzuhalten, und er ist geschickt genug, sich zu drehen und die Höhe, von welcher er herunterhängt, wiederzugewinnen, selbst wenn er bloß mit einem Hinterbeine sich angehangen hatte. Meisterhaft versteht er das Graben. Wenn man ihn in ein Faß mit Erde steckt, geht er augenblicklich ans Werk. Er bricht mit den Vorderfüßen, oder, wenn der Grund hart ist, mit diesen und den Zähnen Erde los, wirft sie zuerst unter den Bauch, holt sie dann mit den Hinterbeinen hervor und schleudert sie hinter sich. Kommt er in die Tiefe, so schiebt er, rückwärtsgehend, ganze Haufen auf einmal heraus; niemals aber füllt er mit ihr seine Backentaschen an, wie fälschlich behauptet wurde. Im Wasser bewegt er sich nicht ungeschickt, obwohl er dasselbe ängstlich meidet. Wirft man ihn in ein mit Wasser gefülltes Gefäß, so schwimmt er rasch umher, knurrt aber wüthend dabei und beweist überhaupt, daß er sich höchst ungemüthlich fühlt. Das Bad strengt ihn auch derart an, daß er alle ihm sonst eigene Bosheit und Wuth gänzlich vergißt und froh ist, wenn er sich wieder auf dem Trockenen fühlt. Sogleich nach dem Bade beginnt ein höchst sorgfältiges Putzen. Der Hamster ist mit seinen Vorderfüßen ungemein geschickt und versteht sie ganz wie Hände zu benutzen. Mit ihnen führt er die Nahrung zum Munde, mit ihnen hält und dreht er die Aehren, welche er enthülsen will, um die Körner in seinen Backentaschen aufzuspeichern, und mit ihrer Hülfe bringt er auch seinen Pelz in Ordnung. Sobald er aus dem Wasser kommt, schüttelt er sich erst tüchtig ab, setzt sich sodann auf die Hinterbeine und beginnt nun eifrig zu lecken und zu putzen. Zuerst kommt der Kopf daran. Er legt beide Hände bis an die Ohren und zieht sie nach vorwärts über das Gesicht, wie er thut, wenn er sich sonst wäscht; dann nimmt er einen Haarbüschel nach dem andern und reibt ihn so lange zwischen den Händen, bis er den erforderlichen Grad von Trockenheit zu haben scheint. Die Haare der Schenkel und des Rückens weiß er auf sehr sinnreiche Art wieder zu ordnen. Er setzt sich dabei auf die Schenkel und den Hintern und leckt und kämmt mit den Zähnen und Pfoten gemeinschaftlich, wobei er letztere außerordentlich rasch von oben nach unten bewegt; die Hauptarbeit scheint hier aber mit der Zunge zu geschehen. Eine derartige Reinigung dauert immer längere Zeit und scheint gleichsam mit Widerstreben ausgeführt zu werden. Wenn er überrascht wird, erhebt er sich augenblicklich auf die Hinterbeine und läßt dabei die Vorderbeine herabhängen, eine Hand gewöhnlich etwas tiefer als die andere. So starrt er den Gegenstand, welcher ihn in Aufregung versetzte, scharf an, augenscheinlich bereit, bei einer sich bietenden Gelegenheit auf ihn loszufahren und von seinen Zähnen Gebrauch zu machen.
Die höheren Sinne des Hamsters scheinen ziemlich gleich ausgebildet zu sein; wenigstens bemerkt man nicht, daß der eine vor dem andern besonders entwickelt wäre. Die geistigen Eigenschaften sind nicht gerade geeignet, ihn zu einem Lieblinge des Menschen zu machen. Der Zorn beherrscht sein ganzes Wesen in einem Grade wie bei kaum einem andern Nager von so geringer Größe, Ratten oder Lemminge etwa ausgenommen. Bei der geringsten Ursache stellt er sich trotzig zur Wehre, knurrt tief und hohl im Innern, knirscht mit den Zähnen und schlägt sie ungemein schnell und heftig aufeinander. Ebenso groß wie sein Zorn ist auch sein Muth. Er wehrt sich gegen jedes Thier, welches ihn angreift, und so lange, als er kann. Ungeschickten Hunden gegenüber bleibt er oft Sieger; nur die klugen Pintscher wissen ihn zu packen und schütteln ihn sodann fast augenblicklich zu Tode. Alle Hunde hassen den Hamster beinahe ebenso wie den Igel, weil sie sich ärgern, ihre Herrschaft einem so kleinen Thiere nicht sogleich aufzwingen zu können. Sie verfolgen ihn mit großem Eifer und bestehen dann die drolligsten Kämpfe mit dem erbosten Gegner. Es dauert immer einige Zeit, ehe der Hamster überwunden wird, und sehr oft verkauft er seine Haut theuer genug. »Sobald er merkt«, sagt Sulzer, welcher ein ganzes Buch über ihn geschrieben hat, »daß es ein Hund mit ihm zu thun haben will, leert er, wenn seine Backentaschen mit Getreide vollgestopft sind, solche erstlich aus; alsdann wetzt er die Zähne, indem er sie sehr geschwind auf einander reibt, athmet schnell und laut, mit einem zornigen Aechzen, welches sich mit dem Schnarchen eines Schlafenden vergleichen läßt, und bläst zugleich die Backentaschen dergestalt auf, daß der Kopf und Hals viel dicker aufschwellen als der hintere Theil des Leibes. Dabei richtet er sich auf und springt in dieser Stellung gegen seinen Feind in die Höhe, und wenn dieser weicht, ist er kühn genug, ihn zu verfolgen, indem er ihm wie ein Frosch nachhüpft. Die Plumpheit und Heftigkeit seiner Bewegungen sehen dabei so lustig aus, daß man sich des Lachens kaum erwehren kann. Der Hund wird seiner nicht eher Meister, als bis er ihm von hinten beikommen kann. Dann faßt er ihn sogleich bei dem Genick oder im Rücken und schüttelt ihn zu Tode.« Nicht allein gegen Hunde wehrt sich der Hamster, sondern greift auch kühn den Menschen an, selbst den, welcher gar nichts mit ihm zu schaffen haben mag. Es kommt nicht selten vor, daß man ruhig an einem Hamsterbaue vorübergeht und plötzlich das wüthende Thier in seinen Kleidern hängen hat. An Pferden beißt er sich ebenfalls fest, und gegen Raubvögel, welche ihn vom Boden erhoben, wehrt er sich noch in der Luft. Wenn er sich einmal eingebissen hat, hält er so fest, daß man ihn todtschlagen kann, ehe er nachläßt.
Daß ein so jähzorniges Thier nicht verträglich sein kann, ist erklärlich. Die eigenen Kinder mögen nicht mehr bei der Mutter bleiben, sobald sie größer geworden sind; der männliche Hamster beißt den weiblichen todt, wenn er außer der Paarungszeit mit ihm zusammenkommt. In Gefangenschaft leben die Hamster nur selten miteinander in Frieden, alte wahrscheinlich niemals. Junge, welche noch nicht ein Jahr alt sind, vertragen sich besser. Ich habe längere Zeit in einer Kiste drei Stück gehabt, welche sich niemals zankten, sondern im Gegentheile recht verträglich beieinander hockten, meistens noch einer auf dem anderen. Junge Hamster aus verschiedenen Nestern fallen aber augenblicklich übereinander her und beginnen den Kampf auf Leben und Tod. Aeußerst lustig ist es, wenn man ihm einen Igel zur Gesellschaft gibt. Zuerst betrachtet er neugierig den sonderbaren Kauz, welcher seinerseits sich nicht viel um ihn kümmert und ruhig seines Weges geht. Doch die Ruhe wird bald gestört. Der Igel kommt zufällig in die Nähe seines Mitgefangenen, ein ärgerliches Grunzen begrüßt ihn, und erschreckt rollt er sich zur Kugel ein. Jetzt geht der Hamster auf Erforschungsreisen aus. Der Stachelballen wird berochen und – seine blutige Nase belehrt ihn gründlich von der Vielseitigkeit der Horngebilde. Wüthend stößt er die Kugel von sich – o weh, auch die Hand ist verwundet! Jetzt wetzt er die Zähne, quiekt, faucht, hüpft auf den Ball, springt entsetzt wieder herab, versucht, ihn mit dem Rücken wegzuschieben, sticht sich in die Schulter, wird immer wüthender, macht neue vergebliche Anstrengungen, des Ungeheuers sich zu entledigen, holt sich neue Stiche in Händen und Lippen und stellt sich endlich, mehr erstaunt als erbost, vor dem Stachelhelden auf die Hinterbeine und betrachtet ihn mit unendlich komischer Scheu und mit verbissener Wuth, oder läßt diese an irgend welchem Dinge aus, auch an einem ganz unschuldigen mitgefangenen Hamster, welchem er die dem Igel zugedachten Bisse beizubringen sucht. So oft der Igel sich rührt, geht der Tanz von neuem an, und der Beschauer möchte bersten vor Lachen.
Mit anderen kleineren Thieren verträgt er sich natürlich noch weniger als mit seines Gleichen, ja, er macht förmlich Jagd auf solche; denn seine Nahrung besteht zum guten Theil auch aus lebenden Geschöpfen. Kleine Vögel, Mäuse, Eidechsen, Blindschleichen, Ringelnattern und Kerbthiere frißt er noch lieber als Pflanzenstoffe, und wenn man ihm einen lebenden Vogel in seinen Käfig wirft, springt er blitzschnell zu, zerbeißt ihm zuerst die Flügel, tödtet ihn dann mit einem einzigen Bisse in den Kopf und frißt ihn nun ruhig auf. Das Pflanzenreich muß ihm alles, was irgendwie genießbar ist, zur Nahrung liefern. Er verzehrt grüne Saat- und andere Kräuter, Hülsenfrüchte, Möhren, Kartoffeln u. dgl., auch Wurzeln von manchen Kräutern, sowie Obst, es mag unreif oder reif sein. In der Gefangenschaft nährt er sich auch von allerlei Gebackenem, wie Kuchen und Brod, von Butter, Käse etc., kurz, er zeigt sich als wahrer Allesfresser.
Auch der Hamster ist ein Winterschläfer. Er erwacht, sobald die Erde aufgethaut ist, oft schon im Februar, sicher im März. Anfangs öffnet er seine verstopften Löcher noch nicht, sondern hält sich still unten im Baue und zehrt von seinen eingetragenen Vorräthen. Gegen die Mitte des März erschließen die alten Männchen, anfangs April die alten Weibchen das Fallloch. Jetzt suchen sie sich bereits außen Nahrung, tragen auch von frischbesäeten Ackerstücken, wo sie die Körner sorgfältig auflesen, Getreide in ihren Bau ein. Junge Pflanzen behagen ihnen bald mehr als die Körner, und nunmehr gehen sie dieser Nahrung nach oder nehmen ab und zu auch wohl ein ungeschicktes Vögelchen, eine Maus, einen Käfer, eine Raupe als willkommene Beute mit hinweg. Zu derselben Zeit pflegen sie sich einen neuen Bau zu graben, in welchem sie den Sommer zu verleben gedenken, und sobald dieser fertig ist, paaren sich die Geschlechter. Der Sommerbau ist gewöhnlich nur 30, höchstens 60 Centim. tief, und der Kessel mit einem weichen Neste ausgefüttert, neben welchem dann eine einzige Kammer angelegt wird, falls es viel Saatgetreide in der Umgegend gibt. Ende April begeben sich die Männchen in die Behausung der Weibchen und leben, wie es scheint, friedlich einige Tage mit ihnen; beide zeigen sogar insofern eine gewisse Anhänglichkeit an einander, als sie sich gegenseitig beistehen, wenn es gilt, eines oder das andere zu vertheidigen. Kommen zwei Männchen zu einem Weibchen, so beginnt ein heftiger Zweikampf, bis der schwächere der Gegner unterliegt oder entweicht: man findet oft genug Rammler, welche auf ihrem Leibe tiefe Narben tragen, die Zeichen von solchem Strauß in Liebessachen. In welcher Weise die Begattung vor sich geht, ist nicht bekannt. Man hat sich vergeblich bemüht, dies an zahmen zu erforschen, und weiß nur, daß das unartige Weibchen, sobald es sich befruchtet fühlt, den Rammler durch Güte oder durch Gewalt sofort wieder aus seinem Baue entfernt. Von diesem Augenblicke an herrscht unter den vor kurzem so zärtlichen Liebesleuten dieselbe Erbitterung wie gegen jedes andere fremde Geschöpf. Etwa vier bis fünf Wochen nach der Begattung, zum ersten Male gegen Ende des Mai, zum zweiten Male im Juli, wirft das Weibchen in seinem weich und warm ausgefütterten Neste sechs bis achtzehn Junge. Diese kommen nackt und blind zur Welt, bringen aber ihre Zähne schon mit, wachsen auch außerordentlich schnell. Unmittelbar nach der Geburt, nachdem sie abgetrocknet sind, sehen sie fast blutroth aus und lassen ein Gewimmer vernehmen, wie es kleine Hunde auszustoßen pflegen. Sie erhalten mit dem zweiten oder dritten Tage ein feines Flaumenhaar, welches sich aber bald verdichtet und den ganzen Körper einhüllt. Ungefähr mit dem achten oder neunten Tage ihres Lebens öffnen sie die Augen und beginnen nun auch im Neste umherzukriechen. Die Mutter behandelt ihre Brut mit viel Liebe, duldet es auch, daß man ihr andere Junge zum Säugen anlegt, selbst wenn diese nicht die gleiche Größe wie ihre Kinder haben. Am vierzehnten Tage ihres Alters fangen die jungen Hamster schon zu wühlen an, und sobald sie dies können, denkt die unfreundliche Alte daran, sie selbständig zu machen, d. h. sie jagt sie einfach aus dem Baue und zwingt sie, auf eigene Faust für ihren Unterhalt zu sorgen. Dies scheint den Hamsterchen nicht eben schwer zu werden; denn bereits mit dem fünften oder sechsten Tage, wenn sie kaum behaart und noch vollständig blind sind, wissen sie recht hübsch ein Weizenkorn zwischen ihre Vorderpfötchen zu fassen und die scharfen Zähnchen zu benutzen. Bei Gefahr huschen die kleinen Thierchen, so erbärmlich sie aussehen, behend im Baue umher, und das eine hat sich bald aufs geschickteste in diesem, das andere in jenem Winkel zu verbergen gewußt, wenn auch die meisten der Alten nachgefolgt sind. Diese, sonst so wüthend und boshaft, so muthig und tapfer, zeigt sich feig, wenn es gelten sollte, ihre Brut zu vertheidigen, entflieht auf erbärmliche Weise, sobald sie spürt, daß man ihr oder jenen nahe kommt, und verkriecht sich mit ihren Sprößlingen in das blinde Ende eines Ganges, welchen sie so schnell als möglich nach dem Neste zu mit Erde zu verstopfen sucht, oder mit erstaunlicher Geschicklichkeit und Schnelligkeit weitergräbt. Die Jungen folgen ihr durch Dick und Dünn, durch den Hagel von Erde und Sand, den sie hinter sich wirst. Doch brauchen sie immer ein ganzes Jahr, ehe sie ihre vollständige Größe erreichen; aber es scheint fast, daß im Mai geborene Weibchen im Herbste bereits zur Fortpflanzung befähigt sind.
Sobald die Felder sich gilben und die Körner reifen, haben die Hamster viel zu thun mit der Ernte. Jeder einzelne schleppt, falls er es vermag, bis zu einem Centner an Körnern in seinen Bau. Leinknoten, große Puffbohnen und Erbsen scheinen allen übrigen Früchten vorgezogen zu werden. Ein Hamster, welcher in einem Flachsstücke liegt, wird nicht leicht etwas anderes einernten als die Knollen davon; ebenso ist es im Erbsenfelde; doch wissen sich die Thiere recht wohl in andere Arten von Feldfrüchten zu schicken. Man hat beobachtet, daß die alten Rammler, welche Zeit genug haben, das Getreide auslesen, es viel sorgfältiger aufschichten als die Hamsterweibchen, welche nach der letzten Brut noch rasch einen Bau graben und hier die Speicher füllen müssen. Nur wo der Hamster ganz ungestört ist, verrichtet er seine Ernte bei Tage; gewöhnlich ist die erste Hälfte der Nacht und der Morgen vor Sonnenaufgang seine Arbeitszeit. Er biegt mit den Vorderhänden die hohen Halme um, schneidet mit einem Bisse die Aehre ab, faßt sie mit den Pfoten, dreht sie ein paarmal hin und her und hat sie nun nicht bloß entkörnt, sondern die Körner auch gleich in den Backentaschen geborgen. So werden die weiten Schleppsäcke gefüllt bis zum Uebermaße; manchmal schafft einer bei fünfzig Gramm Körner auf einem Gange nach Hause. Ein so beladener Hamster sieht höchst spaßhaft aus und ist das ungeschickteste Thier der Welt. Man kann ihn mit den Händen ohne Furcht anfassen; denn die vollgepfropften Taschen hindern ihn am Beißen; nur darf man ihm nicht Zeit lassen, sonst streicht er die Körner heraus und setzt sich in Vertheidigungszustand.
Anfangs Oktober, wenn es kalt wird und die Felder leer sind, denkt der Hamster ernstlich daran, sich seine Winterwohnung herzurichten. Zuerst verstopft er das Schlupfloch von der Kammer an bis oben hinauf so dicht als möglich mit Erde, dann vermauert er sein Fallloch, und zwar von innen heraus, manchmal nicht ganz bis zur Oberfläche der Erde. Hat er noch Zeit, oder fürchtet er den Frost, so gräbt er sich ein tieferes Nest und tiefere Kornkammern als bisher und speichert hier seine Vorräthe auf. Das Lager ist sehr klein und wird mit dem feinsten Stroh dicht ausgepolstert. Nunmehr frißt sich der faule Gauch fett und legt sich endlich zusammengerollt zum Schlafen nieder. Gewöhnlich liegt er auf der Seite, den Kopf zwischen den Hinterbeinen an den Bauch gedrückt. Alle Haare befinden sich in der schönsten Ordnung, stehen aber etwas steif vom Körper ab. Die Glieder fühlen sich eiskalt an und lassen sich schwer beugen, schnellen auch, wenn man sie gewaltsam gebogen hat, wie bei todten Thieren, sofort wieder in die frühere Lage zurück; die Augen sind geschlossen, sehen aber hell und klar aus wie beim lebenden und schließen sich auch von selbst wieder. Ein Athemholen oder ein Herzpochen fühlt man nicht. Das ganze Thier stellt ein lebendes Bild des Todes dar. Gewöhnlich schlägt das Herz in der Minute vierzehn bis fünfzehn Mal. Vor dem Aufwachen bemerkt man zunächst, daß die Steifigkeit nachläßt. Dann fängt der Athem an, es folgen einige Bewegungen; der Schläfer gähnt und gibt einen röchelnden Laut von sich, streckt sich, öffnet die Augen, taumelt wie betrunken umher, versucht, sich zu setzen, fällt um, richtet sich von neuem auf, besinnt sich und läuft endlich langsam umher, frißt auch sofort, wenn man ihm etwas vorwirft, putzt und streichelt sich und ist endlich ganz munter. Uebrigens muß man sich immer vorsehen, wenn man einen solchen Erweckungsversuch mit einem Hamster macht; denn der scheinbar ganz leblose belehrt einen manchmal in der allerempfindlichsten Weise, daß er nicht todt ist. Auch im Freien müssen die Hamster mitten im Winter aufwachen; denn zuweilen öffnen sie ihre Löcher im December bei einer Kälte von mehreren Graden unter Null und laufen ein wenig auf den Feldern umher. In einer Stube, welche beständig geheizt wird, kann man sie das ganze Jahr hindurch wach erhalten; sie befinden sich aber doch nicht wohl und sterben bald.
Es ist ein wahres Glück, daß der Hamster, welcher sich zuweilen wahrhaft furchterweckend vermehrt und dann ungeheuren Schaden anrichtet, so viele Feinde hat. Bussarde und Eulen, Raben und manche andere Vögel, vor allem aber Iltis und Wiesel, sind ununterbrochen auf seiner Fährte und tödten ihn, wo und wann sie können. Der Iltis und das große Wiesel folgen ihm auch in seine unterirdischen Wohnungen und müssen deshalb als die schlimmsten aller seiner Feinde angesehen werden. Diesen gewandten Räubern muß der bissige Nager regelmäßig erliegen, obgleich es ohne heftige Kämpfe nicht abgeht. Jeder Landwirt müßte diese beiden nützlichen Raubthiere, wenn er seinen Vortheil erkennen wollte, nach allen Kräften schonen und hegen und pflegen; statt dessen aber schlägt der unwissende Bauer jeden Iltis und jedes Wiesel ohne Gnade und Barmherzigkeit nieder, gewöhnlich ohne zu wissen, warum.
In einigen Gegenden zieht der Mensch regelrecht gegen den Hamster zu Felde. In Thüringen z. B. gibt es Leute, welche sich ein Geschäft daraus machen, die Hamster auszugraben und umzubringen. Daß Mühe und Arbeit dieser Leute nicht vergeblich, sondern ebenso ersprießlich als lohnend ist, geht aus einer Angabe von Lenz hervor. Auf der zwölftausend Acker umfassenden Stadtflur von Gotha wurden in zwölf Jahren über eine Viertelmillivn Hamster erbeutet und an die Stadtbehörde zur Einlösung abgeliefert. Alle Gemeinden in von Hamstern bevölkerten Gegenden pflegen für jeden eine Kleinigkeit zu zahlen, für einen Rammler und einen Jungen weniger, für ein Weibchen mehr. Den Hauptgewinn der Jagd aber bilden die Vorräthe, welche dieses eigenthümliche Wild sich eingetragen hat; die Leute waschen die Körner einfach ab, trocknen sie wieder und vermahlen sie dann wie anderes Getreide. Auch die Felle werden benutzt, obgleich noch nicht in der Ausdehnung, als sie es verdienen; denn nach allen Erfahrungen geben sie ein ganz vortreffliches, leichtes und dauerhaftes Pelzwerk. In manchen Gegenden wird das Fleisch der Hamster gegessen, und es ist auch wirklich nicht der geringste Grund vorhanden, gegen solche Nahrung etwas einzuwenden; denn das Fleisch ist jedenfalls ebensogut, wie das des Eichhörnchens oder anderer Nager, deren Wildbret man mit Behagen verzehrt.