
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
In der ersten Familie vereinigen wir die Hörnchen ( Sciurina), weil wir in ihnen die muntersten und klügsten, also edelsten Nager zu erkennen glauben. Nach Ansicht einzelner Forscher gelten sie gleichzeitig als Urbilder einer Unterordnung, der Eichhornnager (Sciurida), in welche man noch die Bilche, Biber und zwei außereuropäische Nagergruppen aufgenommen hat. Die Hörnchenfamilie zerfällt in zwei größere Unterabtheilungen, welche wir als Eichhörnchen und Murmelthiere unterscheiden. Der Leib der Eichhörnchen im engeren Sinne ( Campsiurina ) ist gestreckt und trägt einen mehr oder weniger langen, oft zweizeilig behaarten Schwanz. Die Augen sind groß und hervorstehend, die Ohren bald klein, bald groß, bald dünn behaart, bald noch mit Pinseln versehen. Das vordere Beinpaar ist merklich kürzer als das hintere. Die Vorderpfoten haben vier Zehen und einen Daumstummel, die hinteren Pfoten fünf Zehen. Im Oberkiefer stehen fünf,
im Unterkiefer vier Backenzähne; unter ihnen ist der erste Oberkieferzahn der kleinste und einfachste; die vier folgenden sind ziemlich übereinstimmend gestaltet. Am Schädel fällt die breite, flache Stirn auf. Die Wirbelsäule besteht meistens aus 12 rippentragenden und 7 rippenlosen Wirbeln; außerdem finden sich 3 Kreuz- und 16 bis 25 Schwanzwirbel. Der Magen ist einfach, der Darm von sehr verschiedener Länge.
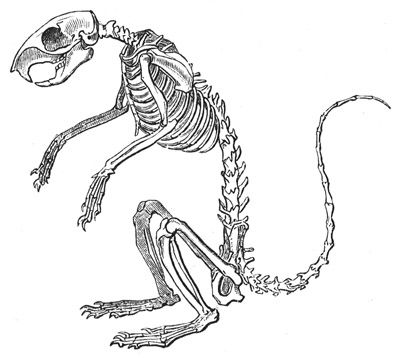
Geripp des Eichhörnchens. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
Die Hörnchen bewohnen mit Ausnahme von Neuholland die ganze Erde, gehen ziemlich weit nach Norden hinauf und finden sich im heißesten Süden, leben in der Tiefe wie in der Höhe, manche Arten ebensogut im Gebirge wie in der Ebene. Waldungen oder wenigstens Baumpflanzungen bilden ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, und bei weitem die größere Anzahl führt ein echtes Baumleben, während einige in unterirdischen, selbstgegrabenen Bauen Herberge nehmen. Gewöhnlich lebt jedes Hörnchen für sich; doch halten sich unter Umständen größere und kleinere Gesellschaften oder wenigstens Paare längere Zeit zusammen, und einzelne Arten unternehmen, getrieben von Nahrungsmangel, Wanderungen, während derer sie sich zu ungeheueren, heerartigen Scharen vereinigen. Im Jahre 1749 hatte die Anpflanzung von Mais eine so außerordentliche Vermehrung des nordamerikanischen grauen und schwarzen Hörnchens bewirkt, daß die Regierung von Pennsylvanien sich genöthigt sah, ein Schußgeld von drei Pence für das Stück auszusetzen. In diesem Jahre allein wurden 1,280,000 Stück dieser Thiere abgeliefert. James Hall erzählt, daß sich im ganzen Westen Nordamerikas die Eichkätzchen binnen weniger Jahre oft ganz ungeheuer vermehren und dann nothwendigerweise auswandern müssen. Heuschreckenartigen Schwärmen vergleichbar, sammeln sich die Thiere im Spätjahre in größere und immer größer werdende Scharen und rücken, Felder und Gärten plündernd, Wälder und Haine verwüstend, in südöstlicher Richtung vor, über Gebirge und Flüsse setzend, verfolgt von einem ganzen Heere von Feinden, ohne daß eine wesentliche Abnahme der Schar bemerkbar würde. Füchse, Iltisse, Falken und Eulen wetteifern mit den Menschen, das wandernde Heer anzugreifen. Längs der Ufer der größeren Flüsse sammeln sich die Knaben und erschlagen zu Hunderten die Thiere, wenn sie vom jenseitigen Ufer herübergeschwommen kommen. Jeder Bauer ermordet so viele von ihnen, als er kann, und dennoch lichten sich ihre Reihen nicht. Beim Beginne ihrer Wanderung sind alle fett und glänzend; je weiter sie aber ziehen, umsomehr kommt das allgemeine Elend, welches solche Nagerheere betrifft, über sie: sie erkranken, magern ab und fallen Hundertweise der Seuche zum Opfer. Die Natur selbst übernimmt die beste Verminderung der Thiere, der Mensch würde ihnen gegenüber geradezu ohnmächtig sein.
Alle Hörnchen bewegen sich lebhaft, schnell und behend, und zwar ebensowohl auf den Bäumen als auf dem Boden. Auf letzterem sind bloß die Flatterhörnchen fremd, besitzen dagegen die Fähigkeit, außerordentlich weite Sprünge auszuführen, wenn auch immer nur von oben nach unten. Die Mehrzahl läuft satzweise und tritt dabei mit ganzer Sohle auf. Fast alle klettern vorzüglich und springen über große Zwischenräume weg von einem Baume zum anderen. Beim Schlafen nehmen sie eine zusammengerollte Stellung an und suchen sich gern bequeme Lagerplätze aus, ruhen daher entweder in einem unterirdischen Baue oder in Baumhöhlen oder endlich in Nestern, welche sie sich theilweise vorgerichtet oder selbst erbaut haben. Die in kalten Ländern wohnenden wandern, wenn der Winter herannaht, oder fallen in einen unterbrochenen Winterschlaf und sammeln sich deshalb größere oder kleinere Mengen von Vorräthen ein, zu denen sie im Nothfalle ihre Zuflucht nehmen. Ihre Stimme besteht in Pfeifen und einem eigenthümlichen, nicht zu beschreibenden Brummen, Knurren und Zischen. Die geistigen Fähigkeiten sind gering, für die Ordnung der Nager aber verhältnismäßig bedeutend. Unter ihren Sinnen dürften Gesicht, Gehör und Geruch am meisten ausgebildet sein; einzelne bekunden jedoch auch ein sehr feines Gefühl, wie sich namentlich bei Veränderung der Witterung offenbart. Sie sind aufmerksam und scheu oder furchtsam und flüchten bei der geringsten Gefahr, welche ihnen zu drohen scheint. Im ganzen ängstlich und feige, wehren sie sich doch nach Möglichkeit, wenn sie ergriffen werden, und können mit ihren scharfen Zähnen tiefe Verwundungen beibringen.
Die meisten Arten scheinen jährlich mehr als einmal Junge zu werfen. Um die Zeit der Paarung lebt oft ein Männchen längere Zeit mit dem Weibchen, hilft ihm wohl auch an dem Ausbaue der mehr oder weniger künstlichen Wohnung, in welcher es später seine Nachkommenschaft beherbergen will. Die Anzahl der Jungen eines Wurfes schwankt zwischen zwei und sieben. Die Kleinen kommen fast nackt und blind zur Welt und bedürfen deshalb eines warmen Lagers und sorgfältiger Pflege und Liebe von Seiten ihrer Mütter. Jung aus dem Neste genommene Eichhörnchen lassen sich ohne besondere Mühe zähmen, halten auch die Gefangenschaft lange Zeit ohne Beschwerde aus. Manche gewöhnen sich an ihre Pfleger und hängen mit einer gewissen Zärtlichkeit an ihnen; doch erreicht ihr Verstand selbst bei längerem Umgange mit dem Menschen keine besondere Ausbildung, und fast regelmäßig bricht im höherem Alter das trotzige und mürrische Wesen durch, welches vielen Nagern gemein zu sein scheint: sie werden böse und bissig, so gutmüthig und harmlos sie früher auch waren.
Alle Hörnchen fressen zwar mit Vorliebe und zeitweilig ausschließlich Pflanzenstoffe, verschmähen aber, wie so viele andere Nager, auch Fleischnahrung nicht, überfallen schwache Säugethiere, jagen eifrig Vögeln nach, plündern unbarmherzig deren Nester aus und morden, als ob sie Raubthiere wären. Ihrem gefräßigem Zahne fällt alles zum Opfer, was ihnen irgendwie genießbar erscheint. Auf Java besuchte Haßkarl Dörfer, in denen die zahlreichen Kokospalmen nie zu reifen Früchten kommen, weil auf den Palmen hausende Eichhörnchen stets die noch unentwickelten Früchte anbeißen und in ihrer Weiterentwickelung stören, wie sie auch später die reifenden Kokosnüsse anbohren, nicht allein um deren Mark zu fressen, sondern auch um die Höhlung der Nuß zu ihrem Neste zu verwenden.
Obgleich man das Fell mehrerer Eichhornarten als Pelzwerk verwerthet, hier und da das Fleisch genießt, kann doch dieser geringe Nutzen den Schaden, welchen die Hörnchen unseren Nutzpflanzen und den nützlichen Vögeln zufügen, nicht aufwiegen. Jene von Haßkarl erwähnten Dörfer auf Java verarmen dieser Thiere wegen und werden nach und nach verlassen, die Feldmarken ganzer Dorfschaften Nordamerikas erleiden die schwersten Einbußen durch die Eichhörnchen. Auch bei uns zu Lande schaden sie mehr, als sie nützen. Im großen, freien Walde mag man sie dulden, in Parkanlagen und Gärten wird man ihrem Wirken Einhalt thun müssen. Sie verwüsten mehr, als sie zu ihrer Sättigung bedürfen, und machen sich als Nestplünderer verhaßt, rechtfertigen also eine Verfolgung unsererseits selbst dann, wenn sie nicht in größeren Scharen auftreten.

Eichhorn (Sciurus vulgaris). ⅓ natürl. Größe.
Weitaus die meisten Mitglieder der Unterfamilie gehören der nur in Australien fehlenden Sippe der Taghörnchen (Sciurus) an. Alle Arten dieser Gruppe zeigen in Gestalt, Bau, Lebensweise und Wesen so große Uebereinstimmung, daß es vollständig genügt, unser Eichhorn und seine Lebensweise zu schildern, um ein Bild des Lebens der gesammten Sippschaft zu gewinnen. Die Kennzeichen der Taghörnchen sind der schlanke Leib und lange, meist buschige, oft zweizeilig behaarte Schwanz, die langen, in der Regel mit einem Haarpinsel geschmückten Ohren, die mit einem Nagel bedeckte Daumenwarze und das Gebiß, in welchem die Schneidezähne seitlich zusammengedrückt sind, während die Backenzähne, unter denen der obere vordere entweder verkümmert ist oder fehlt, nur durch ihre in zwei Zacken nach außen vorspringenden Querleisten auffallen.
Das Eichhorn oder Eichorn (Sciurus vulgaris, Sc. alpinus und italicus), einer von den wenigen Nagern, mit denen der Mensch sich befreundet hat, trotz mancher unangenehmen Eigenschaften ein gern gesehener Genosse im Zimmer, erscheint sogar dem Dichter als eine ansprechende Gestalt. Dies fühlten schon die Griechen heraus, denen wir den Namen zu danken haben, welcher jetzt in der Wissenschaft die Eichhörnchen bezeichnet. »Der mit dem Schwanze sich schattende« bedeutet jener griechische Name, und unwillkürlich muß jeder, welcher die Bedeutung des Wortes Sciurus kennt, an das lebhafte Thierchen denken, wie es da oben sitzt, hoch auf den obersten Kronen der Bäume. Rückert hat das muntere Geschöpf in einer Weise besungen, daß der Forscher sich fast scheuen muß, nach solchen köstlichen Worten seine eigenen zur Beschreibung hinzuzufügen:
»Ich bin in einem früheren Sein
Einmal ein Eichhorn gewesen;
Und bin ich's erst wieder in Edens Hain,
So bin ich vom Kummer genesen.
Falb-feurig-gemantelter Königssohn
Im blühenden, grünenden Reiche!
Du sitzest auf ewig wankendem Thron
Der niemals wankenden Eiche
Und krönest dich selber – wie machst du es doch?
Anstatt mit goldenem Reife,
Mit majestätisch geringeltem, hoch
Emporgetragenem Schweife.
Die Sprossen des Frühlings benagt dein Zahn,
Die noch in der Knospe sich ducken;
Dann klimmest du laubige Kronen hinan,
Dem Vogel ins Nest zu gucken.
Du lässest hören nicht einen Ton,
Und doch, es regt sich die ganze
Kapelle gefiederter Musiker schon,
Dir aufzuspielen zum Tanze.
Dann spielest du froh zum herbstlichen Fest
Mit Nüssen, Bücheln und Eicheln,
Und lässest den letzten schmeichelnden West
Den weichen Rücken dir streicheln.
Die Blätter haften am Baum nicht fest,
Den fallenden folgst du hernieder
Und trägst, sie staunen, zu deinem Nest,
In ihre Höhen sie wieder.
Du hast den schwebenden Winterpalast
Dir künstlich zusammengestoppelt,
Dein wärmstoffhaltendes Pelzwerk hast
Du um dich genommen gedoppelt.
Dir sagt's der Geist, wie der Wind sich dreht,
Du stopfest zuvor ihm die Klinzen,
Und lauschest behaglich, wie's draußen weht,
Du frohster verzauberter Prinzen!
Mich faßt im Herbste, wie dich, ein Trieb,
Zu sammeln und einzutragen,
Doch hab ich, wie warm es im Nest mir blieb,
Nicht dort dein freies Behagen.« –
Die Leibeslänge des Eichhorn beträgt etwa 25 Centim., die Schwanzeslänge 20 Centim., die Höhe am Widerrist 10 Centim. und das Gewicht des erwachsenen Thieres etwas über ein halbes Pfund. Der Pelz ändert im Sommer und im Winter, im Norden und im Süden vielfach ab, und außerdem gibt es noch zufällige Ausartungen. Im Sommer ist die Färbung oben bräunlichroth, an den Kopfseiten grau gemischt, auf der Unterseite vom Kinne an weiß, im Winter oberseits braunroth mit grauweißem Haar untermischt, unterseits weiß, in Sibirien und Nordeuropa aber häufig weißgrau, ohne jede Spur von rothem Anfluge, während der Sommerpelz dem unseres Hörnchens ähnelt. Häufig sieht man auch in den deutschen Wäldern eine schwarze Abart, welche manche Naturforscher schon für eine besondere Art erklären wollten, während wir mit aller Bestimmtheit sagen können, daß oft unter den Jungen eines Wurfes sich rothe und schwarze Stücke befinden. Sehr selten sind weiße oder gefleckte Spielarten, solche mit halb oder ganz weißem Schwanze und dergleichen. Der Schwanz ist sehr buschig und zweizeilig, das Ohr ziert ein Büschel langer Haare, die Fußsohlen sind nackt.
Unser Eichhörnchen ist den Griechen und Spaniern ebensogut bekannt wie den Sibiriern und Lappländern. Sein Verbreitungskreis reicht durch ganz Europa und geht noch über den Kaukasus und Ural hinweg durch das ganze südliche Sibirien bis zum Altai und nach Hinterasien. Wo sich Bäume finden, und zumal wo sich die Bäume zum Walde einen, fehlt es sicher nicht; aber es ist nicht überall und auch nicht in allen Jahren gleich häufig. Hochstämmige, trockene und schattige Wälder bilden seine bevorzugtesten Aufenthaltsplätze; Nässe und Sonnenschein sind ihm gleich zuwider. Während der Reife des Obstes und der Nüsse besucht es die Gärten des Dorfes, doch nur dann, wenn sich vom Walde aus eine Verbindung durch Feldhölzchen oder wenigstens Gebüsche findet. Da, wo viele Fichten- und Kieferzapfen reifen, setzt es sich fest und erbaut sich eine oder mehrere Wohnungen, gewöhnlich in alten Krähenhorsten, welche es künstlich herrichtet. Zu kürzerem Aufenthalte benutzt es verlassene Elster-, Krähen- und Raubvögelhorste, wie sie sind; die Wohnungen aber, welche zur Nachtherberge, zum Schutze gegen üble Witterung und zum Wochenbette des Weibchens dienen, werden ganz neu erbaut, obwohl oft aus den von Vögeln zusammengetragenen Stoffen. Man will bemerkt haben, daß jedes Hörnchen wenigstens vier Nester habe, doch ist mit Sicherheit hierüber wohl noch nichts festgestellt worden, und ich glaube beobachtet zu haben, daß Laune und Bedürfnis des Thieres außerordentlich wechseln. Höhlungen in Bäumen, am liebsten die in hohlen Stämmen, werden ebenfalls von ihm besucht und unter Umständen auch ausgebaut. Die freien Nester stehen gewöhnlich in einem Zwiesel dicht an dem Hauptstamme des Baumes; ihr Boden ist gebaut wie der eines größeren Vogelnestes, oben aber deckt sie nach Art der Elsternester ein flaches, kegelförmiges Dach, dicht genug, um dem Eindringen des Regens vollständig zu widerstehen. Der Haupteingang ist abwärts gerichtet, gewöhnlich nach Morgen hin; ein etwas kleineres Fluchtloch befindet sich dicht am Schafte. Zartes Moos bildet im Innern ringsum ein weiches Polster. Der Außentheil besteht aus dünneren und dickeren Reisern, welche durcheinander geschränkt wurden. Den festen, mit Erde und Lehm ausgekleibten Boden eines verlassenen Krähennestes benutzt das Hörnchen besonders gern zur Grundlage des seinigen.
Das muntere Thierchen ist unstreitig eine der Hauptzierden unserer Wälder. Bei ruhigem, heiteren Wetter bewegt es sich ununterbrochen, und zwar soviel als möglich auf den Bäumen, welche ihm zu allen Zeiten Nahrung und Obdach bieten. Gelegentlich steigt es gemächlich an einem Stamme herab, läuft bis zu einem zweiten Baume und klettert, oft nur zum Spaße, wieder an diesem empor; denn wenn es will, braucht es den Boden gar nicht zu berühren. Es ist der Affe unserer Wälder und besitzt viele Eigenschaften, welche an die jener launischen Südländer erinnern. Nur höchst wenige Säugethiere dürfte es geben, welche immerwährend so munter sind und so kurze Zeit auf einer und derselben Stelle bleiben, wie das Eichhorn bei leidlicher Witterung. Beständig geht es von Baum zu Baum, von Krone zu Krone, von Zweig zu Zweig; selbst auf der Erde ist es nichts weniger als fremd, langsam und unbehend. Niemals läuft es im Schritte oder Trabe, sondern immer hüpft es in größeren oder kleineren Sprüngen vorwärts, und zwar so schnell, daß ein Hund Mühe hat, es einzuholen, und ein Mann schon nach kurzem Laufe seine Verfolgung aufgeben muß. Allein seine wahre Gewandtheit zeigt sich doch erst im Klettern. Mit unglaublicher Sicherheit und Schnelligkeit rutscht es an den Baumstämmen empor, auch an den glättesten. Die langen, scharfen Krallen an den fingerartigen Zehen leisten ihm dabei vortreffliche Dienste. Es häkelt sich in die Baumrinde ein, und zwar immer mit allen vier Füßen zugleich. Dann nimmt es einen neuen Anlauf zum Sprunge und schießt weiter nach oben; aber ein Sprung folgt so schnell auf den anderen, daß das Emporsteigen in ununterbrochener Folge vor sich geht und aussieht, als gleite das Thier an dem Stamme in die Höhe. Die Kletterbewegung verursacht ein weit hörbares Rasseln, in welchem man die einzelnen An- und Absätze nicht unterscheiden kann. Gewöhnlich steigt es, ohne abzusetzen, bis in die Krone des Baumes, nicht selten bis zum Wipfel empor; dort läuft es dann auf irgend einem der wagerechten Aeste hinaus und springt gewöhnlich nach der Spitze des Astes eines anderen Baumes hinüber, über Zwischenräume von vier bis fünf Meter, immer von oben nach unten. Wie nothwendig ihm die zweizeilig behaarte Fahne zum Springen ist, hat man durch grausame Versuche erprobt, indem man gefangenen Eichhörnchen den Schwanz abschlug: man bemerkte dann, daß das verstümmelte Geschöpf nicht halb so weit mehr springen konnte. Obgleich die Pfoten des Eichhorns nicht dasselbe leisten können wie die Affenhände, sind sie doch immer noch hinlänglich geeignet, das Thier auch auf dem schwankendsten Zweige zu befestigen, und dieses ist viel zu geschickt, als daß es jemals einen Fehlsprung thäte oder von einem Aste, den es sich auserwählt, herabfiele. Sobald es die äußerste Spitze des Zweiges erreicht, faßt es sie so schnell und fest, daß ihm das Schwanken des Zweiges nicht beschwerlich fällt, und läuft nun mit seiner anmuthigen Gewandtheit äußerst rasch wieder dem Stamme des zweiten Baumes zu. Auch das Schwimmen versteht es vortrefflich, obgleich es nicht gern ins Wasser geht. Man hat sich bemüht, die einfache Handlung des Schwimmens bei ihm so unnatürlich als möglich zu erklären, und gefabelt, daß sich das Hörnchen erst ein Stück Baumrinde ins Wasser trage zu einem Boote, welches es dann durch den emporgehobenen Schwanz mit Mast und Segel versähe etc.; das Eichhorn aber schwimmt eben auch nicht anders als die übrigen landbewohnenden Säugethiere und die Nager insbesondere.
Wenn das Hörnchen sich ungestört weiß, sucht es bei seinen Streifereien beständig nach Aesung. Je nach der Jahreszeit genießt es Früchte oder Sämereien, Knospen, Zweige, Schalen, Beeren, Körner und Pilze. Tannen-, Kiefern- und Fichtensamen, Knospen und junge Triebe bleiben wohl der Haupttheil seiner Nahrung. Es beißt die Zapfen unserer Nadelholzbäume am Stiele ab, setzt sich behäbig auf die Hinterläufe, erhebt den Zapfen mit den Vorderfüßen zum Munde, dreht ihn ununterbrochen herum und beißt nun mit seinen vortrefflichen Zähnen ein Blättchen nach dem anderen ab, bis der Kern zum Vorscheine kommt, welchen es dann mit der Zunge aufnimmt und in den Mund führt. Besonders hübsch sieht es aus, wenn es Haselnüsse, seine Lieblingsspeise, in reichlicher Menge haben kann. Am liebsten verzehrt es die Nüsse, wenn sie vollkommen gereift sind. Es ergreift eine ganze Traube, enthülst eine Nuß, faßt sie mit den Vorderfüßen und schabt, die Nuß mit unglaublicher Schnelligkeit hin- und herdrehend, an der Naht mit wenigen Bissen ein Loch durch die Schale, bis sie in zwei Hälften oder in mehrere Stücke zerspringt; dann wird der Kern herausgeschält und, wie alle Speise, welche das Thier zu sich nimmt, gehörig mit den Backenzähnen zermalmt. Bittere Kerne, wie z. B. Mandeln, sind ihm Gift: zwei bittere Mandeln reichen hin, um es umzubringen. Außer den Samen und Kernen frißt das Eichhorn Heidel- wie Preißelbeerblätter und Schwämme (nach Tschudi auch Trüffeln) leidenschaftlich gern. Aus Früchten macht es sich nichts, schält im Gegentheile das ganze Fleisch von Birnen und Aepfeln ab, um zu den Kernen zu gelangen. Leider ist es ein großer Freund von den Eiern, plündert alle Nester, welche es bei seinen Streifereien auffindet, und verschont ebensowenig junge Vögel, wagt sich sogar an alte: Lenz hat einem Eichhorn eine alte Drossel abgejagt, welche nicht etwa lahm, sondern so kräftig war, daß sie sogleich nach ihrer Befreiung weit wegflog, und andere Beobachter haben den meist als harmlos und unschuldig angesehenen Nager als mordsüchtigen Räuber kennen gelernt, welcher kein kleineres Wirbelthier der beiden ersten Klassen verschont: Schacht fand sogar einen Maulwurf im Neste eines Eichhorns.
Sobald das Thier reichliche Nahrung hat, trägt es Vorräthe für spätere, traurigere Zeiten ein. In den Spalten und Löchern hohler Bäume und Baumwurzeln, in selbstgegrabenen Löchern, unter Gebüsch und Steinen, in einem seiner Nester und an anderen ähnlichen Orten legt es seine Speicher an und schleppt oft durch weite Strecken die betreffenden Nüsse, Körner und Kerne nach solchen Plätzen. In den Waldungen Südostsibiriens speichern die Eichhörnchen auch Schwämme und zwar in höchst eigenthümlicher Weise auf. »Sie sind«, bemerkt Radde, »so wenig selbstsüchtig, daß sie die Pilzvorräthe nicht etwa bergen, sondern an die Nadeln oder in Lärchenwäldern an die kleinen Aestchen spießen, sie dort trocken werden und zur Zeit der Hungersnoth diesem und jenem durchwandernden Artgenossen zu Nutzen kommen lassen. Es sind die Kronen alter Stämme oder und häufiger das gedrängt stehende Unterholz der Nadelbäume, welche zum Aufbewahren der Pilze gewählt werden.«
Durch diese Vorsorgen für den Winter bekunden die Eichhörnchen, wie außerordentlich empfindlich sie gegen die Einflüsse der Witterung sind. Falls die Sonne etwas wärmer strahlt als gewöhnlich, halten sie ihr Mittagsschläfchen in ihrem Neste, und treiben sich dann bloß früh und abends im Walde umher; noch viel mehr aber scheuen sie Regengüsse, heftige Gewitter, Stürme und vor allem Schneegestöber. Ihr Vorgefühl der kommenden Witterung läßt sich nicht verkennen. Schon einen halben Tag, bevor das gefürchtete Wetter eintritt, zeigen sie Unruhe durch beständiges Umherspringen auf den Bäumen und ein ganz eigenthümliches Pfeifen und Klatschen, welches man sonst bloß bei größerer Erregung von ihnen vernimmt. Sobald die ersten Vorboten des schlechten Wetters sich zeigen, ziehen sie sich in ihre Nester zurück, oft mehrere in ein und dasselbe, und lassen, das Ausgangsloch an der Wetterseite sorgfältig verstopfend und behaglich in sich zusammengerollt, das Wetter vorübertoben. In dem kalten Sibirien tritt nach dem regen Leben im Herbste eine mit dem vorschreitenden Winter sich steigernde Trägheit ein, welche zu einem Winterschlafe von kurzer Dauer ausarten kann. Sie verlassen ihr Nest zuerst nur wenige Stunden täglich, später tagelang gar nicht mehr, und die sie verfolgenden Jäger müssen, um ihrer ansichtig zu werden, mit dem Beile an hohle Bäume anklopfen und sie erst aufscheuchen. Auch bei uns zu Lande liegen sie oft tagelang ruhig im Neste; schließlich treibt sie der Hunger aber doch heraus und dann zunächst ihren Vorrathskammern zu, in denen sie Schätze für den Winter aufspeicherten. Ein schlechter Herbst wird für sie gewöhnlich verderblich, weil sie in ihm die Wintervorräthe aufbrauchen. Folgt dann ein nur einigermaßen strenger Winter, so bringt er einer Unzahl von ihnen den Tod. Manche Speicher werden vergessen, zu anderen verwehrt der hohe Schnee den Zugang, und so kommt es, daß die munteren Thiere geradezu verhungern. Hier liegt eins und dort eins todt im Neste oder fällt entkräftet vom Baumwipfel herunter, und der Edelmarder hat es noch leichter als sonst, seine Hauptnahrung zu erlangen. In Buchen- und Eichenwäldern sind die Hörnchen immer noch am glücklichsten daran; denn außer den an den Bäumen hängenden Bücheln und Eicheln, welche sie abpflücken, graben sie deren in Menge aus dem Schnee heraus und nähren sich dann recht gut.
Bei uns zu Lande durchwandern die Eichhörnchen nur ausnahmsweise weitere Strecken. Sie begeben sich höchstens von einem Walde nach dem anderen, unterwegs so viel als möglich Gebüsche und Bäume aufsuchend und benutzend. Im Norden dagegen, insbesondere in Sibirien treten sie alljährlich mehr oder weniger regelmäßige Wanderungen an, durchziehen dabei auch baumlose Strecken, überschwimmen reißende Flüsse und Ströme oder steigen über Gebirge hinweg, deren Höhen sie sonst meiden. Radde hat nach eigenen Beobachtungen ausführlich über diese Wanderungen berichtet und damit die Lebenskunde der Thiere wesentlich vervollständigt. Befremdend erscheint es dem in den Gebirgen Südostsibiriens sich aufhaltenden Beobachter, wenn er im Spätherbste plötzlich Eichhörnchen gewissen Oertlichkeiten, auf denen Zirbelkiefern mit gereiften Zapfen stehen, sich zudrängen sieht; denn eine geringe Abweichung von dem einzuschlagenden Wege führt die Thiere entweder in die Dickichte nahrungsarmer Tannenwälder oder in die lichten Laubholzbestände, in denen die verwandten Erdhörnchen auch nicht viel für sie übrig lassen. Erst wenn der Forscher monatelang an Ort und Stelle verweilt, lernt er erkennen, daß diese Wanderungen nicht zufällig geschehen, daß nicht der sogenannte »Instinkt« die Thiere leitet, daß sie vielmehr nicht allein als vortreffliche Ortskundige, sondern auch als Sachverständige sich erweisen, welche wissen, wo Zirbelnüsse reifen und wie sie gediehen sind.
»Im Sommer«, so schildert mein verehrter Freund, »wenn die Eichhörnchen des Burejagebirges ihr glattes, kurzes Haar schwarz tragen und die lebensfrischen paarig in die Dickichte der Wälder sich zurückziehen, um im friedlichen Neste, welches zwischen dem knorrig abstehenden Aste am Tannenstamme gebaut wurde, die Jungen zu erziehen, schweifen einzelne Eichhörnchen, nicht gefesselt durch Familiensorgen, von Westen nach Osten vordringend, in den Uferwäldern des Gebirges umher. Ihre Füße sind abgenutzt, die Sohlen- und Zehenschwielen sehr groß, kahl und mit Blut unterlaufen. Sie kamen aus der Ferne und ließen sich durch größere, waldentblößte Niederungen nicht abhalten. Diese vereinzelten Thiere machen die Vorstudien: sie sind auf regelrechten Erkundigungsreisen begriffen. Im August kehren sie von den untersuchten Thalhöhen zurück; sie wissen, wie es dort um die Zirbelzapfen bestellt ist. Ihrem Geheiße folgend, sehen wir nach Monatsfrist, Ende Septembers, die Zirbelbestände sich beleben, bald mehr, bald weniger, bald stellenweise gar nicht, bald in einzelner Gruppirung, gleichsam als Insulaner in dichtesten Haufen.
»In dem zum rechten Ufer des Amur mündenden Uthale des Burejagebirges wurden 1856 in Zeit von vier Tagen von den Hunden drei Eichhörnchen auf die Jurten der Birar-Tungusen gejagt; im darauf folgenden Jahre waren diese Sommerwanderer viel häufiger. Auf den ziemlich trockenen Sommer des Jahres 1857, welcher das Reifen der Zirbelnüsse begünstigte, folgte ein feuchter Herbst, in welchem die Eichhörnchen in so großer Anzahl zu gewissen Thalhöhen drängten, daß ich mit meinem Tungusen an einem Tage ihrer siebenundachtzig erlegen konnte. Im Jahre 1858, dessen Sommer ein feuchter war, so daß die Zirbelzapfen an Fäule litten, folgten den durchwandernden Eichhörnchen im Herbste nur wenige, so daß etwa zwanzig die höchste Tagesbeute eines Schützen war. Und im Jahre 1852 wurden Gebirge am Südwestwinkel des Baikals, welche bis dahin reich an Pelzthieren waren, in so bedeutendem Grade durch die stattfindenden Auswanderungen entvölkert, daß die meisten Jäger nach Süden ziehen mußten, um in bessere Jagdgebiete zu gelangen.
»Wenngleich die Eichhörnchen im Herbste ziemlich allgemein, oft in angestrengten Märschen, weite Strecken zurücklegen, trifft man doch selten größere Mengen von ihnen dicht beisammen. Sie rücken nicht wie die Lemminge in wohlgeordneten Zügen vor, sondern schweifen in leicht gruppirten und vertheilten Haufen über Berg und Thal, bis der Ort des Rastens gefunden ist. Es gehört zu den seltensten Ereignissen, daß sie, sich näher aneinander drängend, in großen Zügen in der einmal eingeschlagenen Richtung vordringen. Dies geschah im Herbste des Jahres 1847 bei Krasnojarsk, wo viele tausende von ihnen durch den breiten Jeniseistrom schwammen und in den Straßen der Stadt selbst todtgeschlagen wurden.«
Nach Raddes Beobachtungen hält die wandernden Eichhörnchen weder Lahmheit noch ein schwer zu überwindendes Hindernis auf. Einige der von ihm untersuchten Thiere hatten eiternde Wunden an den Füßen und wanderten doch; viele wurden später von ihm ertrunken und im Amur treibend gesehen, da sie selbst bei Eisgange es noch unternehmen, über den breiten und reißenden Strom zu setzen.
Bei Einbruch der Nacht zieht sich das an einem Orte ständig lebende Eichhorn nach seinem Neste zurück und schläft dort, so lange es finster ist, weiß sich aber auch im Dunkeln zu helfen. Lenz ließ sich einmal nachts von zwei Tagelöhnern eine hohe Leiter in den Wald tragen und an einen Baum lehnen, auf welchem sich ein Nest mit jungen Eichhörnchen befand. Alles geschah so leise als möglich. Die Laterne blieb unten bei den Leuten, und Lenz stieg hinauf. Sobald er das Nest mit der Hand berührte, fuhren die Inwohner mit Windeseile heraus, etwa zwei am Baume in die Höhe, eins am Stamme hinunter, eins durch die Luft zu Boden, und im Nu war alles um ihn her wieder still.
Die Stimme des Eichhorns ist im Schreck ein lautes »Duck, duck«, bei Wohlbehagen und bei gelindem Aerger ein merkwürdiges, nicht gut durch Silben auszudrückendes Murren, oder, wie Dietrich aus dem Winckell und Lenz noch besser sagen, ein Murxen. Besondere Freude oder Erregung drückt es durch Pfeifen aus.
Alle Sinne, zumal Gesicht, Gehör und Geruch, sind scharf; doch muß auch, weil sich sonst die Vorempfindung des Wetters nicht erklären ließe, das Gefühl sehr, und ebenso, von Beobachtungen an Gefangenen zu schließen, der Geschmack entschieden ausgebildet sein. Für die geistige Begabung sprechen das gute Gedächtnis, welches das Thier besitzt, und die List und Verschlagenheit, mit denen es sich seinen Feinden zu entziehen weiß. Blitzschnell eilt es dem höchsten der umstehenden Bäume zu, fährt fast immer auf der entgegengesetzten Seite des Stammes bis in den ersten Zwiesel hinan, kommt höchstens mit dem Köpfchen zum Vorschein, drückt und verbirgt sich soviel als thunlich, und sucht so unbemerkt als möglich seine Rettung auszuführen.
Aeltere Eichhörnchen begatten sich zum ersten Male im März, jüngere etwas später. Ein Weibchen versammelt um diese Zeit oft zehn oder mehr Männchen um sich, und diese bestehen dann in Sachen der Liebe blutige Kämpfe miteinander. Wahrscheinlich wird auch hier dem tapfersten der Minne Sold: das Weibchen ergibt sich dem stärkeren, hängt ihm vielleicht sogar eine Zeitlang mit treuer Liebe an. Vier Wochen nach der Paarung wirft es in dem bestgelegensten und am weichsten ausgefütterten Neste drei bis sieben Junge, welche ungefähr neun Tage lang blind bleiben und von der Mutter zärtlich geliebt werden. Baumhöhlen scheinen die bevorzugtesten Wochenbetten abzugeben; nach Lenz nisten die Weibchen auch in Staarkübeln, welche nahe am Walde auf Bäumen hängen und vorher ordentlich ausgepolstert und mit einem bequemen Eingange versehen werden, indem die Mutter das enge Flugloch durch Nagen hinlänglich erweitert. »Ehe die Jungen geboren sind und während sie gesäugt werden«, sagt Lenz, »spielen die Alten lustig und niedlich um das Nest herum. Schlüpfen die Jungen aus dem Neste hervor, so wird etwa fünf Tage lang, wenn das Wetter gut ist, gespielt, gehuscht, geneckt, gejagt, gemurxt, gequiekst: dann ist plötzlich die ganze Familie verschwunden und in den benachbarten Fichtenwald gezogen.« Bei Beunruhigung trägt, wie Knaben recht gut wissen, die Alte ihre Jungen in ein anderes Nest, oft ziemlich weit weg. Man muß daher, wenn man Junge ausnehmen will, vorsichtig sein, und darf sich nie beikommen lassen, ein Nest, in denen man ein Wochenbett vermuthet, zu untersuchen, ehe man die Jungen ausnehmen kann. Nachdem dieselben entwöhnt worden sind, schleppt ihnen die Mutter, vielleicht auch der Vater, noch einige Tage lang Nahrung zu; dann überläßt das Elternpaar die junge Familie ihrem eigenen Schicksale und schreitet zur zweiten Paarung. Die Jungen bleiben noch eine Zeitlang zusammen, spielen hübsch miteinander und gewöhnen sich sehr schnell an die Sitten der Eltern. Im Juni hat die Alte bereits zum zweiten Male Junge, gewöhnlich einige weniger als das erste Mal; und wenn auch diese soweit sind, daß sie mit ihr herumschweifen können, schlägt sie sich oft mit dem früheren Gehecke zusammen, und man sieht jetzt die ganze Bande, manchmal zwölf bis sechszehn Stück, in einem und demselben Waldestheile ihr Wesen treiben.
Ausgezeichnet ist die Reinlichkeit des Hörnchens: es leckt und putzt sich ohne Unterlaß. Weder seine noch seiner Jungen Losung legt es im Neste oder im Nachtlager, vielmehr immer unten am Stamme des Baumes ab. Aus diesem Grunde eignet sich das Eichhorn besonders zum Halten im Zimmer. Man nimmt zu diesem Zwecke die Jungen aus, wenn sie halb erwachsen sind, und füttert sie mit Milch und Semmel groß, bis man ihnen Kernnahrung reichen kann. Hat man eine säugende Katze von gutmüthigem Charakter, so läßt man durch diese das junge Hörnchen groß säugen; es erhält durch jene eine Pflege, wie man selbst sie ihm niemals gewähren kann. Ich habe bereits auf Seite 471 des ersten Bandes mitgetheilt, wie gern sich die gutgeartete Katze solcher Pflege unterzieht, und wiederhole, daß man nichts schöneres sehen kann, als zwei so verschiedene Thiere in solch innigem Zusammenleben.
In der Jugend sind alle Hörnchen muntere, lustige und durchaus harmlose Thierchen, welche recht gern sich hätscheln und schmeicheln lassen. Sie erkennen und lieben ihren Pfleger und bekunden eine gewisse Gelehrigkeit, indem sie dem Rufe folgen. Leider werden fast alle, auch die zahmsten, mit zunehmendem Alter tückisch oder wenigstens bissig, und zumal im Frühjahre, während der Zeit der Paarung, ist ihnen nie recht zu trauen. Freies Umherlaufen im Hause und Hofe darf man ihnen nicht gestatten, weil sie alles mögliche beschnuppern, untersuchen, benagen und verschleppen; man hält sie deshalb in einem Käfige, welcher innen mit Blech ausgeschlagen ist, damit er nicht allzuschnell ein Opfer der Nagezähne werde. Bedingung für ihr Wohlbefinden ist, daß sie ihre Nagezähne an anderen Stoffen abstumpfen können, weil jene sonst übereinander wegwachsen und es ihnen ganz unmöglich machen, Nahrung zu zerkleinern oder überhaupt zu fressen. Man gibt ihnen deshalb unter ihr Futter viele harte Dinge, namentlich Nüsse und Tannenzapfen oder auch Holzkugeln und Holzstückchen; denn gerade die Art und Weise, wie sie fressen, gewährt das Hauptvergnügen, welches die gefangenen überhaupt bereiten. Zierlich ergreifen sie die ihnen vorgehaltene Nahrung mit den beiden Vorderhänden, suchen sich schnell den sichersten Platz aus, setzen sich nieder, schlagen den Schwanz über sich, sehen sich, während sie nagen, schlau und munter um, putzen Maul und Schwanz nach gehaltener Mahlzeit und hüpfen lustig und hübsch in affenartigen Sätzen hin und her. Dieses muntere Treiben und die außerordentliche Reinlichkeit stellen sie mit Recht zu den angenehmsten Nagern, welche man gefangen halten kann.
In dem Edelmarder hat das Eichhorn seinen furchtbarsten Feind. Dem Fuchse gelingt es nur selten, ein Hörnchen zu erschleichen, und Milanen, Habichten und großen Eulen entgeht es dadurch, daß es, wenn ihm die Vögel zu Leibe wollen, rasch in Schraubenlinien um den Stamm klettert. Während die Vögel im Fluge natürlich weit größere Bogen machen müssen, erreicht es endlich doch eine Höhlung, einen dichten Wipfel, wo es sich schützen kann. Anders ist es, wenn es vor dem Edelmarder flüchten muß. Dieser mondsüchtige Gesell klettert genau ebensogut wie sein Opfer und verfolgt letzteres auf Schritt und Tritt, in den Kronen der Bäume ebensowohl wie auf der Erde, kriecht ihm sogar in die Höhlungen, in welche es flüchtet, oder in das dickwandige Nest nach. Unter ängstlichem Klatschen und Pfeifen flieht das Eichhorn vor ihm her, der gewandte Räuber jagt hinter ihm drein, und beide überbieten sich förmlich in prachtvollen Sprüngen. Die einzige Möglichkeit der Rettung für das Eichhorn liegt in seiner Fähigkeit, ohne Schaden vom höchsten Wipfel der Bäume herab auf die Erde zu springen und dann schnell ein Stück weiter fortzueilen, einen neuen Baum zu gewinnen und unter Umständen das alte Spiel nochmals zu wiederholen. Man sieht es daher, wenn der Edelmarder es verfolgt, so eifrig als möglich nach der Höhe streben und zwar regelmäßig in den erwähnten Schraubenlinien, bei denen ihm der Stamm doch mehr oder weniger zur Deckung dient. Der Edelmarder klimmt eifrig hinter ihm drein, und beide steigen wirklich unglaublich schnell zur höchsten Krone empor. Jetzt scheint der Marder es bereits am Kragen zu haben – da springt es in gewaltigem Bogensatze von hohem Wipfel weg in die Luft, streckt alle Gliedmaßen wagerecht von sich ab und saust zum Boden nieder, kommt hier wohlbehalten an und eilt nun ängstlich, so rasch als es kann, davon, um wo möglich ein besseres Versteck sich auszusuchen. Das vermag ihm der Edelmarder doch nicht nachzuthun; demungeachtet fällt es diesem doch bald zur Beute, da er so lange jagt, bis das Opfer aus Erschöpfung geradezu ihm sich preisgibt. Junge Eichhörnchen sind weit mehr Gefahren ausgesetzt als die alten. Eben ausgeschlüpfte kann, wie ich aus eigener Erfahrung versichern darf, sogar ein behender Mensch kletternd einholen. Wir suchten als Knaben solche Junge auf und stiegen ihnen auf die Bäume nach, und mehr als einmal wurde die Gleichgültigkeit, mit welcher sie uns nahekommen ließen, ihr Verderben. Sobald wir den Ast, auf welchem sie saßen, erreichen konnten, waren sie verloren. Wir schüttelten den Ast mit Macht auf und nieder, und das erschreckte Hörnchen dachte gewöhnlich bloß daran, sich recht fest zu halten, um nicht herabzustürzen. Nun ging es weiter und weiter nach außen, immer schüttelnd, bis wir mit raschem Griffe das Thierchen fassen konnten. Auf einen Biß mehr oder weniger kam es uns damals nicht an, weil uns unsere gezähmten ohnehin genugsam mit solchen begabten. Letztere fing ich, wenn sie sich freigemacht hatten und entflohen waren, stets auf die geschilderte Weise wieder ein.
An der Lena leben die Bauern vom Anfang März bis Mitte April ganz für den Eichhornsfang, und mancher stellt dort über tausend Fallen. Diese bestehen aus zwei Bretern, zwischen denen ein Stellholz sich befindet, an welchem ein Stückchen gedörrter Fisch befestigt ist. Berührt das Eichhorn diese Lockspeise, so wird es von dem oberen Brete erschlagen. Die Tungusen schießen es mit stumpfen Pfeilen, um das Fell nicht zu verderben, oder gebrauchen engläufige Büchsen mit Kugeln von der Größe einer Erbse, und tödten es durch Schüsse in den Kopf. Nach mündlichen Mittheilungen Radde's ist die Eichhörnchenjagd in Südostsibirien ebenso unterhaltend als aufregend. Die Menge des Wildes befriedigt und belohnt den Jäger, und die außerdem in den Waldungen hausenden Thiere, beispielsweise Tiger und Bär, erhalten ihn noch außerdem fortwährend in Spannung. Das Fell des Eichhorns gilt schon in den Waldungen Sibiriens 10 bis 15 Kopeken, in den ersten Stapelplätzen, wie in Irkutsk, bereits das Doppelte dieser Summe. Die schönsten Felle kommen aus Sibirien und Lappland und sind im Handel unter dem Namen »Grauwerk« bekannt. Der Bauchtheil heißt gewöhnlich »Veh-« oder »Feh-Wamme« und gilt für eine kostbare Pelzwaare, mit deren Handel sich eine große Zahl von Menschen beschäftigt. Aus Rußland allein werden jährlich über zwei Millionen Grauwerkfelle ausgeführt; die meisten gehen nach China. Außer dem Felle verwendet man die Schwanzhaare zu guten Malerpinseln. Das weiße, zarte, wohlschmeckende Fleisch wird von Sachkennern überall gern gegessen.
Die Alten wähnten, im Gehirn und Fleisch kräftige Heilmittel zu besitzen, und unter dem Landvolke besteht noch heutzutage hier und da der Glaube, daß ein zu Pulver gebranntes männliches Eichhorn das beste Heilmittel für kranke Hengste, ein weibliches für kranke Stuten gäbe. Manche Gaukler und Seiltänzer sollen in dem Wahne leben, durch den Genuß des gepulverten Gehirns vor Schwindel sicher zu sein, und deshalb dem Hörnchen oft nachstellen, um sich bei ihren gefährlichen Sprüngen zu sichern. Doch ist die Verfolgung, welche das Thier bei uns seitens des Menschen erleidet, kaum in Anschlag zu bringen. Man hegt es, seiner Niedlichkeit und Munterkeit halber, viel mehr, als es verdient. Vergleicht man den Nutzen, welchen es durch gelegentliches Aufzehren von Maikäfern und anderen schädlichen Kerbthieren sowie durch von ihm nicht beabsichtigtes Anpflanzen von Eichen, infolge der von ihm verschleppten Eicheln, bringen kann, mit dem Schaden, den es durch Abbeißen junger Triebe und Knospen, Benagen der Rinde und Plündern der Früchte unseren Nutzpflanzen, oder durch seine räuberischen Gelüste den hegenswerthen Vögeln zufügt, so wird man es zu den schädlichen Thieren zählen und mindestens streng beaufsichtigen müssen.
»So niedlich das Thierchen«, sagen die Gebrüder Müller trefflich und wahr, »den Augen des vorübergehenden Beobachters in unseren Wäldern, Hainen und Lustgärten sich darstellt, so schädlich erscheint es in den tiefer blickenden des Forschers und Kenners seiner Nahrungsweise: denn diese ist nur eine zerstörende. Im Frühjahre und Vorsommer verübt es die größten Beschädigungen bei Holzwüchsen. Nach unseren Beobachtungen beißt das Eichhörnchen eine Menge Seiten- und Wipfeltriebe an jungen Kiefern und Fichten ab, so daß es deren Wachsthum empfindlich hemmt, deren Ausbildung zu regelmäßigen Stämmen entweder sehr beeinträchtigt oder ganz verhindert. Dieses Entwipfeln kann sich über eine beträchtliche Strecke Waldes in mehreren Gemarkungen ausdehnen und Nadelholz-Stangenorte bis zu fünf Meter Höhe treffen. Die Ursache dieser Beschädigung ist immer Mangel an hinreichender Nahrung. Auch geht das Eichhörnchen den Knospen hauptsächlich im Frühjahre nach, weil diese dann durch den Saftandrang nahrungsreicher und verlockender werden. Die Liebhaberei des Thieres für den Bildungssaft des Holzes bekundet sich so recht deutlich an den Ringeln der Stämmchen. Es zernagt an Fichten, Lärchen, Edeltannen und Föhren den Rindenkörper schraubenförmig oder platzweise in Rechteckform, so daß hierdurch namentlich junge Nadelholzstämmchen regelmäßig eingehen. Nur das Eichhörnchen allein ist ferner der Urheber der sogenannten Absprünge, über welche man soviel gefaselt hat, indem man sie bald als Unbilden der Kreuzschnäbel, bald als eine Folge von Wind- und Sturmschäden, ja sogar, wie der alte Bechstein naiv meint, als die von dem andrängenden Safte abgestoßenen Triebe betrachtete. Besonders in stillen Morgenstunden beißt das Thier die einjährigen Triebe an Fichten ab, diese seine Beschädigungen in unzähligen den Boden unter den Stämmen oft dicht bedeckenden Trieben verrathend.«

Taguan.
Rechnet man hierzu die obenerwähnte Raubsucht und das abscheuliche Nestplündern, welches von dem Eichhörnchen mit ebensoviel Geschicklichkeit als Gier geübt wird, so wird man den Gebrüdern Müller wohl recht geben müssen, wenn sie das Thier als ein in jeder Hinsicht schädliches bezeichnen und ernstlich mahnen, seine Verminderung sich angelegen sein zu lassen.
An die Taghörnchen reihen die nächtlich lebenden Flug- oder Flatterhörnchen ( Pteromys ) sich an. Sie unterscheiden sich von jenen hauptsächlich dadurch, daß ihre Beine und Füße durch eine breite Flatterhaut verbunden werden. Diese, ein Fallschirm, welcher die Flughörnchen befähigt, mit Leichtigkeit sehr bedeutende Sprünge in schiefer Richtung von oben nach unten auszuführen, besteht aus einer derben Haut, welche an den vorderen und hinteren Gliedmaßen und zu beiden Seiten des Leibes befestigt und auf der Rückenseite dicht, auf der Bauchseite aber dünn und spärlich behaart ist. Ein knöcherner Sporn an der Handwurzel stützt das vordere Ende der Flatterhaut noch besonders. Der Schwanz dient als kräftiges Steuerruder und ist immer stark, bei den verschiedenen Arten jedoch nicht in derselben Weise, bei der einen Gruppe nämlich einfach buschig, bei der anderen zweizeilig behaart. Hierzu kommen geringe Unterschiede im Zahnbaue. Die rundschwänzigen Flugeichhörnchen, welche Einige als besondere Sippe ansehen, zeichnen sich durch den eigenthümlichen Bau ihrer kleinen, abgerundeten und verschmälerten Backenzähne aus, während die Arten mit zweizeiligem Schwanze das Gebiß der echten Eichhörnchen besitzen. Beide Gruppen, welche wir in eine Sippe vereinigen, sind über die nördliche Erdhälfte verbreitet und im Vergleiche zu den übrigen Gattungen der Familie arm an Arten.
Der Taguan ( Pteromys Petaurista, Sciurus Petaurista), das größte Mitglied der ganzen Familie, kommt in seinen Körperverhältnissen einer Hauskatze fast gleich; seine Leibeslänge beträgt 60 Centim., die des Schwanzes 55 Centim. und die Höhe am Widerrist 20 Centim. Der Leib ist gestreckt, der Hals kurz, der Kopf verhältnismäßig klein und die Schnauze zugespitzt. Die Ohren sind kurz und breit, aufrechtstehend und oft in eine Spitze auslaufend, die weit vortretenden Augen groß. Die hinteren Beine sind deutlich länger als die vorderen; jene haben fünf, diese vier Zehen, welche, die mit plattem Nagel bekleidete Daumenwarze ausgenommen, kurze, krumme und spitzige Krallen tragen. Die Flatterhaut beginnt an den Vorderbeinen, zieht sich an den Seiten des Leibes hinab und heftet sich an den Hinterbeinen an, von wo aus sie sich noch in einer kleinen Hautfalte gegen den Schwanz hin verlängert. In der Ruhe wird sie an den Leib angezogen und tritt bloß da lappenähnlich vor, wo sie durch den spornartigen Knochen an der Handwurzel gestützt wird. Der lange und schlaffe Schwanz ist sehr dick und buschig behaart, der Pelz auf dem Körper und den Gliedmaßen dicht, kurz und anliegend, auf der Rückenseite rauher als auf der Unterseite und am Schwanze; die Flatterhaut erscheint wegen der kurzen, feinen Härchen an ihrem Rande wie mit Fransen besetzt. Hinter den Ohren verlängern sich einzelne Haare zu einem Busche, und auf der Wange befindet sich eine mit Borsten besetzte Warze. Die Schnurrhaare sind mäßig lang, aber steif. Wie bei allen nächtlich lebenden Thieren stehen einige dieser Fühlhörner über den Augen, um das wichtige Sinneswerkzeug zu schützen. Auf der Oberseite des Kopfes, dem Rücken und an der Schwanzwurzel wird die Färbung des Pelzes, ein Gemisch von Grau und Schwarz, dadurch hervorgebracht, daß einzelne Haare ganz schwarz, andere an der Spitze weißgrau aussehen; die Seiten des Kopfes und der Streifen, welcher sich vom Nacken gegen die Vorderbeine zieht, sind entweder ebenso gefärbt wie die Oberseite oder röthlichkastanienbraun; das Gesicht ist vorn schwarz, das Ohr hellbraun, und der Hauptbusch hinter demselben dunkelbraun. Auf der ganzen Unterseite hat der Pelz eine schmuzig weißgraue Färbung, welche in der Mitte des Leibes etwas heller wird. Die Flatterhaut ist oben schwarzbraun bis kastanienbraun, lichtaschgrau gerandet, unterseits grau, etwas ins Gelbliche fallend. Die Beine sind röthlichkastanienbraun oder röthlichschwarz; der Schwanz ist schwarz.
Das Festland von Ostindien, und zwar Malabar und Malakka sowie Siam, sind die ausschließliche Heimat des Taguans; denn die auf den Sundainseln vorkommenden Flugeichhörner gelten als ihm zwar sehr verwandte, aber doch hinreichend unterschiedene Arten. Der Taguan lebt nur in den dichtesten Wäldern und beständig auf Bäumen, einzeln oder paarweise mit seinem Weibchen. Bei Tage schläft er in hohlen Bäumen, nachts kommt er hervor und klettert und springt mit außerordentlicher Schnelligkeit, Gewandtheit und Sicherheit in den Baumkronen umher oder in sehr weiten Sätzen nach benachbarten Bäumen, immer von oben nach unten. Dabei breitet er seine Füße wagerecht und spannt hierdurch die Flatterhaut zu einem weiten Fallschirme aus. Der Schwanz wird als Steuerruder benutzt und befähigt das Thier, durch plötzliches Wenden die Richtung seines Fluges mitten im Sprunge zu verändern. Man versichert, daß die Schnelligkeit seiner Sprünge wie überhaupt seiner Bewegungen außerordentlich groß sei, so daß ihnen das Auge kaum folgen könne. Unter seinen Sinnen sind Gehör und Gesicht ziemlich ausgebildet, die übrigen aber weit unvollkommener entwickelt. In seinem geistigen Wesen unterscheidet er sich wesentlich von den eigentlichen Eichhörnchen. Er hat weit weniger Verstand und ist noch viel furchtsamer und scheuer als seine den Tag liebenden Verwandten. Das geringste Geräusch erfüllt ihn mit Entsetzen und bewegt ihn zur eiligsten Flucht. Infolge dieser Vorsicht und Scheu sichert er sich so ziemlich vor den Angriffen der kletternden Raubthiere seiner Klasse; den größeren Eulen aber mag er oft genug zum Opfer fallen: sie fangen ihn, trotz seines raschen Fluges, mitten im Sprunge, und ihnen gegenüber ist das verhältnismäßig schwache Thier wehrlos.
Bei der Seltenheit des Taguan fehlen genaue Beobachtungen über sein Leben. Die wenigsten Reisenden thun seiner Erwähnung, und auch die Eingeborenen wissen nur sehr kärglich über ihn zu berichten. Von einer verwandten, in China lebenden Art erzählt Swinhoe. Kamphersammler hatten auf einem hohen, alten Baume ein großes Nest bemerkt und den Baum gefällt. Beim Niederstürzen wurde das Nest weggeschleudert, und zwei große Flugeichhörnchen sprangen heraus, um auf einem benachbarten Baume Zuflucht zu suchen. In dem umfangreichen, gegen einen Meter im Durchmesser haltenden, aus dürren Zweigen errichteten, mit Gras ausgefütterten und mit einem seitlichen Eingange versehenen Neste fanden die Leute ein lebendes Junges und bemächtigten sich seiner. Auf das Schreien desselben kam die Mutter herbei und wurde erlegt, während das zweite alte Flughörnchen, wohl das Männchen, nachdem es das Geschick seines Genossen gesehen, flüchtete und sich nicht nahe kommen ließ, vielmehr von einem Zweige zum anderen sprang und schwebte und endlich im tiefen Walde verschwand. Aus dem Leibe des getödteten Weibchens bereiteten sich die Leute eine nach ihrer Ansicht äußerst schmackhafte Mahlzeit. Das Junge, welches wie ein Meerschweinchen quiekte, wurde Swinhoe gebracht und von ihm mit Milch genährt, saugte diese auch begierig auf, ging jedoch ein, noch ehe es seine Augen geöffnet hatte. Später erhielt Swinhoe auch ein altes lebendes Männchen, hielt es einige Zeitlang im Käfige und ernährte es mit Früchten. Es war ein überaus wüthendes Geschöpf, welches jede Annäherung mit scharfen und ärgerlichen Schreien von sich zu weisen suchte, dabei in eine Ecke des Käfigs sich zurückzog und mit grimmigen Blicken boshaft nach der Hand des Pflegers fuhr, sobald dieser in seine Nähe kam. Die rundsternigen dunklen Augen hatten einen grünlichen Schein und ließen es sofort als Nachtthier erkennen. Auch der gefangene Taguan wird als ein langweiliges wenig versprechendes Geschöpf geschildert. Er fordert eine sorgfältige Pflege, schläft bei Tage und lärmt bei Nacht um so ärger in seinem Käfige umher, zernagt alles Holzwerk, welches ihm den Ausgang hindert, bleibt immer scheu und geht meist nach wenigen Tagen oder Wochen zu Grunde, selbst wenn man ihm soviel als möglich passende Nahrung reicht.
Der Norden beherbergt Flughörnchen mit zweizeiligem, behaartem, langem, buschigem Schwanze. Von ihnen besitzen auch wir eine Art, das Flatterhörnchen, Ljutaga der Russen, Umki oder Omké der ostsibirischen Völkerschaften ( Pteromys volans, Sciurus rotans, Pteromys und Sciuropterus sibiricus), welches den nördlichen Theil von Osteuropa und fast ganz Sibirien bewohnt. Das Thier ist bedeutend kleiner als unser Eichhörnchen, sein Leib mißt bloß 16 Centim. in die Länge, der Schwanz nur 10 Centim. oder mit den Haaren 13 Centim., und das Gewicht eines erwachsenen Thieres übersteigt selten elf Loth. Der dichte und weichhaarige, seidenweich anzufühlende Pelz ist im Sommer auf der Oberseite fahlbraun, auf der Flughaut und der Außenseite der Beine dunkler graubraun, unten weiß und am Schwanze oben fahlgrau, unten lichtrostfarbig. Alle Haare der Oberseite sind am Grunde schwarzgrau und an der Spitze merklich lichter, die der Unterseite dagegen einfarbig weiß. Im Winter verlängert, verdichtet und lichtet sich der Pelz, und die Oberseite nebst dem Schwanze sieht alsdann silbergrau aus, obgleich die Haare ihre Wurzelfärbung nicht verändern.
Das Flatterhörnchen bewohnt größere Birkenwälder oder gemischte Waldungen, in denen Fichten, Föhren und Birken miteinander abwechseln. Letztere Bäume scheinen ihm Lebensbedürfnis zu sein, und hierauf deutet auch die Färbung seines Pelzes, welche im ganzen ebensosehr der Birkenrinde gleicht wie die Färbung unseres Hörnchens der Rinde der Föhren und Fichten. Es wird immer seltener und ist schon aus vielen Gegenden, in denen es früher recht häufig war, fast gänzlich verdrängt worden, kommt jedoch vielleicht öfterer[???] vor, als man glaubt. O. von Löwis schreibt mir, daß es noch gegenwärtig in alten einsamen Waldungen Livlands gefunden, immer aber nur selten beobachtet wird. In Rußland tritt es häufiger auf, und in Sibirien ist es, laut Radde, auf geeigneten Oertlichkeiten, d. h. da, wo Birke und Lärche vorkommen, nirgends selten, läßt sich auch in der Nähe der Ansiedelungen sehen oder kommt selbst bis in die Gärten hinein. Wie der Taguan lebt es einzeln oder paarweise und zwar beständig auf Bäumen. In hohlen Stämmen oder in Nestern, wie eine Haselmaus zusammengerollt und den Schwanz um sich geschlagen, verschläft es den Tag. Mit Eintritt der Dämmerung kommt es hervor und beginnt nun ein reges Leben. Es ist in seinen Bewegungen ebenso gewandt wie die Taghörnchen, klettert vortrefflich, springt behend von Ast zu Ast und setzt mit Hülfe seiner ausgespannten Flatterhaut über Entfernungen von 20 bis 30 Meter. Um solche Entfernungen zu durchmessen, steigt es bis zur höchsten Spitze des Wipfels empor und springt von dort aus auf niedere Aeste der Bäume, welche es sich auserwählt hat. Auf dem Boden ist es eben so unbehülflich und unsicher als auf den Bäumen gewandt und schnell. Sein Gang ist schwankend, und die weite Flughaut, welche faltig zu beiden Seiten des Leibes herabhängt, macht ihm beim Laufen viel zu schaffen.
Die Nahrung besteht aus Nüssen und Baumsamen verschiedener Art, Beeren, Knospen, Sprößlingen und Kätzchen der Birken; im Nothfalle begnügt sich das Thier aber auch mit den jungen Trieben und Knospen der Fichten. Beim Fressen sitzt es, wie unser Eichhörnchen, aufrecht und bringt das Futter mit den Vorderpfoten zum Munde. Ueberhaupt ähnelt es in seinen Eigenschaften unserem Eichkätzchen, nur daß es ein Nachtthier ist. Sehr reinlich, wie die ganze Verwandtschaft, putzt es sich beständig und legt auch seinen Unrath bloß am Boden ab. Mit Eintritt der Kälte verfällt es in einen unterbrochenen Winterschlaf, indem es bei kalten Tagen schläft, bei milderen aber wenigstens ein paar Stunden umherläuft und Nahrung sucht. Es hat sich dann gewöhnlich eines seiner alten Nester zurechtgemacht oder den Horst eines Vogels zur Schlafstätte hergerichtet. Sein eigenes Nest legt es in hohlen Bäumen an, so hoch als möglich über dem Boden. Die ganze Höhlung füllt es mit zartem Moose oder mit Mulm aus, und mit denselben Stoffen verwahrt und verstopft es auch den Eingang. In solchem Neste bringt es im Sommer seine zwei bis drei Jungen zur Welt. Diese werden nackt und blind geboren und bleiben ziemlich lange Zeit unbehülflich und pflegebedürftig im hohen Grade. Während des Tages hüllt sie die Mutter in ihre Flatterhaut ein, um sie zu erwärmen und zugleich bequem säugen zu können; bei ihren nächtlichen Ausgängen bedeckt sie die Brut sorgsam mit Moos. Etwa sechs Tage nach ihrer Geburt brechen die Nagezähne hervor, doch erst zehn Tage später öffnen sie die bisher geschlossenen Aeuglein, und dann beginnt auch das Haar auf ihrem Leibe zu sprossen. Später nimmt sie die Alte mit sich in den Wald, kehrt aber nach langer Zeit zu demselben Neste zurück, um während des Tages dort Ruhe und Schutz zu suchen. Im Herbst bauen oft viele ein einziges großes Nest, in welchem sie gemeinschaftlich wohnen.
Obgleich das dünnhäutige, weichhaarige Fell bloß ein schlechtes Pelzwerk liefert, welches nur die Chinesen verwerthen, stellt man dem Thiere nach und tödtet es jeden Winter in Menge. Es geht ziemlich leicht in Schlingen und zur Winterzeit in Fallen, welche man mit seiner Lieblingsnahrung geködert hat. Sein am Fuße der Bäume oft in großer Menge angehäufter, dem Mäusemist ähnlicher Unrath verräth es leicht seinen Verfolgern.
Gefangene, welche Löwis hielt, wurden ungewöhnlich rasch zahm und zutraulich, setzten sich furchtlos auf den Arm, ließen gern sich streicheln und sahen dabei den Pfleger mit ihren auffallend großen und schönen, schwarzen Nachtaugen vertrauensvoll an, fraßen Haselnüsse aus der Hand, verschmähten jedoch die ihnen gereichten Baumknospen verschiedener Art gänzlich. »Anfangs«, schreibt mir Löwis, »hatte ich sie in einem Drahtkäfige eingesperrt, später ließ ich sie in einem Zimmer frei umherlaufen und klettern. Als aber eines Tages mein Vater plötzlich in das Zimmer trat, erschrak das eine und warf sich, geblendet oder angezogen durch das im Ofen flackernde Feuer, mit ausgespannter Flatterhaut vom Fenster aus in die Oeffnung des Ofens. Obgleich es sogleich hervorgeholt ward, hatte es sich doch so verletzt, daß ich es aus Mitleid umbrachte. Das zweite wurde ein Opfer der Wissenschaft: Grube, dem ich es sandte, tödtete es, um es zu zergliedern.«
Auch ich erhielt einmal ein lebendes Flatterhörnchen aus Rußland, hatte damals jedoch nicht Gelegenheit, es so genau zu beobachten wie später seinen nordamerikanischen Vertreter. Ich will deshalb von diesem, obwohl ich meine Beobachtungen bereits veröffentlicht habe, auch hier einiges mittheilen.
Der Assapan, wie gedachtes Flatterhörnchen in Nordamerika genannt wird ( Pteromys volucella, Sciurus und Sciuropterus volucella), beinah die kleinste, einschließlich des 10 Centim. langen Schwanzes nur 24 Centim. lange Art der Sippe, trägt ebenfalls einen überaus weichen und zarten Pelz, und ist oberseits gelbbräunlichgrau, an den Seiten des Halses lichter, auf den Pfoten silberweiß und an der ganzen Unterseite gelblichweiß, der Schwanz aschgrau mit bräunlichem Anfluge, die Flughaut schwarz und weiß gerandet, das Auge schwärzlichbraun. Das Thierchen lebt gesellig in den Wäldern des gemäßigten und warmen Nordamerika, ganz in der Weise der Ljutaga, wird aber öfter als diese gefangen, zu uns gebracht und hält die Gefangenschaft bei entsprechender Pflege jahrelang ohne ersichtlichen Nachtheil aus und schreitet im Käfige selbst zur Fortpflanzung.
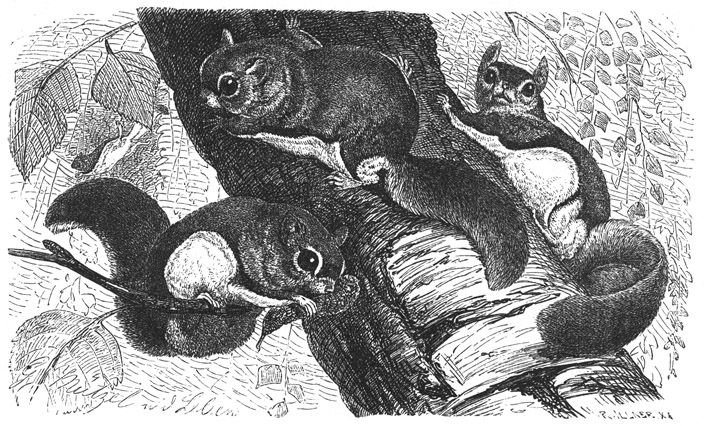
Assapan ( Pteromys volucella). 1/2 natürl. Größe.
Ueber Tages liegen die Flughörnchen, so verborgen als möglich, in sich zusammengeknäuelt in ihrem Käfige. Schlaftrunken gestatten sie dem Beobachter jede Maßnahme. Von der sinnlosen Wuth eines aus dem Schlafe gestörten Siebenschläfers bemerkt man bei ihnen nichts; sie lassen sich in die Hand nehmen, drehen, wenden, besichtigen, ohne von ihrem scharfen Gebisse Gebrauch zu machen. Höchstens einen Versuch zum Entschlüpfen wagen sie, und ihr seidenweiches Fellchen ist so glatt und schlüpfrig, daß sie wie Quecksilber aus der Hand gleiten. Erst ziemlich spät nach Sonnenuntergang, selten vor neun Uhr abends, werden sie munter. Am oberen Rande des Schlafkästchens, welches man ihnen, als Ersatz ihres Nestes, nicht vorenthalten darf, wird das runde Köpfchen sichtbar, der Leib folgt, und bald sitzt eines der Thierchen in anmuthiger Eichhornstellung, die Flatterhaut in sanft geschwungener Linie halb an den Leib gezogen, halb hängen lassend, auf der schmalen Kante seiner Lagerstätte. Die kleinen, voll entfalteten Ohren spielen wie die schnurrenbesetzte Nase oder die großen dunkeln Augen, um Käfig und Umgebung zu prüfen. Wenn nichts Verdächtiges bemerkt wurde, gleitet das Flughörnchen wie ein Schatten zur Tiefe hinab, gleichviel ob an schiefer oder senkrechter Fläche, immer mit dem Kopfe voran, ohne daß man ein Geräusch wahrnimmt oder die durch die Flatterhaut größtentheils verdeckten Gliedmaßen sich bewegen sieht. An der geflochtenen Decke des Käfigs, die Oberseite nach unten gekehrt, rückt es weiter, als ginge es in gebräuchlicher Stellung auf einer ebenen Fläche; über dünne Zweige seiltänzert es mit unübertrefflicher Sicherheit und Geschicklichkeit in gleichmäßiger Eile dahin; über den Boden huscht es schneller als eine Maus; den ganzen Raum des Käfigs durchmißt es, die volle Breite der Flatterhaut entfaltend, in pfeilschnellem Sprunge und klebt einen Augenblick später, ohne auch nur einen Versuch zur Herstellung des Gleichgewichtes gemacht zu haben, auf einer Sitzstange, als sei es ein zum Aste gehöriger Knorren. Währenddem nimmt es ein Bröckchen, eine Nuß, ein Weizenkorn, einen Fleischbissen aus dem Futternapfe, trinkt, mehr schlürfend als leckend, aus dem Trinkgefäße, wäscht sich das Köpfchen mit Speichel, kämmt das Haar mit den Nägeln der Vorderfüße, glättet es sodann mit den Trittflächen der Pfötchen und dreht und wendet, streckt und beugt sich dabei, als ob die Haut ein Sack wäre, in welchem der Leib nur lose steckt. Inzwischen sind auch die Genossen ihrem Schlafkästchen entrückt und hocken und sitzen, kleben und hängen, laufen und klettern in allen nur denkbaren Stellungen eines Nagers auf Sitzstangen, an den Wänden, in Winkeln und Ecken des Käfigs.
Nachdem Hunger und Durst einigermaßen gestillt und alle Theile des Pelzes gebührend geordnet worden sind, regt sich die Lust zu freierer und spielender Bewegung. Eine kurze Weile sitzt das Flughörnchen wie überlegend auf einer und derselben Stelle. Dann folgt ein Sprung mit voll ausgebreiteter Fallhaut, quer durch die Weite des Käfigs. Einen Augenblick nur klebt es an der entgegengesetzten Wand; denn unmittelbar nach der Ankunft am Zielpunkte hat es sich rückwärts geworfen, ist, einen Zweig, eine Sitzstange benutzend, zum Ausgangspunkte zurückgekehrt und ebenso rasch irgendwo andershin geeilt. Auf und nieder, kopfoberst, kopfunterst, hin und her, oben an der Decke weg, unten auf dem Boden fort, an der einen Wand hinauf, an der anderen herab, durch das Schlafkästchen, an dem Futternapfe vorüber zum Trinkgeschirr, aus diesem Winkel in jenen, laufend, rennend, springend, gleitend, schwebend, hängend, klebend, sitzend: so wechselt das unvergleichlich behende Geschöpf von Augenblick zu Augenblick, so stürmt es dahin, als ob es tausend Gelenke zugleich regen könne, als ob es nicht eine zu überwindende Schwere gäbe. Es gehört eine länger währende und sehr scharfe Beobachtung dazu, um dem sich bewegenden Flughörnchen überhaupt folgen, die einzelnen Bewegungen desselben unterscheiden und deuten zu können, und wenn eine Gesellschaft dieser alle übrigen Kletterer beschämenden Geschöpfe durcheinander rennt, springt und schwebt, ist dies überhaupt gänzlich unmöglich. Ueberraschend wirkt namentlich die Jähheit des Wechsels von einer Bewegung zur anderen. Das Flughörnchen beendet auch das tollste Jagen jederzeit nach Ermessen und Belieben, so daß das Auge des Beobachters, bei dem Versuche ihm zu folgen, noch immer umherschweift, während es bereits wieder auf einem bleistiftdünnen Zweige sitzt, als sei es nie in Bewegung gewesen.
Unter sich höchst verträglich, anscheinend auch harmlos gutmüthig, überfallen die Flughörnchen doch ohne weiteres jedes kleine Thier, insbesondere jeden kleinen Vogel, und machen ihm ohne Gnade und Barmherzigkeit den Garaus. Angesichts einer Beute zeigen sie sich ebenso mordgierig wie Raubthiere; ihre unbeschreibliche Gewandtheit und Mordlust mögen sie also verschiedenem Kleingethier sehr furchtbar machen. Auch vor gleichgroßen Säugethieren, anderen Nagern z. B., bekunden sie keine Furcht. Der Eindringling in ihr Gehege wird zuerst berochen, dann gekratzt und gebissen, mindestens geneckt und, wenn er nicht sehr wehrhaft ist, sicherlich vertrieben. Entschiedener Muth darf ihnen also ebensowenig abgesprochen werden wie Raub- und Mordsucht. Die Thierchen sind aber so einnehmend, daß man die letztgenannten Eigenschaften über ihre sonstigen vergißt und sie demgemäß unbedenklich für die anziehendsten aller Nager erklärt.
Eine erwähnenswerthe Gruppe der Familie bilden die Backenhörnchen ( Tamias). Das Vorhandensein von Backentaschen, welche bis zum Hinterhaupte reichen, und die mehr oder weniger unterirdische Lebensweise stellen sie als Mittelglieder zwischen Hörnchen und Ziseln hin; doch stimmen sie mit ersteren mehr als mit letzteren überein. Ihr Gebiß ähnelt dem der Eichhörnchen, der vordere obere Backenzahn fehlt aber beständig. Die fünfzehigen Füße und die Beine sind kürzer als bei den Hörnchen; der dünn behaarte Schwanz ist etwas kürzer als der Körper, der Pelz kurz und nicht sehr weich, auf dem Rücken gewöhnlich durch scharfe Längsstreifen ausgezeichnet. Man kennt wenige Arten, welche Osteuropa, Sibirien und Nordamerika bewohnen.
Der Burunduk oder das gestreifte sibirische Backenhörnchen ( Tamias striatus, Sciurus striatus und uthensis) ist bedeutend kleiner, aber plumper gebaut als das gemeine Eichhorn,
ohne den 10 Centim. messenden Schwanz 15 Centim. lang, und am Widerriste nicht über 5 Centim. hoch. Der längliche Kopf hat eine wenig vorstehende, rundliche und fein behaarte Nase, große, schwarze Augen und kurze, kleine Ohren; die Gliedmaßen sind ziemlich stark, die Sohlen nackt; die Daumenwarze der Vorderfüße ist mit einem kleinen Hornplättchen an der Stelle des Nagels bedeckt, der auf der Haut geringelte Schwanz ringsum schwach buschig behaart. Feine, in fünf Reihen vertheilte Schnurren stehen auf der Oberlippe, einige Borstenhaare auf den Wangen und über den Augen. Die Färbung des kurzen, rauhen, dicht anliegenden Pelzes ist am Kopfe, Halse und den Leibesseiten gelblich, untermischt mit langen, weißspitzigen Haaren; über den Rücken verlaufen der Länge nach in ungleichen Zwischenräumen fünf schwarze Binden, deren mittelste die Rückgratslinie bezeichnet; die nächsten beiden ziehen sich von den Schultern zu den Hinterschenkeln und schließen ein blaßgelbes oder auch weißgelbliches Band zwischen sich ein. Die ganze Unterseite ist graulichweiß, der Schwanz oben schwärzlich, unten gelblich; die Schnurren sind schwarz, die Krallen braun.

Hacki oder amerikanisches Backenhörnchen ( Tamias Lysteri). [3/5] natürl. Größe.
Der amerikanische Vertreter des Burunduk, vom Mejikanischen Meerbusen über alle Vereinigte Staaten verbreitet, von den Amerikanern Hacki oder Chipmuck genannt ( Tamias Lysteri, T. americanus), ist ungefähr gleich groß, im Gesichte röthlichbraun, auf Stirn und Backen dunkler gesprenkelt, im Nacken aschgrau, hinterseits rothbraun, unterseits weißlich, ein Mittelrückenstreifen dunkelbraun gefärbt, ein schmaler schwarzer Augenstreifen oben und unten weiß, ein breiter weißer Seitenstreifen beiderseits schwarzbraun eingefaßt; das dunkelbraune Schwarzhaar hat graugelbe Wurzel und weißliche Spitze, sieht unterseits aber röthlich aus.
Ein großer Theil des nördlichen Asien und ein kleines Stück Osteuropas sind die Heimat des altweltlichen Backenhörnchens. Der Wohnkreis wird etwa von den Flüssen Dwina und Kama und östlich von dem Ochotzkischen Meerbusen und dem Golf von Anadyr begrenzt. In Sibirien dehnt sich das Verbreitungsgebiet, mit Ausschluß der dauromongolischen Hochsteppen, bis zum Amur. Der Burunduk, Dschirki der Sojoten und Burjäten, Morümki der Chinesen, lebt in Wäldern, und zwar ebensowohl im Schwarzwalde wie in Birkengehölzen, am häufigsten in Zirbelkieferbeständen. Unter den Wurzeln dieser Bäume legt er sich eine ziemlich kunstlose, einfache Höhle an, welche in gabelförmiger Theilung zu dem Neste und zu einer oder zwei bis drei seitwärts liegenden Vorrathskammern führt, durch einen langen, winkeligen Gang aber nach außen mündet. Selten sind die Baue tief, weil die Feuchtigkeit des Bodens dies nicht gestattet; doch liegt in kälteren Gegenden die Lagerstelle regelmäßig tiefer, als der Frost reicht. Die Nahrung beider Thiere besteht aus Pflanzensamen und Beeren, vorzugsweise aber aus Getreidekörnern und Nüssen, von denen sie für manchen Winter zehn bis fünfzehn Pfund in den Backentaschen nach Hause schleppen und in den Vorrathskammern aufbewahren. Im Burejagebirge sind es, laut Radde, die Eicheln und die Früchte der mandschurischen Linde, welche dem Burunduk als Lieblingsspeise dienen, und von denen er bisweilen so viel sammelt, daß noch im Frühlinge der nachbleibende Vorrath von Ebern und Bären aufgegraben und verzehrt wird. An dem unteren Schilka reinigt er für seinen Bedarf sehr sorgfältig die Zirbelnüsse und bringt ihrer zwei bis drei Pfund zusammen, ebenfalls nicht selten zum Nutzen des Bären. Am Baikalsee bewohnt er mit Vorliebe Waldungen, in deren Mitte kleine Aecker gelegen sind und das Getreide, welches diese liefern, im Halme gestapelt wird. Hiervon sammelt er oft eine erhebliche Menge von Aehren ein, nicht selten bis acht Pfund derselben, welche fünf bis sechs Pfund reines Korn geben. Genau ebenso verfährt der Hacki. Man sieht ihn im Spätsommer mit vollgepfropften Backentaschen höchst eilig dahinlaufen und glaubt die Befriedigung, welche der Reichthum gewährt, ihm geradezu an den Augen absehen zu können. Nach den verschiedenen Monaten schleppt er seine mannigfaltigen Vorräthe zusammen, am meisten Buchweizen, Haselnüsse, Ahornkörner und Mais. Beide Thiere halten Winterschlaf, doch bloß einen sehr unterbrochenen, scheinen auch während des ganzen Winters der Nahrung bedürftig zu sein. Audubon, welcher im Januar einen der Baue ausgrub, fand in der Tiefe von anderthalb Meter ein großes Nest aus Blättern und Gras, in welchem drei Hackis verborgen lagen; andere schienen sich in die Seitengänge geflüchtet zu haben, als ihnen die Gräber nahe gekommen waren. Die Thiere waren zwar schlaftrunken und nicht gerade sehr lebendig, schliefen aber keineswegs nach Art unserer Winterschläfer, sondern bissen tüchtig um sich, als der Naturforscher sie ergreifen wollte. Der Hacki legt sich nicht vor dem November, der Burunduk im südlichen Sibirien zu derselben Zeit, in Mittelsibirien dagegen, wo die Fröste zeitig einsetzen, spätestens Mitte Oktobers zur Winterruhe nieder. Beide verlassen ihre unterirdischen Baue während des Winters nicht, halten aber einen Gang offen, auch bei eintretendem Thauwetter, bei welchem man wenigstens den Burunduk eifrig beschäftigt sieht, den Eingang zu seiner Höhle vor dem eindringenden Schneewasser zu schützen und sonst zu reinigen. Mit der Schneeschmelze beginnen beide ihr Leben auf der Oberfläche des Bodens. Die Jungen werden im Mai geboren; ein zweites Gehecke findet man gewöhnlich im August. Der Paarung gehen sehr heftige Kämpfe unter den betreffenden Männchen voraus: man versichert, daß es schwerlich ein rauflustigeres Thierchen geben könne, als diese kleinen aber ungemein regsamen Thiere. Besonders lebhaft sind die Backenhörnchen wenige Wochen bevor sie sich legen. Man vernimmt dann häufiger als je ihren vollen, an das klagende Geschrei der Zwergohreule erinnernden Ruf und sieht sie selbst in eifriger Bewegung. Was ihnen an Kletterfertigkeit abgeht, ersetzen sie durch erstaunliche Behendigkeit im Laufen. Wie Zaunkönige huschen sie zwischen und unter den Büschen dahin, blitzschnell bald geradeaus laufend, bald eine Richtung in eine andere verändernd.
Dem Landwirte sind die Backenhörnchen durchaus nicht willkommen. Sie gehen nach Mäuseart in die Scheunen und richten, wenn sie in großer Menge auftreten, arge Verwüstungen an. Höchstens einzelnen Menschen nützen sie, wie bei uns zu Lande der Hamster, durch das Füllen ihrer Speicher, welche man ausbeutet. Die Sibirier verwerthen auch die Bälge und senden sie nach China, wo man die Felle hauptsächlich zu Verbrämungen wärmerer Pelze benutzt und tausend Stück gern mit acht bis zehn Rubeln bezahlt. Der Hacki wird eifriger verfolgt als sein Bruder in Sibirien. Ein ganzes Heer von Feinden stellt ihm nach. Die Buben üben sich an dem » Chipmuck«, in dem edlen Weidwerk, und jagen ihn mit weit größerem Eifer als die Knaben der Jakuten den Burunduk, welchem letztere während der Ranzzeit hinter Bäumen auflauern und ihn herbeirufen, indem sie vermittels eines Pfeifchens aus Birkenrinde den Lockton des Weibchens nachahmen. Das Thier hat aber noch schlimmere Feinde. Wiesel verfolgen es auf und unter der Erde, Beutelratten streben ihm eifrig nach, Hauskatzen erklären es für eine ebenso gute Beute als Ratten und Mäuse, und alle größeren Raubvögel nehmen es vom Boden weg, wo sie nur können. Ein amerikanischer Rauchfußbussard ( archibuteo ferrugineus) gilt als sein eifriger Verfolger und heißt deshalb geradezu »Eichhornfalke« ( Squirrel-Hawk). Auch die Klapperschlange folgt, nach Geyers Beobachtungen, dem armen Schelme, und zwar mit ebenso großer Ausdauer als Schnelligkeit. »Gewöhnlich«, erzählt dieser Gewährsmann, »hatte das Grundeichhorn alle Schlupfwinkel seines Baues aufgesucht: die Schlange folgte ihm zu allen Löchern hinein und heraus und überholte es, als es zuletzt, das Weite suchend, unglücklicherweise einen Abhang hinabrannte, ergriff es und schoß rasselnd, ohne in ihrer Schnelligkeit zu stocken, mit ihrem Opfer in ein nahes Dickicht.« Der Winter vermindert die während des Sommers erzeugte, bedeutende Nachkommenschaft der Backenhörnchen oft in unglaublicher Weise. Trotz alledem ist sie, in gesegneten Jahren wenigstens, überall außerordentlich häufig; die große Fruchtbarkeit des Weibchens ersetzt bald alle Verluste.
Die hübsche Färbung, die Zierlichkeit und Lebendigkeit der Bewegungen empfehlen die Backenhörnchen für die Gefangenschaft. Ganz zahm werden sie nicht, bleiben vielmehr immer furchtsam und bissig. Dazu kommt ihre Lust, alles zu zernagen. Sie üben dieses Vergnügen mit der Befähigung einer Ratte aus, lassen also so leicht nichts ganz im Käfige oder im Zimmer. Mit anderen ihrer Art vertragen sie sich nicht; zumal die Männchen beginnen oft Streit untereinander. Die Ernährung hat keine Schwierigkeiten, denn die einfachsten Körner und Früchte genügen zu ihrem Futter. Bei einigermaßen entsprechender Pflege halten sie mehrere Jahre in Gefangenschaft aus, schreiten hier auch leicht zur Fortpflanzung.
Ungleich häßlicher als alle vorhergehenden sind die Ziselhörnchen ( Spermosciurus oder Xerus) sehr garstige Nager, welche bloß dann anmuthig erscheinen, wenn man sie aus einiger Entfernung betrachtet. Ihr Leib ist gestreckt, der Kopf spitz, der zweizeilig behaarte Schwanz fast von der Länge des Körpers, die Ohren sind klein, die Beine verhältnismäßig sehr lang, die Füße mit starken, zusammengedrückten Krallen bewehrt. In doppelter Hinsicht merkwürdig ist die Behaarung: sie steht so spärlich auf dem Leibe, daß sie die Haut kaum deckt, und die sehr starren Haare sind an der Wurzel platt, von da an der Länge nach gefurcht und breit zugespitzt. Der ganze Pelz sieht aus, als wären bloß einzelne Haare auf den Balg geklebt.
Der Schilu der Abissinier ( Xerus rutilus, Sciurus rutilus und ocularis)wird im ganzen etwa 50 Centim. lang, wovon etwa 22 Centim. auf den Schwanz kommen. Die Färbung ist oben röthlichgelb, an den Seiten und unten licht, fast weißlich. Der zweizeilig behaarte Schwanz ist seitlich und am Ende weiß, in der Mitte roth, hier und da weiß gefleckt, weil viele seiner Haare in weiße Spitzen enden. Dasselbe ist auch bei den Rückenhaaren der Fall. In den Steppenländern kommt eine andere Art, die Sabera der Araber ( Xerus leucoumbrinus), und zwar sehr häufig vor, während der Schilu immer nur einzeln auftritt.
Beide Thiere ähneln sich in ihrem Leben vollständig. Sie bewohnen dürre Steppenwaldungen, die waldlose Ebene selbst, gebirgige, hügelige Gegenden mit spärlichem Pflanzenwuchse und andere ähnliche Orte, graben sich geschickt und rasch unter dichten Büschen, zwischen dem Gewurzel der Bäume und unter größeren Felsblöcken tiefe und künstliche Baue und streifen von diesen aus bei Tage umher. Wie Rüpell angibt, klettern sie auch im niederen Gebüsch herum; bei Gefahr flüchten sie aber schleunigst wieder nach ihren unterirdischen Schlupfwinkeln. Man sieht sie bei Tage einzeln oder paarweise umherstreichen, auch in unmittelbarer Nähe der Dörfer, und wenn man sie aufscheucht, nach einem ihrer Baue flüchten. Wo die Gegend nicht felsig ist, graben sie sich unter starken Bäumen Röhren von großer Ausdehnung, wenigstens muß man dies aus den hohen Haufen schließen, welche vor ihren Fluchtröhren aufgeworfen werden. Die Baue näher zu untersuchen, hat seine Schwierigkeit, weil sie regelmäßig zwischen dem Wurzelwerke der Bäume verlaufen. Wurde die Wohnung unter Felsblöcken angelegt, so ist es nicht besser; denn das Ziselhörnchen hat sich sicher den unzugänglichsten Platz ausgesucht.

Schilu ( Xerus rutilus). ¼ natürl. Größe.
Im Dorfe Mensa hatte sich ein Pärchen des Schilu die Kirche und den Friedhof zu seinen Wohnsitzen erkoren, und trieb sich lustig und furchtlos vor aller Augen umher. Die hohen Kegel, welche man über den Gräbern aufthürmt und mit blendendweißen Quarzstücken belegt, mochten ihm passende Zufluchtsorte bieten; denn das eine oder das andere Mitglied des Pärchens verschwand hier oft vor unseren Augen. Allerliebst sah es aus, wenn eines der Thiere auf die Spitze eines jener Grabhügel sich setzte und die bezeichnende Stellung unseres Eichhörnchens annahm. Ich habe den Schilu wie die Sabera nur auf dem Boden bemerkt, niemals auf Bäumen oder Sträuchern. Hier zeigt er sich ebenso gewandt wie unser Eichhörnchen in seinem Wohngebiete. Der Gang ist leicht und wegen der hohen Läufe ziemlich schnell; doch gehen beide mehr schrittweise als die wahren Eichhörnchen. In ihrem Wesen beurkunden sie viel Leben und Rastlosigkeit. Jede Ritze, jedes Loch wird geprüft, untersucht und womöglich durchkrochen. Die hellen Augen sind ohne Unterlaß in Bewegung, um irgend etwas Genießbares auszuspähen. Knospen und Blätter scheinen die Hauptnahrung zu bilden; aber auch kleine Vögel, Eier und Kerbthiere werden nicht verschmäht. Selbst unter den Nagern dürfte es wenig bissigere Thiere geben, als die Ziselhörnchen es sind. Streitlustig sieht man sie umherschauen, angegriffen, muthvoll sich vertheidigen. Angeschossene oder gefangene beißen fürchterlich. Sie werden auch nach längerer Haft niemals zahm, sondern bethätigen beständig namenlose Wuth und beißen grimmig nach jedem, welcher ihnen sich nähert. Guter Behandlung scheinen sie vollkommen unzugänglich zu sein: kurz, ihr geistiges Wesen steht entschieden auf niederer Stufe. Ein Schilu, welchen ich über Jahr und Tag pflegte, blieb derselbe vom Anfang bis zum Ende. Gefürchtet von jedem Wärter, wurde er uns zur Last. Außer seinem hurtigen Betragen zeigte er nichts Anziehendes. Mit Eintritt des Winters wurde er traurig, und eines Morgens fanden wir ihn erstarrt und regungslos; doch brachte ihn Wärme wieder zu sich, und er lebte sodann noch mehrere Monate.
Ueber die Fortpflanzung habe ich nichts genaues erfahren können. Ich sah nur ein Mal eine Familie von vier Stück und vermuthe deshalb, daß die Ziselhörnchen bloß zwei Junge werfen. Hiermit steht die gleiche Zitzenzahl des Weibchens im Einklange.
Ihr Hauptfeind ist der Schopfadler ( Spizaëtos occipitalis), ein ebenso kühner als gefährlicher Räuber jener Gegenden; dagegen scheinen sie mit dem Singhabicht ( Melierax polyzonus) im besten Einverständnisse zu leben; wenigstens sieht man sie unter Bäumen, auf denen dieser Raubvogel sitzt, unbesorgt sich umhertreiben. Unter den Säugethieren stellen ihnen die großen Windhunde am eifrigsten nach. Die Mohammedaner und christlichen Bewohner Innerafrikas lassen sie unbehelligt, weil sie dieselben für unrein in Glaubenssachen erkennen; die freien Neger dagegen sollen das wahrscheinlich nicht unschmackhafte Fleisch genießen.
Die Murmelthiere ( Arctomina), welche die zweite Unterfamilie bilden, unterscheiden sich von den Hörnchen im engeren Sinne durch den plumperen, gedrungeneren Leib, den kurzen Schwanz und das Gebiß, dessen oberer Backenzahn zwar kleiner, jedoch ebenso lang ist als die folgenden, welche nach außen breit abgerundet, innen stark verschmälert und mit scharfen, erhöhten Leisten besetzt sind.
Man findet die Murmelthiere in Mitteleuropa, Nordasien und Nordamerika in ziemlich bedeutender Artenmenge verbreitet. Die meisten von ihnen bewohnen das Flachland, einige dagegen gerade die höchsten Gebirge ihrer bezüglichen Heimatsländer. Trockene, lehmige, sandige oder steinige Gegenden, grasreiche Ebenen und Steppen, Felder und Gärten bilden die Aufenthaltsorte, und nur die Gebirgsmurmelthiere ziehen die Triften und Weiden über der Grenze des Holzwuchses oder die einzelnen Schluchten und Felsthäler zwischen der Schneegrenze und dem Holzwuchse jenen Ebenen vor. Alle Arten haben feste Wohnsitze und wandern nicht. Sie legen sich tiefe, unterirdische Baue an und leben hier in Gesellschaften, oft in erstaunlich großer Anzahl, bei einander. Manche haben, je nach der Jahreszeit oder den jeweiligen Geschäften, welche sie verrichten, mehr als einen Bau, andere halten sich jahraus jahrein in derselben Höhlung auf. Sie sind Bodenthiere, immer noch lebhaft und schnell in ihren Bewegungen, jedoch weit langsamer als die Hörnchen; einige Arten erscheinen geradezu schwerfällig. Gras, Kräuter, zarte Triebe, junge Pflanzen, Sämereien, Feldfrüchte, Beeren, Wurzeln, Knollen und Zwiebeln bilden ihre Nahrung, und nur die wenigen, welche sich mühsam auf Bäume und Sträucher hinaufhaspeln, fressen junge Baumblätter und Knospen. Wahrscheinlich nehmen auch sie neben der Pflanzennahrung thierische zu sich, wenn ihnen dieselbe in den Wurf kommt, fangen Kerbthiere, kleine Säugethiere, tölpische Vögel und plündern deren Nester aus. Manche werden den Getreidefeldern und Gärten schädlich; doch ist der Nachtheil, welchen sie unserem Besitzstande zufügen, nicht von Belang. Beim Fressen sitzen sie wie die Hörnchen auf dem Hintertheile und bringen das Futter mit den Vorderpfoten zum Munde. Mit der Fruchtreife beginnen sie, Schätze einzusammeln, und füllen sich, je nach der Oertlichkeit, besondere Räumlichkeiten ihrer Baue mit Gräsern, Blättern, Sämereien und Körnern an. Gegen den Winter hin vergraben sie sich in ihren Bau und verfallen in einen ununterbrochenen und tiefen Winterschlaf, welcher ihre Lebensthätigkeit auf das allergeringste Maß herabstimmt.
Ihre Stimme besteht in einem stärkeren oder schwächeren Pfeifen und einer Art von Murren, welches, wenn es leise ist, Behaglichkeit ausdrückt, sonst aber auch ihren Zorn bekundet. Unter ihren Sinnen sind Gefühl und Gesicht am meisten ausgebildet; namentlich zeigen auch sie ein sehr feines Vorgefühl der kommenden Witterung und treffen danach ihre Vorkehrungen. Hinsichtlich ihrer geistigen Fähigkeiten übertreffen sie durchschnittlich die Hörnchen. Höchst aufmerksam, vorsichtig und wachsam, scheu und furchtsam, stellen viele von ihnen besondere Wachen aus, um die Sicherheit der Gesellschaft zu erhöhen, und flüchten sich beim geringsten Verdachte einer nahenden Gefahr schleunigst nach ihren unterirdischen Verstecken. Nur höchst wenige wagen es, einem herankommenden Feinde Trotz zu bieten, die große Mehrzahl setzt sich, ungeachtet ihres tüchtigen Gebisses, niemals zur Wehre, und deshalb sagt man von ihnen, daß sie gutmüthig und sanft, friedlich und harmlos seien. Ihr Verstand bekundet sich darin, daß sie sich leicht bis zu einem ziemlich hohen Grade zähmen lassen. Die meisten lernen ihren Pfleger kennen und werden sehr zutraulich, einige zeigen sich sogar folgsam, gelehrig und erlernen mancherlei Kunststückchen.
Ihre Vermehrung ist stark. Sie werfen allerdings durchschnittlich nur einmal im Jahre, aber drei bis zehn Junge, und diese sind schon im nächsten Frühjahre fortpflanzungsfähig.
Man benutzt von einigen das Fell und ißt von den anderen das Fleisch, hält sie auch gern als artige Hausgenossen: weiteren Nutzen bringen sie nicht.
Zisel ( Spermophilus) heißen die kleinsten Arten der Unterfamilie, schmucke Thierchen mit verhältnismäßig schlankem Leibe, gestrecktem Kopfe, im Pelze versteckten Ohren, kurzem, nur an den Endhälften zweizeilig buschig behaartem Schwanze, vier Zehen und einer kurzen Daumenwarze an den Vorder-, fünf Zehen an den Hinterfüßen sowie großen Backentaschen. Im oberen Kiefer finden sich fünf, im unteren vier Backenzähne; der erste obere Backenzahn oft etwa halb so groß als die übrigen und mit einer hohen, scharfkantigen Querleiste besetzt.
Die zahlreichen Arten dieser Sippe, welche sämmtlich der nördlichen Erdhälfte angehören, wohnen auf offenen und buschigen Ebenen, einige gesellig, andere einzeln in selbstgegrabenen Höhlen und nähren sich von verschiedenen Körnern, Beeren, zarten Kräutern und Wurzeln, verschmähen jedoch auch Mäuse und kleine Vögel nicht. Unsere heimische Art gibt ein treues Bild der übrigen.
Der Zisel ( Spermophilus Citillus, Mus und Marmota Citillus, Spermophilus undulatus), ein niedliches Thierchen, fast von Hamstergröße, aber mit viel schlankerem Leibe und hübscherem Köpfchen, 22 bis 24 Centim. lang und mit 7 Centim. langem Schwanze, am Widerrist etwa 9 Centim. hoch und ungefähr ein Pfund schwer, trägt einen lockeren, aus ziemlich straffen, in der Mitte dunkler geringelten Haaren bestehenden Pelz, welcher auf der Oberseite gelbgrau, unregelmäßig mit Rostgelb gewellt und fein gefleckt, auf der Unterseite rostgelb, am Kinne und Vorderhalse weiß aussieht. Stirn und Scheitel sind röthlichgelb und braun gemischt, die Augenkreise licht, die Füße rostgelb, gegen die Zehen hin heller, die Krallen und die Schnurren schwarz, die oberen Vorderzähne gelblich, die unteren weißlich. Das Wollhaar der Oberseite ist schwarzgrau, das der Unterseite heller bräunlichgrau, das des Vorderhalses einfarbig weiß. Die Nasenkuppe ist schwärzlich, das ziemlich große Auge hat schwarzbraunen Stern. Neugeborene Junge sind lichter, die bereits herumlaufenden auf dunklerem Grunde schärfer und gröber gefleckt als die Alten. Mancherlei Abänderungen der Färbung kommen vor; am hübschesten dürfte die Spielart sein, bei welcher die braunen Wellen des Rückens durch eine große Anzahl kleiner rundlicher Flecken von weißlicher Färbung unterbrochen werden.
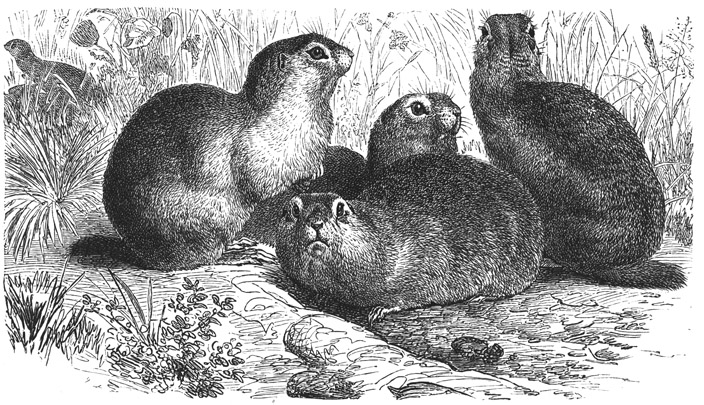
Zisel ( Spermophilus Citillus). ⅓ natürl. Größe.
Der Zisel findet sich hauptsächlich im Osten Europas. Albertus Magnus hat ihn in der Nähe von Regensburg beobachtet, wo er jetzt nicht mehr vorkommt, während er neuerdings in Schlesien immer weiter in westlicher Richtung sich verbreitet. Vor etwa vierzig Jahren kannte man ihn dort nicht, seit dreißig Jahren aber ist er schon im westlichen Theile der Provinz, und zwar im Regierungsbezirke Liegnitz, eingewandert und streift von hier aus immer weiter westlich. Wie es scheint, hat er von allen verwandten Arten die größte Verbreitung. Man kennt ihn mit Sicherheit als Bewohner des südlichen und gemäßigten Rußland, von Galizien, Schlesien und Ungarn, Steiermark, Mähren und Böhmen, Kärnten, Kram und der oberhalb des Schwarzen Meeres gelegenen russischen Provinzen. Daß er in Rußland häufiger auftritt als bei uns, geht aus seinem Namen hervor; denn dieser ist russischen Ursprungs und lautet eigentlich »Suslik«, im Polnischen »Susel«, im Böhmischen »Sisel«. Die Alten nannten ihn »pontische Maus« oder »Simor«. An den meisten Orten, wo sich der Zisel findet, kommt er auch häufig vor und fügt unter Umständen dem Ackerbau merklichen Schaden zu. Trockene, baumleere Gegenden bilden seinen Aufenthalt; vor allem liebt er einen bindenden Sand- oder Lehmboden, also hauptsächlich Ackerfelder und weite Grasflächen. Neuerdings hat er sich, laut Herklotz, besonders den Eisenbahnen zugewendet, deren aufgeworfene Dämme ihm das Graben erleichtern und vor Regengüssen einen gewissen Schutz gewähren. Doch scheut er auch unter sonst günstigen Lebensbedingungen einen festen Boden nicht und zerlöchert diesen unter Umständen so, daß hier und da fast Röhre an Röhre nach außen mündet. Er lebt stets gesellig, aber jeder einzelne gräbt sich seinen eigenen Bau in die Erde, das Männchen einen flacheren, das Weibchen einen tieferen. Der Kessel liegt 1 bis 1 ½ Meter unter der Oberfläche des Bodens, ist von länglichrunder Gestalt, hat ungefähr 30 Centim. Durchmesser und wird mit trockenem Grase ausgefüttert. Nach oben führt immer nur ein einziger, ziemlich enger und in mancherlei Krümmungen oft sehr flach unter der Erdoberfläche hinlaufender Gang, vor dessen Mündung ein kleiner Haufen ausgeworfener Erde liegt. Der Gang wird nur ein Jahr lang benutzt; denn sobald es im Herbste anfängt kalt zu werden, verstopft der Zisel die Zugangsöffnung, gräbt sich aber vom Lagerplatze aus eine neue Röhre bis dicht unter die Oberfläche, welche dann im Frühjahre, sobald der Winterschlaf vorüber, geöffnet und für das laufende Jahr als Zugang benutzt wird. Die Anzahl der verschiedenen Gänge gibt also genau das Alter der Wohnung an, nicht aber auch das Alter des in ihr wohnenden Thieres, weil nicht selten ein anderer Zisel die noch brauchbare Wohnung eines seiner Vorgänger benutzt, falls dieser durch irgend einen Zufall zu Grunde ging. Nebenhöhlen im Baue dienen zur Aufspeicherung der Wintervorräthe, welche im Herbste eingetragen werden. Der Bau, in welchem das Weibchen im Frühjahre, gewöhnlich im April oder Mai, seine drei bis acht nackten und blinden, anfangs ziemlich unförmlichen Jungen wirft, ist immer tiefer als alle übrigen, um den zärtlich geliebten Kleinen hinlänglichen Schutz zu gewähren. »Bewohnte Baue«, schreibt mir Herklotz, lassen sich sofort durch den Geruch erkennen; denn der Zisel verabsäumt selten, vor dem Einfahren seinen Harn zu lassen, und dieser hat einen so unangenehm stechenden Geruch, daß man sich selten täuschen kann.
»Auffallend ist die Sucht des Thieres, allerlei glänzende Dinge, Porzellanscherben, Glas- und Eisenstückchen z. B., in seinen Bau zu schleppen. Auch an Gefangenen bemerkt man diese Gewohnheit: sie suchen kleinere Porzellangefäße mit Zähnen und Pfötchen zu bewältigen und unter ihrem Heulager zu verstecken.
»Der Zisel besitzt eine Fertigkeit im Graben, welche geradezu in Erstaunen setzen und Uneingeweihten vollkommen unglaublich scheinen muß. Ich hatte einmal in meinem Zimmer, und zwar in einem aus Holz und Draht gefertigten Behälter, vier Zisel untergebracht, welche in kürzester Zeit sich durch Zernagen des Holzes frei zu machen wußten und zunächst in Stube und Kammer ihr Wesen trieben. Drei von ihnen wurden bald wieder eingefangen, der vierte aber war verschwunden. Nach zwei Tagen sah ich hinter einem größeren Stuhle einen Haufen Ziegelsteinbrocken, Mörtel und Sand liegen und mußte zu meinem Verdrusse wahrnehmen, daß diese Dinge von dem Zisel herrührten, welcher sich ein tiefes Loch in die Mauer gearbeitet hatte. Alle Versuche, ihn herauszuziehen, waren vergeblich; er grub noch fünf Tage lang fort und hatte, wie sich durch Messung ergab, ein Loch von über zwei Meter Tiefe in die Ziegelmauer gegraben, als er wieder eingefangen wurde.
»Es kann keine angenehmere Unterhaltung gewähren, als in den Nachmittagsstunden eines Frühsommertages Zisel zu beobachten. Der Geruch hat zehn bis zwölf bewohnte Baue erkennen lassen, in deren Nähe wir uns lagern. Kaum zehn Minuten währt es, und in der Mündung einer Röhre erscheint ein äußerst liebliches Köpfchen, dessen klare Augen unbesorgt ins Grüne spähen; der übrige Leib folgt, unser Thierchen setzt sich auf, macht ein Männchen, vollendet seine Rundschau, fühlt sich sicher und geht an irgend welches Geschäft. Binnen wenigen Minuten ist gewiß die ganze Gesellschaft am Platze, und nunmehr hat das Auge volle Beschäftigung. Einige spielen, andere putzen sich, einige beknabbern eine Wurzel, andere treiben sonst etwas. Da streicht ein Raubvogel vorüber: ein gellender Pfiff, jeder rennt seinem Fallloche zu, stürzt sich kopfüber in dasselbe, und alles ist in den Röhren verschwunden. Doch nur geraume Zeit, und das alte Spiel beginnt von neuem.
»In seinen Bewegungen ist der Zisel ein kleines Murmelthier, kein Hörnchen. Er läuft huschend über den Boden dahin, in rascher Folge ein Bein um das andere fürder setzend, führt selten einen Sprung aus und klettert ungern, obschon nicht ganz ungeschickt, jedoch immer nur nach Art der Murmelthiere, nicht nach Art der Eichhörnchen. Auch seine Stellungen beim Sitzen, sein Männchenmachen und endlich seine Stimme, ein dem Locktone des Kernbeißers täuschend ähnlicher Pfiff, erinnern an jene, nicht an diese.
»Obgleich der Zisel sehr mißtrauisch und vorsichtig ist, gewöhnt er sich doch an öfter wiederkehrende Störungen, so daß diese ihn schließlich nicht im geringsten mehr belästigen. Auf einer ungarischen Bahn entdeckte ich am Ende einer im Schotter eingebetteten Schwelle eine in den Bahndamm eindringende Ziselröhre, welche mir durch den Geruch verrieth, daß sie bewohnt war. Um mich vollends zu überzeugen, legte ich mich auf die Lauer, und gar nicht lange, so erschien der Zisel. Eine halbe Stunde später brauste der Zug heran, der Zisel fuhr in seinen Bau, schaute mit halbem Leibe heraus, ließ ruhig den Zug über sich wegrasseln, kam sodann wieder heraus und trieb es wie vorher. Später stieß ich auf einen Ziselbau unter einer Weichenschwelle: hier kam zur Beunruhigung durch den Zug noch die, welche durch das Stellen der Weiche verursacht wurde, und gleichwohl ließ sich das Thier nicht stören.«
Zarte Kräuter und Wurzeln, z. B. Vogelwegetritt und Klee, Getreidearten, Hülsenfrüchte und allerhand Beeren und Gemüse bilden die gewöhnliche Nahrung des Zisels. Gegen den Herbst hin sammelt er sich von den genannten Stoffen Vorräthe ein, welche er hamsterartig in den Backentaschen nach Hause schleppt. Nebenbei wird der Zisel übrigens auch Mäusen und Vögeln, welche auf der Erde nisten, gefährlich; denn er raubt ihnen nicht bloß die Nester aus, sondern überfällt ebenso die Alten, wenn sie nicht vorsichtig sind, gibt ihnen ein paar Bisse, frißt ihnen das Gehirn aus und verzehrt sie dann vollends bis auf den Balg. Seine Nahrung hält er sehr zierlich zwischen den Vorderpfoten und frißt, in halb aufrechter Stellung auf dem Hintertheile sitzend. Nach dem Fressen putzt er sich die Schnauze und den Kopf und leckt und wäscht und kämmt sich sein Fell oben und unten. Wasser trinkt er nur wenig und gewöhnlich nach der Mahlzeit.
Der Schaden, welchen der Zisel durch seine Plündereien verursacht, wird nur dann fühlbar, wenn sich das Thier besonders stark vermehrt. Das Weibchen ist, wie alle Nager, äußerst fruchtbar und wirft in den Monaten April oder Mai nach fünfundzwanzig- bis dreißigtägiger Tragzeit auf dem weichen Lager seines tiefsten Kessels ein starkes Gehecke. Die Jungen werden zärtlich geliebt, gesäugt, gepflegt und noch, wenn sie bereits ziemlich groß sind und Ausflüge machen, bewacht und behütet. Ihr Wachsthum fördert schnell; nach Monatsfrist sind sie halbwüchsig, im Spätsommer kaum mehr von den Alten zu unterscheiden, im Herbste vollkommen ausgewachsen und im nächsten Frühjahre fortpflanzungsfähig. Bis gegen den Herbst hin wohnt die ganze Familie im Baue der Alten; dann aber gräbt sich jedes Junge eine besondere Höhle, trägt Wintervorräthe ein und lebt und treibt es wie seine Vorfahren. Wäre der lustigen Gesellschaft nicht ein ganzes Heer von Feinden auf dem Nacken, so würde ihre Vermehrung, obgleich sie immer noch weit hinter der Fruchtbarkeit der Ratten oder Mäuse zurückbleibt, bedeutend sein. Aber da sind Hermelin, Wiesel, Iltis und Steinmarder, Falken, Krähen, Reiher, Trappen, selbst Katzen, Rattenpinscher und andere der bekannten Nagervertilger, welche dem Zisel eifrig nachstellen. Der Großtrappe gehört, laut Herklotz, nicht allein zu den Feinden der Mäuse, sondern auch zu den ihrigen, verfolgt sie mit ebensoviel Eifer als Geschick, tödtet sie durch einen Hieb mit dem Schnabel und verzehrt sie mit Haut und Haar. Auch der Mensch wird zu ihrem Gegner, theils des Felles wegen, theils des wohlschmeckenden Fleisches halber, und jagt sie mittels Schlingen und Fallen, gräbt sie aus oder treibt sie durch eingegossenes Wasser aus der Höhle hervor u. s. w. So kommt es, daß der starken Vermehrung des Zisels auf hunderterlei Weise Einhalt gethan wird. Und der schlimmste Feind ist immer noch der Winter. Im Spätherbste hat das frischfröhliche Leben der Gesellschaft geendet; die Männchen haben ausgesorgt für die Sicherheit der Gesammtheit, welche nicht nur außerordentlich wohlbeleibt und fett geworden ist, sondern sich auch ihre Speicher tüchtig gefüllt hat. Jeder einzelne Zisel zieht sich in seinen Bau zurück, verstopft dessen Höhlen, gräbt einen neuen Gang und verfällt dann in Winterschlaf. Aber gar viele von den eingeschlafenen schlummern in den ewigen Schlaf hinüber, wenn naßkalte Witterung eintritt, welche die halberstarrten Thiere auch im Baue zu treffen weiß, indem die Nässe in das Innere der Wohnung dringt und mit der Kälte im Vereine rasch den Tod für die gemüthlichen Geschöpfe herbeiführt. Selbst Platzregen im Sommer tödten viele von ihnen.
Der Zisel ist nicht eben schwer zu fangen. Der Spaten bringt die Versteckten leicht an das Tageslicht, oder die tückisch vor den Eingang gestellte Falle kerkert sie beim Wiederherauskommen ein. Da benimmt sich nun der Zisel höchst liebenswürdig. Er ergibt sich gefaßt in sein Schicksal und befreundet sich merkwürdig schnell mit seinem neuen Gewaltherrn. Einige Tage genügen, einen Zisel an die Gesellschaft des Menschen zu gewöhnen. Junge Thiere werden schon nach wenigen Stunden zahm; bloß die alten Weibchen zeigen manchmal die Tücken der Nager und beißen tüchtig zu. Bei guter Behandlung erträgt der Zisel mehrere Jahre hindurch die Gefangenschaft, und nächst der Haselmaus ist er wohl eines der hübschesten Stubenthiere, welche man sich denken kann. Jeder Besitzer muß seine Freude haben an dem schmucken, gutmüthigen Geschöpfe, welches sich zierlich bewegt und bald Anhänglichkeit an den Wärter zeigt, wenn auch sein Verstand nicht eben bedeutend genannt werden kann. Ganz besonders empfiehlt den Zisel seine große Reinlichkeit. Die Art und Weise seines beständigen Putzens, Waschens und Kämmens gewährt dem Beobachter ungemeines Vergnügen. Mit Getreide, Obst und Brod erhält man den Gefangenen leicht, Fleisch verschmäht er auch nicht, und Milch ist ihm ein wahrer Leckerbissen. Wenn man ihn vorwiegend mit trockenen Stoffen füttert, wird auch sein sonst sehr unangenehmer Geruch nicht lästig. Nur eins darf man nie verabsäumen: ihn fest einzussperren. Gelang es ihm, durchzubrechen, so zernagt er alles, was ihm vorkommt, und kann in einer Nacht eine Zimmereinrichtung zerstören. Bemerkenswerth ist eine Beobachtung von Herklotz, daß der Zisel durch den Lockton des Kernbeißers sich täuschen läßt und diesem antwortet.
Außer den Sibiriern und Zigeunern essen bloß arme Leute das Fleisch des Ziesels, obgleich es nach den Erfahrungen von Herklotz vortrefflich, und zwar ungefähr wie Hühnerfleisch schmeckt. Auch das Fell findet nur eine geringe Benutzung zu Unterfutter, zu Verbrämungen oder zu Geld- und Tabaksbeuteln. Dagegen werden die Eingeweide als Heilmittel vielfach angewendet, selbstverständlich ohne den geringsten Erfolg.
Der in Nordamerika lebende Prairiehund ( Cynomys Ludovicianus, Spermophilus und Arctomys ludovicianus, Cynomys socialis und griseus, Arctomys latrans) verbindet gewissermaßen die Zisel mit den eigentlichen Murmelthieren, obwohl er streng genommen zu diesen gehört, ähnelt er letzteren jedoch mehr als ersteren, und unterscheidet sich von ihnen wesentlich nur durch das Gebiß, dessen erster oberer einwurzeliger Backenzahn fast eben so groß ist wie die übrigen sehr großen, sowie durch den kurzen und breiten Schädel. Der Leib ist gedrungen, der Kopf groß, der Schwanz sehr kurz, buschig, oben und an den Seiten gleichmäßig bebehaart; die Backentaschen sind verkümmert. Erwachsene Prairiehunde erreichen etwa 40 Centim. Gesammtlänge, wovon ungefähr 7 Centim. auf den Schwanz kommen. Die Färbung der Oberseite ist licht röthlichbraun, grau und schwärzlich gemischt, die der Unterseite schmutzigweiß, der kurze Schwanz an der Spitze braun gebändert.
Der Name »Prairiehund«, welcher mehr und mehr giltig geworden ist, stammt von den ersten Entdeckern, den alten kanadischen Trappern oder Pelzjägern her, welche unser Thierchen nach seiner bellenden Stimme benannten; in der äußern Gestalt würde auch die gröbste Vergleichung keine Aehnlichkeit mit dem Hunde gefunden haben. Seine ausgedehnten Ansiedelungen, welche man ihrer Größe wegen » Dörfer« nennt, finden sich regelmäßig auf etwas vertieften Wiesen, auf denen ein zierliches Gras (Sesleria dactyloides) einen wunderschönen Rasenteppich bildet und ihnen zugleich bequeme Nahrung gewährt. »Zu welcher unglaublichen Ausdehnung die Ansiedelungen dieser friedlichen Erdbewohner herangewachsen sind«, sagt Balduin Möllhausen, »davon kann man sich am besten überzeugen, wenn man ununterbrochen Tage lang zwischen kleinen Hügeln hinzieht, deren jeder eine Wohnung zweier oder mehrerer solcher Thiere bezeichnet. Die einzelnen Wohnungen sind gewöhnlich fünf bis sechs Meter voneinander entfernt, und jeder kleine Hügel, welcher sich vor dem Eingange derselben erhebt, mag aus einer guten Wagenladung Erde bestehen, die allmählich von den Bewohnern aus den unterirdischen Gängen ans Tageslicht befördert worden ist. Manche haben einen, andere dagegen zwei Eingänge. Ein festgetretener Pfad führt von einer Wohnung zur anderen, und es wird bei deren Anblick die Vermuthung rege, daß eine innige Freundschaft unter diesen lebhaften, kleinen Thierchen herrschen muß. Bei der Wahl einer Stelle zur Anlage ihrer Städte scheint ein kurzes, krauses Gras sie zu bestimmen, welches besonders auf höheren Ebenen gedeiht und nebst einer Wurzel die einzige Nahrung dieser Thierchen ausmacht. Sogar auf den Hochebenen von Neu-Mejiko, wo viele Meilen im Umkreise kein Tropfen Wasser zu finden ist, gibt es sehr bevölkerte Freistaaten dieser Art, und da in dortiger Gegend mehrere Monate hindurch kein Regen fällt, man auch, um Grundwasser zu erreichen, über 30 Meter in die Tiefe graben müßte, ist fast anzunehmen, daß die Prairiehunde keines Wassers bedürfen, sondern sich mit der Feuchtigkeit begnügen, welche zeitweise ein starker Thau auf den feinen Grashalmen zurückläßt. Daß diese Thierchen ihren Winterschlaf halten, ist wohl nicht zu bezweifeln, denn
das Gras um ihre Höhlen vertrocknet im Herbste gänzlich, und der Frost macht den Boden so hart, daß es unmöglich für sie sein würde, auf gewöhnlichem Wege Nahrung sich zu verschaffen. Wenn der Prairiehund die Annäherung seiner Schlafzeit fühlt, welches gewöhnlich in den letzten Tagen des Oktober geschieht, schließt er alle Ausgänge seiner Wohnung, um sich gegen die kalte Winterluft zu schützen, und übergibt sich dann dem Schlafe, um nicht eher wieder auf der Oberwelt zu erscheinen, als bis die warmen Frühlingstage ihn zu neuem, fröhlichen Leben erwecken. Den Aussagen der Indianer gemäß öffnet er manchmal bei noch kalter Witterung die Thüren seiner Behausung. Dies ist alsdann aber als sicheres Zeichen anzusehen, daß bald warme Tage zu erwarten sind.
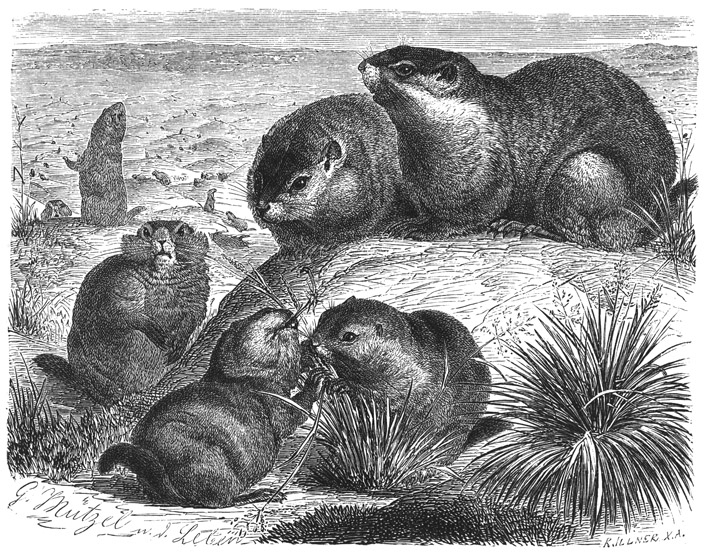
Prairiehund ( Cynomys Ludovicianus) 1/4 natürl. Größe.
»Einen merkwürdigen Anblick gewährt eine solche Ansiedelung, wenn es glückt, von den Wachen unbeachtet in ihre Nähe zu gelangen. So weit das Auge reicht, herrscht ein reges Leben und Treiben: fast auf jedem Hügel sitzt aufrecht, wie ein Eichhörnchen, das kleine gelbbraune Murmelthier; das aufwärts stehende Schwänzchen ist in immerwährender Bewegung, und zu einem förmlichen Summen vereinigen sich die feinen bellenden Stimmchen der vielen tausende. Nähert sich der Beschauer um einige Schritte, so vernimmt und unterscheidet er die tieferen Stimmen älterer und erfahrener Häupter; aber bald, wie durch Zauberschlag, ist alles Leben von der Oberfläche verschwunden. Nur hin und wieder ragt aus der Oeffnung einer Höhle der Kopf eines Kundschafters hervor, welcher durch anhaltend herausforderndes Bellen seine Angehörigen vor der gefährlichen Nähe eines Menschen warnt. Legt man sich alsdann nieder und beobachtet bewegungslos und geduldig die nächste Umgebung, so wird in kurzer Zeit der Wachtposten den Platz auf dem Hügel vor seiner Thür einnehmen und durch unausgesetztes Bellen seine Gefährten von dem Verschwinden der Gefahr in Kenntnis setzen. Er lockt dadurch einen nachdem anderen aus den dunklen Gängen auf die Oberfläche, wo alsbald das harmlose Treiben dieser geselligen Thiere von neuem beginnt. Ein älteres Mitglied von sehr gesetztem Aeußern stattet dann wohl einen Besuch bei dem Nachbar ab, welcher ihn auf seinem Hügel in aufrechter Stellung mit wedelndem Schwänzchen erwartet und dem Besucher an seiner Seite Platz macht. Beide scheinen nun durch abwechselndes Bellen gegenseitig gleichsam Gedanken und Gefühle sich mittheilen zu wollen; fortwährend eifrig sich unterhaltend, verschwinden sie in der Wohnung, erscheinen nach kurzem Verweilen wieder, um gemeinschaftlich eine Wanderung zu einem entfernter lebenden Verwandten anzutreten, welcher nach gastfreundlicher Aufnahme an dem Spaziergange Theil nimmt; sie begegnen anderen, kurze, aber laute Begrüßungen finden statt, die Gesellschaft trennt sich, und jeder schlägt die Richtung nach der eigenen Wohnung ein. Stunden lang könnte man, ohne zu ermüden, das immerwährend wechselnde Schauspiel betrachten, und es darf nicht wundern, wenn der Wunsch rege wird, die Sprache der Thiere zu verstehen, um sich unter sie mischen und ihre geheimen Unterhaltungen belauschen zu können.«
Es ist eine bemerkenswerthe, durch verschiedene Beobachter verbürgte Thatsache, daß die Baue der Prairiehunde von zwei schlimmen Feinden kleinerer Nager getheilt werden. Gar nicht selten sieht man Murmelthiere, Erdeulen und Klapperschlangen zu einem und demselben Loche ein- und ausziehen. Geyer meint, daß an ein friedliches Zusammenleben der drei verschiedenen Thiere nicht gedacht werden dürfe, und daß die Klapperschlange im Laufe der Zeit ein von ihr heimgesuchtes Prairiehundedorf veröden mache, weil sie alle rechtmäßigen Bewohner nach und nach aufzehre; er irrt sich jedoch in dieser Beziehung.
»Als ich«, schreibt mir mein trefflicher Freund Finsch, »im Oktober 1872 die Kansas-Pacific-Eisenbahn bereiste, wurde ich durch eigene Anschauung mit den Dörfern des Prairiehundes zuerst bekannt. Das Vorkommen des letztern ist, wie das des Bison und der Gabelantilope an jene ausgedehnten Hochebenen gebunden, welche, aller Bäume und Gesträuche baar, nur mit dem bezeichnenden Büffelgrase bedeckt sind und »Büffelprairien« heißen. Eine solche Prairie wird von der Kansas-Bahn, eine ebensolche von der Denver-Pacific-Bahn durchzogen. Hier wie dort gehören Prairiehunde zu den gewöhnlichen Erscheinungen; dagegen erinnere ich mich nicht, sie auf der Hochebene von Laramie gesehen zu haben, und auf der trostlosen, nur mit Artominien bestandenen Salzwüste zwischen dem Felsgebirge und der Sierra-Nevada fehlen sie bestimmt.
Möllhausen gibt eine treffliche Schilderung der Dörfer sowie der Lebensweise der Prairiehunde; doch bemerkte ich niemals Ansiedelungen von der Ausdehnung, wie sie von ihm gesehen wurden. Wie der Bison und die Antilope hat sich auch der Prairiehund an das Geräusch des vorübersausenden Eisenbahnzuges gewöhnt, und unbekümmert um dasselbe sieht man ihn bewegungslos auf seinem Baue sitzen, den Zug ebenso neugierig betrachtend, wie die Insassen ihn selbst. Der Anblick der Dörfer gewährt letzteren eine höchst erwünschte Abwechselung auf der an und für sich langweiligen Fahrt, und öfters, zu meinem stillen Behagen jedoch stets ohne Erfolg, wird sogar von der Plattform der Wagen aus nach diesen harmlosen Thierchen gefeuert. Oft nämlich befinden sich die Dörfer der Prairiehunde in nächster Nähe der Bahn, nur durch den Graben derselben von ihr getrennt, dann wiederum begegnet man auf weiten Strecken keinem einzigen Baue; denn nicht immer siedelt der Prairiehund in Dörfern sich an. Als wir in der ersten Hälfte des November von Kalifornien aus auf demselben Wege zurückkehrten, fanden wir die Prairiehunde in derselben Anzahl vor: die großen Brände, welche schon während unserer Hinreise wütheten, hatten ihnen nichts angethan. Auf gänzlich abgebrannten Stellen sah man sie über der Hauptröhre ihrer Hügel sitzen, und deutlich konnte man ihr unwilliges Kläffen vernehmen. Freilich mußte man sich durchaus ruhig verhalten; denn ein Griff nach dem Gewehre zog das augenblickliche Verschwinden der Thiere nach sich. Möllhausen hat vollständig Recht, wenn er ihre besondere Scheuheit hervorhebt.
»Was Geyer von der Vernichtung der Prairiehunde durch Klapperschlangen erzählt, steht im geraden Widerspruche mit dem, was ich im Westen erfuhr. Jeder, welcher mit der Prairie und
ihren Bewohnern vertraut ist, – und ich befragte mich bei sehr verschiedenen und durchaus glaubwürdigen Männern – weiß, daß Prairiehunde, Erd- oder Prairie-Eulen und Klapperschlangen friedlich in einem und demselben Baue beisammen leben. Ausstopfer im fernen Westen wählen das Kleeblatt mit Vorliebe als Vorwurf zu einer Thiergruppe, welche unter dem Namen: »die glückliche Familie« bei Ausländern nicht wenig Verwunderung erregt. Da ich in die Aussagen meiner Gewährsmänner nicht den leisesten Zweifel setze, stehe ich keinen Augenblick an, dieselben als wahr anzunehmen.«
»Furchtlos«, bemerkt Möllhausen noch, »sucht sich der Prairiehund seinen Weg zwischen den Hufen der wandernden Büffel hindurch; doch der Jäger im Hinterhalte braucht sich nur unvorsichtig zu bewegen – und scheu und furchtsam flieht alles hinab in dunkle Gänge. Ein leises Bellen, welches aus dem Schoße der Erde dumpf herauf klingt, sowie die Anzahl kleiner, verlassener Hügel verrathen dann allein noch den so reich bevölkerten Staat. Das Fleisch dieser Thiere ist schmackhaft, doch die Jagd auf dieselben so schwierig und so selten von Erfolg gekrönt, daß man kaum in anderer Absicht den Versuch macht, eins zu erlegen, als um die Neugierde zu befriedigen. Da der Prairiehund höchstens die Größe eines starken Eichhörnchens erreicht, so würden auch zu viele Stücke dazu gehören, um für eine kleine Gesellschaft ein ausreichendes Mahl zu beschaffen, und manches getödtete Thierchen rollt außerdem noch in die fast senkrechte Höhle tief hinab, ehe es gelingt, dasselbe zu erhaschen, oder wird, falls man nachstehender Erzählung Glauben schenken darf, rechtzeitig noch durch seine Genossen gerettet.«
»Ein nach Prairiemurmelthieren jagender Trapper«, erzählt Wood, »hatte glücklich einen der Wächter von dem Hügel vor seiner Wohnung herabgeschossen und getödtet. In diesem Augenblicke erschien ein Gefährte des Verwundeten, welcher bis dahin gefürchtet hatte, sich dem Feuer des Jägers auszusetzen, packte den Leib seines Freundes und schleppte ihn nach dem Innern der Höhle. Der Jäger war so ergriffen von der Kundgebung solcher Treue und Liebe des kleinen Geschöpfes, daß er es niemals wieder über sich bringen konnte, zur Jagd der Prairiehunde auszuziehen.« Ein nur verwundeter, obschon tödtlich getroffener Prairiehund geht regelmäßig verloren, weil er sich noch nach seiner Höhle zu schleppen weiß und verschwindet. »Selbst solche«, bestätigt Finsch, »welche von uns mit der Kugel getroffen wurden, besaßen noch so viel Lebenskraft, um sich in ihre Höhlen hinabgleiten zu lassen. Eher gelingt es, derer habhaft zu werden, welche sich etwas weiter von ihren Röhren entfernt haben, und ebenso ist es, nach Aussage der Prairiejäger, leicht, sie auszuräuchern. Während des Baues der oben erwähnten Bahnen waren Prairiehunde bei den Arbeitern ein gewöhnliches und beliebtes Essen.«
Gefangene Prairiehunde dauern ebenso gut wie andere ihrer Familienverwandten in Gefangenschaft aus, unterscheiden sich auch im Betragen nicht erheblich von diesen. Bei ihnen gewährter freier Bewegung, zumal wenn man ihnen gestattet, nach eigenem Behagen einen Bau sich anzulegen, schreiten sie im Käfige dann und wann zur Fortpflanzung. Wir erhalten sie neuerdings nicht allzuselten lebend; gleichwohl sieht man sie nur ausnahmsweise einmal in einem Thiergarten: warum, weiß ich nicht zu sagen.
An die Prairiehunde schließen die Murmelthiere ( Arctomys) eng sich an; denn beider Unterschiede beschränken sich, wie bereits bemerkt, auf den Bau des Schädels und die Bildung des vorderen oberen Backenzahnes. Ersterer ist oben sehr platt und zwischen den Augenhöhlen eingesenkt, der erste obere einwurzelige Backenzahn auf seiner Oberfläche etwa halb so groß wie die übrigen. Gedrungenen Leib und kurzen Schwanz, Bau der Füße, kurze Ohren und kleine Augen sowie nur angedeutete Backentaschen haben Prairiehunde und Murmelthiere miteinander gemein.
Was der Prairiehund in der neuen, ist der Bobak ( Arctomys Bobac, Mus arctomys) in der alten Welt: ein Bewohner der Ebenen. Die Leibeslänge des erst in neuerer Zeit von dem Alpenmurmelthiere unterschiedenen Bobak beträgt 37 Centim., die Schwanzlänge 9 Centim.; der ziemlich dichte Pelz ist fahl rostgelb, auf der Oberseite, infolge der Einmischung einzelner schwarzbrauner Haarspitzen, etwas dunkler, auf dem Scheitel, an der Schnauze, den Lippen und Mundwinkeln sowie in der Augengegend einfarbig bräunlich rostgelb, am Schwanze dunkel rostgelb, an der Schwanzspitze schwarzbraun, der Haargrund oben dunkel graubraun, unten heller braun, an Vorderhals und Kehle grauweißlich. Die Jungen sind trüber gefärbt als die Alten; aber auch unter diesen gibt es, nach Radde's Untersuchungen, mancherlei Spielarten.
Von dem südlichen Polen und Galizien an verbreitet sich der Bobak über ganz Südrußland und das südliche Sibirien bis zum Amur und nach Kaschmir. Er bewohnt nur Ebenen und steinige Hügelländer und meidet ebenso Waldungen wie sandige Stellen, welche ihm den Bau seiner tiefen Wohnungen nicht gestatten. Radde traf ihn auf geeigneten Oertlichkeiten Sibiriens überall häufig an, und Adams fand ihn in breiteren Thälern Kaschmirs noch in Höhen von zwei bis dreitausend Meter über dem Meere. Hier haust er in fruchtbaren Niederungen, in denen während des Sommers eine reichhaltige aber niedrigwachsende Pflanzenwelt den Boden deckt, dort sucht er die von Fruchterde entblößten Ebenen und Gehänge auf. Immer und überall lebt er in Gesellschaften von beträchtlicher Anzahl und drückt deshalb manchen Gegenden ein absonderliches Gepräge auf: unzählige Hügel, welche man in den Grassteppen Innerasiens bemerkt, verdanken ihre Entstehung vornehmlich diesen Murmelthieren, welche durch ihr munteres Leben den Reisenden ebenso zu fesseln wissen, wie sie, ihres Fleisches halber, für den Steppenbewohner und verschiedene Thiere bedeutungsvoll werden.
In allen Bobaksiedelungen herrscht während des Sommers ein ungemein reges und betriebsames Leben. Die bereits im April oder spätestens im Mai geborenen Jungen sind um diese Zeit halberwachsen und treiben es schon ganz wie die Alten, wenn sie auch deren Erfahrung noch nicht besitzen. Mit Sonnenaufgang verlassen sie mit den Alten den Bau, lecken gierig den Nachtthau, ihre einzige Labung in den meist wasserlosen Steppen, von den Blättern, fressen und spielen dann bis gegen Mittag lustig auf den vor ihren Höhlen aufgeworfenen Hügeln, verträumen den heißen Nachmittag auf wohlbereitetem Lager im Innern des Baues und erscheinen gegen Abend nochmals außerhalb des letzteren, um noch einen Imbiß für die Nacht zu nehmen. Ungern nur weiden sie die in unmittelbarer Nähe ihrer Röhrenmündungen wachsenden Kräuter ab, bilden sich vielmehr zwischen diesen schmale Pfade, welche sie bis zu ihrem oft vierzig und fünfzig Meter entfernt gelegenen Weidegebiete führen; ebenso ungern aber begeben sie sich auf Stellen, von denen aus sie nicht in kürzester Frist mindestens einen Nothbau erreichen können. So lange keinerlei Gefahr droht, geht es in der Siedelung fast genau in derselben Weise her wie in einem Dorfe der Prairiehunde, und ebenso verschwinden die Bobaks, sobald sie die Annäherung eines Wolfes, Hundes, Adlers oder Bartgeiers und bezüglich eines Menschen wahrnehmen, auf den bellenden, von vielen wiederholten Warnungsruf eines wachsamen Alten hin, augenblicklich, nach Art ihrer Verwandtschaft kopfüber in ihre Löcher sich stürzend. Im Juni beginnen sie mit dem Eintragen der Wintervorräthe, betreiben ihre Heu- und Wurzelernte jedoch noch lässig; später werden sie eifriger und fleißiger. Die zunehmende Kühle belästigt und verstimmt sie ungemein. Schon in der letzten Hälfte des August sieht man sie am Morgen nach einer kühlen Nacht taumelnden Ganges, wie im Schlafe, langsam von ihren Hügeln schleichen, und von ihrer Munterkeit ist fortan wenig mehr zu bemerken. In den Steppen Südostsibiriens ziehen sie sich ziemlich allgemein in der ersten Hälfte des September in ihre Winterbehausungen zurück, verstopfen den Eingang der Hauptröhre mit einem ungefähr meterdicken Pfropfen aus Steinen, Sand, Gras und ihrem eigenen Kothe und führen nunmehr bis zum Eintritte des Winters noch ein Halbleben in der Tiefe ihrer Wohnungen.
Die Baue haben, bei übereinstimmender äußerer Form, eine in sehr bedeutenden Grenzen schwankende innere Ausdehnung und sind in der Regel da am großartigsten, wo der Boden am härtesten ist. »Gewöhnlich«, beschreibt Radde, dessen Schilderung ich folge, »beträgt die Entfernung des Lagers von der Mündung des Ausganges fünf bis sieben, selten bis vierzehn Meter. Dieser Haupteingang theilt sich oft schon einen oder anderthalb Meter unter der Oberfläche der Erde gabelförmig in zwei bis drei Arme, deren jeder nicht selten nochmals sich spaltet. Die Nebenarme enden meistens blind und geben die Stoffe zum Verschließen des Haupteinganges her. Alle aber, welche nicht blind enden, führen zu der geräumigen Schlafstelle.« Das Nest, in welchem sie überwintern, ist ein anderes als jenes, in welchem sie zur Sommerzeit lagern. Die mit ihren Sitten sehr vertrauten heidnischen Jäger versichern, daß sie die gesammelten Grashalme, bevor sie dieselben zum Polstern des Winternestes verbrauchen, zwischen dem oberen Theile des Vorderfußes und der Bauchseite weichreiben, um ein möglichst behagliches Lager zu bekommen.
Innerhalb des sorgfältig verschlossenen Baues herrscht stets eine Wärme über dem Gefrierpunkte, die Tungusen sagen, eine solche wie in ihren Jurten. Anfänglich scheinen die Bobaks in ihrer Winterherberge noch ziemlich munter zu sein. Sie müssen von den eingetragenen Vorräthen fressen, denn sie erzeugen beträchtliche Kothhaufen; sie müssen auch ziemlich spät noch munter sein, weil weder der Tunguse noch der Iltis, welche beiden die Murmelthiere ausgraben, ihrer vor Eintritt des Winters habhaft werden können. Doch endlich fordert die kalte Jahreszeit ihr Recht: vom Dezember bis Ende Februars verfallen auch die Bobaks in todähnlichen Schlaf, und erst im März ermuntern sie sich wieder zu neuem Leben. Sie sind die ersten Winterschläfer, welche auferstehen. So wie sie meinen, daß der Frühling sich naht, graben sie den im vorigem Herbste verschlossenen Eingang ihrer unterirdischen Wohnung auf und kommen, feist wie sie vor dem Einwandern waren, wiederum an das Tageslicht, zuerst, noch von der Kälte unangenehm berührt, nur in den Mittagsstunden, angesichts der belebenden Sonne, später öfter und länger, bis sie es endlich wieder treiben wie früher.
Anfänglich geht es ihnen schlecht genug. Das von ihnen geschonte Gras auf und neben ihren Hügeln ist von den Kühen abgefressen worden, und sie finden einen öden, kaum aufgethauten Boden, auf welchem in der Nähe des Einganges zu ihrer Höhle nur die hohen, trockenen Brennnesselstämmchen, vom Winde ihrer verdorrten Blätter beraubt, und einige braune Rhabarberstengel ihnen zur Nahrung sich bieten. Sproßt das erste Gras hervor, so wird es noch nicht viel besser; denn der Genuß dieses Grases verursacht ihnen heftigen Durchfall. Kein Wunder daher, daß sie rasch abmagern, kaum auf den Beinen sich halten können und ihren vielen Feinden leichter als je und so lange bestimmt zur Beute werden, als der pflanzenspendende Mai ihnen nicht wieder zu vollen Kräften und der alten Lebenslust verholfen hat. Während ihrer Hungersnoth nimmt nicht allein der Adler einen und den andern Bobak weg, sondern auch der Wolf, welcher bis dahin den Herden folgte, findet es bequemer und minder gefährlich, der Murmelthierjagd obzuliegen, lauert, hinter den Hügeln versteckt, stundenlang auf das ihm sichere Wild, springt, wenn der infolge seines Elendes gleichgültiger gewordene Nager einige Schritte weit von dem sichern Baue sich entfernt hat, ihm nach, packt und zerreißt ihn und verzehrt ihn mit Haut und Haar.
Zu diesen natürlichen, keineswegs erschöpfend aufgezählten Feinden gesellt sich der Mensch. Um die Zeit des Erwachens oder ersten Erscheinens der Bobaks sattelt der jagdtreibende Tunguse oder Burjäte sein Pferd, ladet seine Büchse und zieht auf die Murmelthierjagd. »Nach langem Winter«, schildert Radde, »während dessen er selten Fleisch aß und sein Leben kümmerlich in kalter Jurte fristete, ist er begierig, sich einen Braten zu holen, welcher an Güte mit jedem Tage abnimmt. Er weiß aus jahrelanger Erfahrung, daß die Bobaks im Winter nichts von ihrem Fette verlieren und ihre Höhlen so feist verlassen, wie sie im Herbste in dieselben sich legten; aber er weiß auch, daß sie nach wenigen Tagen des Lebens im Freien magerer werden und bis zum Mai so elend aussehen, daß es sich nicht lohnt, sie zu tödten. Mit seiner Kugelbüchse legt er sich hinter die Anhöhe eines Murmelthierbaues und wartet mit Geduld, ohne sich zu regen. Ein alter Bobak, schon gewitzigt durch vorjährige Erfahrungen, guckt vorsichtig aus dem Loche, zieht den Kopf aber rasch wieder zurück. Der Tunguse hört nur den kurzen, dem Bellen des Hundes vergleichbaren Schrei des Thieres und bleibt, die auf der Gabel ruhende Büchse zum Abfeuern bereit, ruhig liegen. Nicht lange währt es, und der kurzgeschwänzte, gelbbraune Erdbewohner kriecht ganz hervor, erhebt sich und blickt um sich, setzt sich wieder nieder, schlägt den Schwanz einige Male aufwärts, bellt und läuft drei bis vier Schritte vom Eingange weg, um eine weitere Aussicht zu gewinnen. Eine Sekunde später kracht der Schuß, und der Bobak stürzt zusammen. Zunächst löst der Schütze der Beute die Eingeweide heraus: denn diese verderben den Geschmack; hierauf sucht er, falls er Hunger hat oder auf Reisen fern von seiner Jurte sich befindet, eiligst trockenen Mist zusammen, zündet ihn an, erhitzt einige Feldsteine in der Glut, schiebt dieselben sodann in den Bauch des Murmelthieres, legt dieses auf die Satteldecke und verzehrt es nach etwa zwei Stunden ohne alle Zuthaten mit dem besten Appetite. Doch das ist nur ein Nothgericht, besser wird die Beute in der Jurte zubereitet.
»Frau und Kinder erwarten den ausgezogenen Jäger schon lange. Sie haben seit gestern bloß den dünnen Aufguß eines Krautes getrunken und freuen sich alle auf das zähe Fleisch des Bobaks. Rasch werden die erlegten Beutestücke enthäutet, und während dem kommt in dem eisernen Kessel, aus welchem abends die Hunde fraßen, Wasser zum Sieden. Ernsthaft ertheilt der Jäger seinem die Felle abstreifendem Weibe die Ermahnung, das Menschenfleisch recht sorgsam vom Murmelthierfleische zu sondern, damit ersteres ja nicht mitgesotten und zum Aerger der Gottheit verzehrt werde. Dem verwundert ihn fragenden Fremdlinge aber erzählt er folgendes:
»Unter der Achsel des Murmelthieres findet man zwischen dem Fleische eine dünne, weißliche Masse, deren Genuß verboten wurde, da sie der Ueberrest des Menschen ist, welcher durch den Zorn des bösen Geistes zum Bobak verdammt wurde. Denn Du mußt wissen, daß alle Murmelthiere einst Menschen waren, von der Jagd lebten und ausgezeichnet schossen. Einst aber wurden sie übermüthig, prahlten, jedes Thier, selbst den Vogel im Fluge, mit dem ersten Schusse zu tödten und erzürnten dadurch den bösen Geist. Um sie zu strafen, trat dieser unter sie und befahl dem besten Schützen, eine fliegende Schwalbe mit der ersten Kugel herabzuschießen. Der dreiste Jäger lud und schoß; die Kugel riß der Schwalbe jedoch nur die Mitte des Schwanzes weg. Seit jener Zeit haben die Schwalben einen Gabelschwanz; die übermüthigen Jäger aber wurden zu Murmelthieren.«
»Inzwischen ist die Suppe fertig geworden. Das Fleisch wird zuerst und zwar ohne Brod und Salz verzehrt, in die Brühe aber Mehl geschüttet, zu einem dünnen Kleister zusammengequirlt und dieser sodann aus hölzernen Schalen getrunken.«
Oben auf den höchsten Steinhalden der Alpen, wo kein Baum, kein Strauch mehr wächst; wo kein Rind, kaum die Ziege und das Schaf mehr hinkommt, selbst auf den kleinen Felseninseln mitten zwischen den großen Gletschern, wo im Jahre höchstens sechs Wochen lang der Schnee vor den warmen Sonnenstrahlen schwindet: ist die Heimat eines schon seit alter Zeit wohlbekannten Mitgliedes der Familie, dessen Leben zwar in allen wesentlichen dem der bereits geschilderten Verwandten gleicht, infolge des Aufenthaltes aber doch auch wieder in mancher Hinsicht abweichendes zeigt. Die Römer nannten dieses Thier Alpenmaus, die Savoyarden nennen es Marmotta, die Engadiner Marmotella, die Deutschen, beide Namen umbildend, Murmelthier. In Bern heißt es Murmeli, in Wallis Murmentli und Mistbelleri, in Graubünden Marbetle oder Murbentle, in Glarus Munk.
Gegenwärtig ist uns Mitteldeutschen das Thier entfremdeter worden, als es früher war. Die armen Savoyardenknaben dürfen nicht mehr wandern, während sie vormals bis zu uns und noch weiter nördlich pilgerten mit ihrem zahmen Murmelthiere auf dem Rücken, um durch die einfachen Schaustellungen, welche sie mit ihrem Ein und Allem in Dörfern und Städten gaben, einige Pfennige zu verdienen. Dem Murmelthiere ist es ergangen wie dem Kamele, dem Affen und dem Bären: es hat aufgehört, die Freude der Kinder des Dörflers zu sein, und man muß jetzt schon weit wandern, bis in die Alpenthäler hinein, wenn man es noch lebend sehen will.
Das Alpenmurmelthier ( Arctomys Marmota, Mus Marmota, Marmota alpina), erreicht etwa 62 Centim. Gesammtlänge, oder 51 Centim. Leibes- und 11 Centim. Schwanzlänge, bei 15 Centim. Höhe. In Gestalt und Bau gleicht es seinen Verwandten. Die Behaarung, welche aus kürzerem Woll- und längerem Grannenhaar besteht, ist dicht, reichlich und ziemlich lang, ihre Färbung auf der Oberseite mehr oder weniger braunschwarz, auf Scheitel und Hinterkopf durch einige weißliche Punkte unterbrochen, da die einzelnen Grannenhaare hier schwarz und braun geringelt und weiß zugespitzt sind, im Nacken, an der Schwanzwurzel und der ganzen Unterseite dunkel röthlichbraun, an den Beinen, den Leibesseiten und Hinterbacken noch heller, an der Schnauze und an den Füßen rostgelblichweiß. Augen und Krallen sind schwarz, die Vorderzähne braungelb. Uebrigens kommen vollkommen schwarze oder weiße und perlartig weiß gefleckte Spielarten vor.

Alpenmurmelthier ( Arctomys Marmota). [1/6] natürl. Größe.
Die neueren Untersuchungen haben ergeben, daß das Murmelthier ausschließlich in Europa lebt. Das Hochgebirge der Alpen, Pyrenäen und Karpaten beherbergt es, und zwar bewohnt es die höchst gelegenen Stellen, die Matten dicht unter dem ewigen Eise und Schnee, geht überhaupt höchstens bis zum Holzgürtel herab. Zu seinem Aufenthalte wählt es freie Plätze, welche ringsum durch steile Felsenwände begrenzt werden, oder kleine enge Gebirgsschluchten zwischen einzelnen aufsteigenden Spitzen, am liebsten Orte, welche dem menschlichen Treiben so fern als möglich liegen. Je einsamer das Gebirge, um so häufiger wird es gefunden; da wo der Mensch schon mehr mit ihm verkehrt hat, ist es bereits ausgerottet. In der Regel wohnt es nur auf den nach Süden, Osten und Westen zu gelegenen Bergflächen und Anhängen, weil es, wie die meisten Tagthiere, die Sonnenstrahlen liebt. Hier hat es sich seine Höhlen gegraben, kleinere, einfachere, und tiefere, großartig angelegte, die einen für den Sommer bestimmt, die anderen für den Winter, jene zum Schutz gegen vorübergehende Gefahren oder Winterungseinflüsse, diese gegen den furchtbaren, strengen Winter, welcher da oben seine Herrschaft sechs, acht, ja zehn Monate lang festhält. Mindestens zwei Drittel des Jahres verschläft das merkwürdige Geschöpf, oft noch weit mehr; denn an den höchst gelegenen Stellen, wo es sich findet, währt sein Wachsein und Umhertreiben vor dem Baue kaum den sechsten Theil des Jahres.
Das Sommerleben ist, laut Tschudi, sehr kurzweilig. Mit Anbruch des Tages kommen zuerst die Alten aus der Röhre, strecken vorsichtig den Kopf heraus, spähen, horchen, wagen sich dann langsam ganz hervor, laufen etliche Schritte bergan, setzen sich auf die Hinterbeine und weiden hierauf eine Weile lang mit unglaublicher Schnelligkeit das kürzeste Gras ab. Bald darauf strecken auch die Jungen ihre Köpfe hervor, huschen heraus, weiden ein wenig, liegen Stunden lang in der Sonne, machen Männchen und spielen artig miteinander. Alle Augenblicke sehen sie sich um und bewachen mit der größten Aufmerksamkeit die Gegend. Das erste, welches etwas verdächtiges bemerkt, einen Raubvogel oder Fuchs oder Menschen, pfeift tief und laut durch die Nase, die übrigen wiederholen es theilweise, und im Nu sind alle verschwunden. Bei mehreren Thierchen hat man statt des Pfeifens ein lautes Kläffen gehört, woher wahrscheinlich der Name »Mistbelleri« kommt. Ob sie aber überhaupt eigentliche Wachen ausstellen, ist nicht entschieden. Ihre Kleinheit sichert sie mehr vor der Gefahr, bemerkt zu werden, und ihr Auge, besonders aber ihr Ohr und Geruch sind sehr scharf.
Während des Sommers wohnen die Murmelthiere einzeln oder paarweise in ihren eigenen Sommerwohnungen, zu denen ein bis vier Meter lange Gänge mit Seitengängen und Fluchtlöchern führen. Diese sind oft so enge, daß man kaum eine Faust glaubt durchzwängen zu können. Die losgegrabene Erde werfen sie nur zum kleinsten Theile hinaus; das meiste treten sie oder schlagen sie in den Gängen fest, welche dadurch hart und glatt werden. Die Ausgänge sind meist unter Steinen angebracht. In ihrer Nähe findet man oft eine ganze Anzahl kurzer, bloß zum Verstecken bestimmter Löcher und Röhren. Der Kessel ist wenig geräumig. Hier paaren sie sich, wahrscheinlich im April, und das Weibchen wirft nach sechs Wochen zwei bis vier Junge, welche sehr selten vor die Höhle kommen, bis sie etwas herangewachsen sind, und bis zum nächsten Sommer mit den Alten den Bau theilen.
Gegen den Herbst zu graben sie sich ihre weiter unten im Gebirge liegende Winterwohnung, welche jedoch selten tiefer als anderthalb Meter unter dem Rasen liegt. Sie ist immer niedriger im Gebirge gelegen als die Sommerwohnung, welche oft sogar 2600 Meter über dem Meere liegt, während die Winterwohnung (im Kanton Glarus »Schübene« genannt) in der Regel in dem Gürtel der obersten Alpenweiden, oft aber auch tief unter der Baumgrenze liegt. Diese nun ist für die ganze Familie, die aus fünf bis fünfzehn Stück besteht, berechnet und daher sehr geräumig. Der Jäger erkennt die bewohnte Winterhöhle sowohl an dem Heu, welches vor ihr zerstreut liegt, als auch an der gut mit Heu, Erde und Steinen von innen verstopften, aber bloß faustgroßen Mündung der Höhleneingänge, während die Röhren der Sommerwohnungen immer offen sind. Nimmt man den Baustoff aus der Röhrenmündung weg, so findet man zuerst einen aus Erde, Sand und Steinen wohlgemauerten, mehrere Fuß langen Eingang. Verfolgt man nun diesen sogenannten Zapfen einige Meter weit, so stößt man bald auf einen Scheideweg, von welchem aus zwei Gänge sich fortsetzen. Der eine, in dem sich gewöhnlich Losung und Haare befinden, führt nicht weit und hat wahrscheinlich den Baustoff zur Ausmauerung des Hauptganges geliefert. Dieser erhöht sich jetzt allmählich, und nun stößt der Jäger an seiner Mündung auf einen weiten Kessel, oft acht bis zehn Meter bergwärts, das geräumige Lager der Winterschläfer. Er bildet meist eine eirunde backofenförmige Höhle, mit kurzem, weichem, dürrem, gewöhnlich röthlichbraunem Heu angefüllt, welches zum Theile jährlich erneuert wird. Vom August an fangen nämlich diese klugen Thierchen an, Gras abzubeißen und zu trocknen und mit dem Maule zur Höhle zu schaffen und zwar so reichlich, daß es oft von einem Manne auf einmal nicht weggetragen werden kann. Man fabelte früher von dieser Heuernte sonderbare Sachen. Ein Murmelthier sollte sich auf den Rücken legen, mit Heu beladen lassen und so zur Höhle wie ein Schlitten gezogen werden. Zu dieser Erzählung veranlaßte die Erfahrung, daß man oft Murmelthiere findet, deren Rücken ganz abgerieben ist, was jedoch bloß vom Einschlüpfen in die engen Höhlengänge herrührt.
Außer diesen beiden Wohnungen hat das Murmelthier noch besondere Fluchtröhren, in welche es sich bei Gefahr versteckt, oder es eilt unter Steine und Felsenklüfte, wenn es seine Höhle nicht erreichen kann.
Die Bewegungen des Murmelthieres sind sonderbar. Der Gang namentlich ist ein höchst eigenthümliches, breitspuriges Watscheln, wobei der Bauch fast oder wirklich auf der Erde schleift. Eigentliche Sprünge habe ich die Murmelthiere, meine gefangenen wenigstens, niemals ausführen sehen: sie sind zu schwerfällig dazu. Höchst sonderbar sieht das Thier aus, wenn es einen Kegel macht; es sitzt dann kerzengerade auf dem Hintertheile, steif, wie ein Stock, den Schwanz senkrecht vom Leibe abgebogen, die Vorderarme schlaff herabhängend, und schaut aufmerksam in die Welt hinaus. Beim Graben arbeitet es langsam, gewöhnlich nur mit einer Pfote, bis es einen hübschen Haufen Erde losgekratzt hat; dann wirft es diese durch schnellende Bewegungen mit den Hinterfüßen weiter zurück, und endlich schiebt es sie mit dem Hintern vollends zur Höhle hinaus. Während des Grabens erscheint es häufig vor der Mündung seiner Röhre, um sich den Sand aus dem Felle zu schütteln; hierauf gräbt es eifrig weiter.
Frische und saftige Alpenpflanzen, Kräuter und Wurzeln bilden die Nahrung des Murmelthieres. Zu seiner Lieblingsweide gehören Schafgarbe, Bärenklau, Grindwurzel, Löwenmaul, Klee und Sternblumen, Alpenwegerich und Wasserfenchel, doch begnügt es sich auch mit dem grünen, ja selbst mit dem trockenen Grase, welches seinen Bau zunächst umgibt. Mit seinen scharfen Zähnen beißt es das kürzeste Gras schnell ab, erhebt es sich auf die Hinterbeine und hält die Nahrung mit den Vorderpfoten, bis es dieselbe gehörig zermalmt hat. Zur Tränke geht es selten; auch trinkt es viel auf einmal, schmatzt dabei und hebt nach jedem Schlucke den Kopf in die Höhe, wie die Hühner oder Gänse. Seine ängstliche Aufmerksamkeit während der Weide läßt es kaum einen Bissen in Ruhe genießen; fortwährend richtet es sich auf und schaut sich um, und niemals wagt es, einen Augenblick zu ruhen, bevor es sich nicht auf das sorgfältigste überzeugt hat, daß keine Gefahr droht.
Nach allen Beobachtungen scheint es festzustehen, daß das Alpenmurmelthier ein Vorgefühl für Witterungsveränderungen besitzt. Die Bergbewohner glauben steif und fest, daß es durch Pfeifen die Veränderungen des Wetters anzeigt, und sind überzeugt, daß am nächsten Tage Regen eintritt, wenn das Thier trotz des Sonnenscheins nicht auf dem Berge spielt.
Wie die meisten Schläfer, sind die Alpenmurmelthiere im Spätsommer und Herbst ungemein fett. Sobald nun der erste Frost eintritt, fressen sie nicht mehr, trinken aber noch viel und oft, entleeren sich sodann und beziehen nun familienweise die Winterwohnungen. Vor Beginn des Winterschlafes wird der enge Zugang zu dem geräumigen Kessel auf eine Strecke von ein bis zwei Meter, von innen aus mit Erde und Steinen, zwischen welche Lehm, Gras und Heu eingeschoben werden, geschickt und fest verstopft, so daß das Ganze einem Gemäuer gleicht, bei welchem das Gras gleichsam den Mörtel abgibt. Durch diese Vermauerung wird die äußere Luft abgeschlossen und im Innern durch die Ausstrahlung des Körpers selbst eine Wärme hergestellt, welche etwa 8 bis 9º R. beträgt. Der mit dürrem, rothen Heu ausgepolsterte und ringsum ausgefütterte Kessel bildet für die ganze Gesellschaft das gemeinsame Lager. Hier ruht die Familie dicht bei einander. Alle Lebensthätigkeit ist aufs äußerste herabgestimmt, jedes Thier liegt regungslos und kalt in todesähnlicher Erstarrung in der einmal eingenommenen Lage, keines bekundet Leben. Die Blutwärme ist herabgesunken auf die Wärme der Luft, welche in der Höhle sich findet, die Athemzüge erfolgen bloß fünfzehn Mal in der Stunde. Nimmt man ein Murmelthier im Winterschlafe aus seiner Höhle und bringt es in die Wärme, so zeigt sich erst bei 17 Graden das Athmen deutlicher, bei 20 Graden beginnt es zu schnarchen, bei 22 streckt es die Glieder, bei 25 Graden erwacht es, bewegt sich taumelnd hin und her, wird nach und nach munterer und beginnt endlich zu fressen. Im Frühjahre erscheinen die Murmelthiere in sehr abgemagertem Zustande vor der Oeffnung ihrer Winterwohnung, sehen sich sehnsüchtig nach etwas Genießbarem um, und müssen oft weit wandern, um an den Ecken und Kanten der Berge, da, wo der Wind den Schnee weggetrieben hat, etwas verdorrtes Gras aufzutreiben. Dieses überwinterte Gras dient ihnen im Anfange zur hauptsächlichsten Nahrung, bald aber sprossen die jungen, frischen, saftigen Alpenpflanzen und verschaffen ihnen wieder Kraft und Fülle.
Jagd und Fang des Murmelthieres haben mancherlei Schwierigkeiten. Der herannahende Jäger wird fast regelmäßig von irgend einem Gliede der Gesellschaft bemerkt und den übrigen durch helles Pfeifen angezeigt. Dann flüchten alle nach dem Baue, und erscheinen so bald nicht wieder; man muß also vor Sonnenaufgang zur Stelle sein, wenn man ein solches Wild erlegen will. Uebrigens werden die wenigsten Murmelthiere mit dem Feuergewehre erbeutet. Man stellt ihnen Fallen aller Art oder gräbt sie im Anfange des Winters aus. Schon in alten Zeiten wurde ihnen eifrig nachgestellt, und in der Neuzeit ist es nicht besser geworden. Die Fallen liefern, so einfach sie sind, immer guten Ertrag und vermindern die Murmelthiere um ein Beträchtliches; die Nachgrabungen im Winter rotten sie familienweise aus. Mit Recht ist deshalb in vielen Kantonen der Schweiz das Graben auf Murmelthiere verboten; denn dadurch würde in kurzer Zeit ihre vollständige Vernichtung herbeigeführt werden, während die einfache Jagd ihnen nie sehr gefährlich wird. Im Sommer ist Nachgraben erfolglos, weil die dann vollständig wachen Thiere viel schneller tiefer in den Berg hineingraben, als der Mensch ihnen nachkommen kann. Im äußersten Nothfalle vertheidigen sich die Murmelthiere mit Muth und Entschlossenheit gegen ihre Feinde, indem sie stark beißen oder auch ihre kräftigen Krallen anwenden. Wird eine Gesellschaft gar zu heftig verfolgt, so zieht sie aus und wandert, um sicher zu sein, von einem Berge zum anderen. Hier und da sind, wie Tschudi berichtet, die Bergbewohner vernünftig und bescheiden genug, ihre Fallen bloß für die alten Thiere einzurichten, so z. B. an der Gletscheralp im Walliser Saaßthale, wo die Thiere in größerer Menge vorhanden sind, weil die Jungen stets geschont werden. Dem Alpenbewohner ist das kleine Thier nicht allein der Nahrung wegen wichtig, sondern dient auch als Arzneimittel für allerlei Krankheiten. Das fette, äußerst wohlschmeckende Fleisch gilt als besonderes Stärkungsmittel für Wöchnerinnen; das Fett soll Schwangeren das Gebären erleichtern, Leibschneiden heilen, dem Husten abhelfen, Brustverhärtungen zertheilen; der frisch abgezogene Balg wird bei gichtischen Schmerzen angewandt, und dergleichen mehr. Frischem Fleische haftet ein so starker erdiger Wildgeschmack an, daß es dem an diese Speise nicht Gewöhnten Ekel verursacht; deshalb werden auch die frisch gefangenen Murmelthiere, nachdem sie wie ein Schwein gebrüht und geschabt worden sind, einige Tage in den Rauch gehängt und dann erst gekocht oder gebraten. Ein derart vorbereitetes Murmelthierwildpret gilt für sehr schmackhaft. Die Mönche im St. Galler Stift hatten schon um das Jahr 1000 einen eigenen Segensspruch für dieses Gericht: »Möge die Benediktion es fett machen!« In damaliger Zeit wurde das Thierchen in den Klöstern Cassus alpinus genannt, und gelehrte Leute beschäftigten sich mit seiner Beschreibung. Der Jesuit Kircher hielt es, nach Tschudi, für einen Blendling von Dachs und Eichhorn; Altmann aber verwahrt sich gegen solche Einbildungen und kennzeichnet das Murmelthier als einen kleinen Dachs, welcher mit den wahren, echten zu den Schweinen gehöre, erzählt auch, daß es vierzehn Tage vor dem Winterschlafe nichts mehr zu sich nehme, wohl aber viel Wasser trinke und dadurch seine Eingeweide ausspüle, damit sie über Winter nicht verfaulten!
Für die Gefangenschaft und Zähmung wählt man sich am liebsten die Jungen, obgleich es schwierig ist, diese der Mutter wegzuhaschen, wenn sie den ersten Ausgang machen. Sehr jung eingefangene und noch säugende Murmelthiere sind schwer aufzuziehen und gehen auch bei der besten Pflege gewöhnlich bald zu Grunde, während die halbwüchsigen sich leicht auffüttern und lange erhalten lassen. Ihre Nahrung besteht in der Gefangenschaft aus verschiedenen Pflanzenstoffen und Milch. Gibt man sich Mühe mit ihnen, so werden sie bald und in hohem Grade zahm, zeigen sich folgsam und gelehrig, lernen ihren Pfleger kennen, auf seinen Ruf achten, allerlei Stellungen annehmen, auf den Hinterbeinen aufgerichtet umherhüpfen, an einem Stocke gehen u. s. w. Das harmlose und zutrauliche Thier ist dann die Freude von Jung und Alt, und seine Reinlichkeitsliebe und Nettigkeit erwirbt ihm viele Freunde. Auch mit anderen Thieren verträgt sich das Murmelthier gut, erlaubt in Thiergärten Pakas und Agutis in den von ihm gegrabenen Höhlen zu wohnen, und wird, obschon es Zudringlichkeit zurückweist, doch nie zum angreifenden Theile. Mit seines Gleichen lebt es nicht immer in gutem Einvernehmen; mehrere zusammengesperrte Murmelthiere greifen nicht selten einander an, und das stärkere beißt das schwächere todt. Im Hause kann man es nicht umherlaufen lassen, weil es alles zernagt, und der Käfig muß auch stark und innen mit Blech beschlagen sein, wenn man das Durchbrechen verhindern will. Im Hofe oder im Garten läßt es sich ebenso wenig halten, weil es sich doch einen Ausweg verschafft, indem es sich unter den Mauern durchgräbt. Im warmen Zimmer lebt es im Winter wie im Sommer, in kalten Räumen rafft es alles zusammen, was es bekommen kann, baut sich ein Nest und schläft, aber mit Unterbrechung. Während des Winterschlafes kann man ein wohl in Heu eingepacktes Murmelthier in gut verschlossenen Kisten weit versenden. Mein Vater erhielt von Schinz eins zugesandt, noch ehe die Eisenbahn eine schnelle Beförderung möglich machte; aber das Thier hatte die Reise aus der Schweiz bis nach Thüringen sehr gut vertragen und kam noch im festen Schlafe an. Uebrigens erhält man selbst bei guter Pflege das gefangene Murmelthier selten länger als fünf bis sechs Jahre am Leben.