
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Was die Marder unter den Raubthieren, sind die Spitzmäuse ( Soricidea ) unter den Kerbthierfressern. Wie jene besitzen sie alle Fähigkeiten, welche ein echtes Räuberleben möglich machen, sind sie in allen Gebieten der Erde zu Hause, und zeigen einen Muth, einen Blutdurst, eine Grausamkeit, welche mit ihrer geringen Größe gar nicht im Verhältnis stehen.
Die Spitzmäuse, neben den Fledermäusen die kleinsten aller Säugethiere, sind regelmäßig gebaute, in ihrer äußeren Erscheinung an Ratten und Mäuse erinnernde Kerfjäger. Der Leib ist schlank, der Kopf lang, der Schnauzentheil gestreckt, das Gebiß sehr vollständig und aus außerordentlich scharfen Zähnen zusammengesetzt, gewöhnlich gebildet von zwei bis drei Schneidezähnen, welche oft gekerbt sind, drei bis fünf Lück- und drei bis vier echten, vier- oder fünfzackigen Backenzähnen in jeder Reihe. Die eigentlichen Eckzähne fehlen. Zwölf bis 14 Wirbel tragen Rippen, 6 bis 8 sind rippenlos, 3 bis 5 bilden das Kreuzbein, 14 bis 28 den Schwanz. Eigenthümliche Drüsen liegen an den Rumpfseiten oder an der Schwanzwurzel. Den Leib bekleiden weiche, sammetähnliche Haare, die Lippen und Füße wie den Schwanz straffere Härchen, die Wangen lange Schnurren, die Fußseiten starke, nach der nackten Fußsohle hin scharf abgesetzte Borstenhaare.
Gegenwärtig verbreiten sich die Spitzmäuse über die Alte Welt und Amerika; in Australien dagegen fehlen sie gänzlich. Sie leben ebensowohl in Ebenen wie in höher gelegenen Gegenden, selbst auf den Voralpen und Alpen, am liebsten aber in dichteren Wäldern und Gebüschen, auf Wiesen und Auen, in Gärten und Häusern. Die meisten geben feuchten Orten den Vorzug; einige treiben sich im Wasser umher. Viele führen ein unterirdisches Leben, indem sie sich selbst Löcher oder Gänge graben oder die schon vorhandenen benutzen, nachdem sie den rechtmäßigen Eigenthümer mit Güte oder Gewalt vertrieben haben. Fast alle suchen die Dunkelheit oder den Schatten und scheuen die Dürre, die Hitze, das Licht, sind auch gegen derartige Einflüsse so empfindlich, daß sie den Sonnenstrahlen häufig unterliegen. Ihre Bewegungen sind außerordentlich rasch und behend, sie mögen so verschiedenartig sein, als sie wollen. Diejenigen, welche bloß laufen, huschen pfeilschnell dahin, die Schwimmer stehen keinem Binnenlandsäugethiere nach.
Unter den Sinnen der Spitzmäuse scheint der Geruch obenanzustehen, nächstdem ist das Gehör besonders ausgebildet, das Auge dagegen mehr oder weniger verkümmert. Ihre geistigen Fähigkeiten sind gering; dennoch läßt sich ein gewisser Grad von Verstand nicht ableugnen. Sie sind raub- und mordlustig im hohen Grade und kleineren Thieren wirklich furchtbar, während sie größeren bedächtig ausweichen. Schon bei dem geringsten Geräusche ziehen sich die meisten nach ihren Schlupfwinkeln zurück, haben aber auch Ursache, dies zu thun, weil sie gegen starke Thiere so gut als wehrlos sind. Wir müssen die meisten von ihnen von unserem Standpunkte aus nicht nur als harmlose, unschädliche Thiere betrachten, sondern in ihnen höchst nützliche Geschöpfe erkennen, welche uns durch Vertilgung schädlicher Kerfe erhebliche Dienste leisten. Ihre Nahrung ziehen sie nämlich fast nur aus dem Thierreiche: Kerbthiere und deren Larven, Würmer, Weichthiere, kleine Vögel und Säugethiere, unter Umständen aber auch Fische und deren Eier, Krebse etc. fallen ihnen zur Beute.
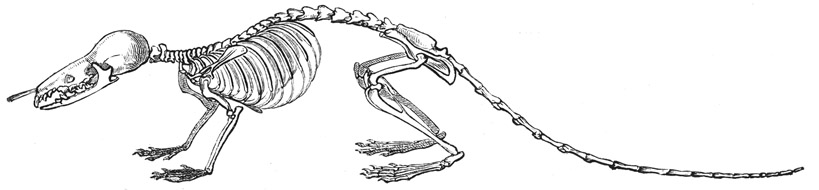
Geripp der Wasserspitzmaus. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
Ungemein gefräßig, verzehren sie täglich so viel, als ihr eigenes Gewicht beträgt. Keine einzige Art kann den Hunger längere Zeit vertragen; sie halten deshalb auch keinen Winterschlaf, sondern treiben sich bei einigermaßen milder Witterung sogar auf dem verschneiten Boden umher oder suchen an geschützten Orten, z. B. in menschlichen Wohnungen, ihre Nahrung auf. Die Stimme aller Arten besteht in feinen, zwitschernden oder quiekenden und pfeifenden Lauten; in der Angst lassen sie klägliche Töne vernehmen, und bei Gefahr verbreiten alle einen stärkeren oder schwächeren Moschus- oder Zibetgeruch, welcher sie im Leben zwar nicht gegen ihre Feinde bewahrt, sie aber doch nur sehr wenigen Thieren als genießbar erscheinen läßt. So lassen die Hunde, Katzen und Marder gewöhnlich die getödteten Spitzmäuse liegen, ohne sie aufzufressen, während die meisten Vögel, bei denen Geruch- und Geschmacksinn weniger entwickelt sind, sie als Nahrung nicht verschmähen.
Die meisten Spitzmäuse sind fruchtbare Geschöpfe; denn sie werfen zwischen vier und zehn Junge. Gewöhnlich kommen diese nackt und mit geschlossenen Augen zur Welt, entwickeln sich aber rasch und sind schon nach Monatsfrist im Stande, ihr eigenes Gewerbe zu betreiben.
Der Mensch kann unsere Thiere unmittelbar nicht verwerthen; wenigstens wird nur von einer einzigen Art das Fell als Pelzwerk und der stark nach Zibet riechende Schwanz als Mittel gegen die Motten benutzt, das Fleisch aber nirgends gegessen. Um so größer ist der mittelbare Nutzen, den die Spitzmäuse bringen. Dieser Nutzen muß schon von den alten Egyptern anerkannt worden sein, weil sie eine Art von ihnen einbalsamirt und mit ihren Todten begraben haben.
In der ersten Unterfamilie vereinigt man die Spitzmäuse ( Soricina ) im engeren Sinne. Sie bilden den Kern der Familie, haben 28 bis 32 Zähne, einen langen und schmalen Schädel mit häutigen Stellen am Schädelgrunde, aber ohne Jochbogen, verwachsene Unterschenkelknochen und keine Schwimmhäute zwischen den Zehen. In Deutschland sind drei Sippen dieser Unterfamilie vertreten.
Zweiunddreißig an den Spitzen dunkelbraun gefärbte Zähne, und zwar zwei große Vorderzähne mit Höckern, fünf kleine einspitzige Lück- und vier vielspitzige Mahlzähne im Oberkiefer, zwei an den Schneiden wellenförmig gezähnelte Vorder-, zwei Lück- und drei Backenzähne im Unterkiefer, ringsum an den Seiten mit kurzen und weichen Haaren umgebene Füße und Zehen und gleichmäßige und gleichlange Behaarung des Schwanzes kennzeichnen die Spitzmäuse im engsten Sinne ( Sorex), deren gemeinste Vertreterin, die Waldspitzmaus ( Sorex vugaris, S. tetragonurus, eremita, cunicularia, coronatus, concinnus, rhinolophus, melanodon, castaneus, labiosus etc.) zu den bekanntesten Thieren unseres Vaterlandes gehört. An Größe steht die Waldspitzmaus der Hausmaus etwas nach: ihre Länge beträgt 11 Centim., wovon 4,5 Centim. auf den Schwanz kommen. Die Färbung des feinen Sammetpelzes spielt zwischen lebhaftem Rothbraun und dem glänzendsten Schwarz; die Seiten sind immer lichter gefärbt als der Rücken, die Untertheile graulichweiß mit bräunlichem Anfluge, die Lippen weißlich, die langen Schnurren schwarz, die Pfoten bräunlich, der Schwanz oben dunkelbraun, unten aber bräunlichgelb. Nach der wechselnden Färbung hat man mehrere Unterschiede angenommen, welche die Einen für Arten, die Anderen für Abarten erklären.
Man findet die Waldspitzmaus in Deutschland, Schweden, England, Frankreich, Italien, Ungarn und Galizien, wahrscheinlich auch im benachbarten Rußland, in der Höhe sowohl wie in der Tiefe, auf Bergen wie in Thälern, in Feldern, Gärten, in der Nähe von Dörfern oder in Dörfern selbst und gewöhnlich nahe bei Gewässern. Im Winter kommt sie in die Häuser oder wenigstens in die Ställe und Scheuern herein. Bei uns ist sie die gemeinste Art der ganzen Familie. Sie bewohnt am liebsten unterirdische Höhlen und bezieht deshalb gern die Gänge des Maulwurfs oder verlassene Mäuselöcher, falls sie nicht natürliche Ritzen und Spalten im Gestein auffindet. In weichem Boden gräbt sie mit ihrem Rüssel und den schwachen Vorderpfoten selbst Gänge aus, welche regelmäßig sehr oberflächlich unter der Erde dahin laufen. Wie die meisten anderen Arten der Familie ist auch sie ein vollkommenes Nachtthier, welches bei Tage nur ungern seinen unterirdischen Aufenthaltsort verläßt. Niemals thut sie dies während der Mittagssonne, und es scheint wirklich, daß die Sonnenstrahlen ihr überaus beschwerlich fallen; wenigstens nimmt man an, daß die vielen todten, welche man im Hochsommer an Wegen und Gräben findet, von der Sonne geblendet, den Eingang ihrer Höhle nicht wieder auffinden konnten und deshalb zu Grunde gingen.
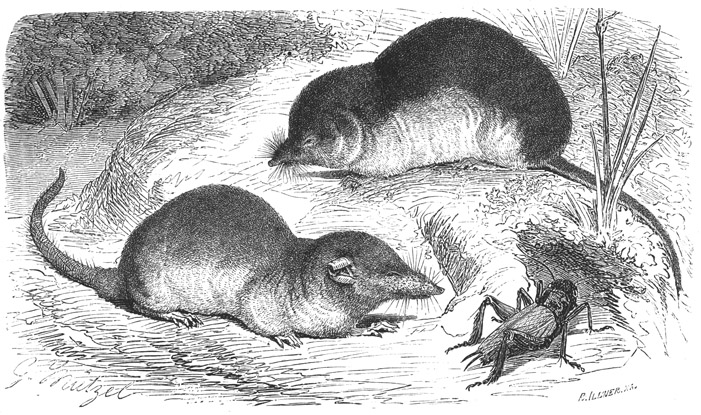
Hausspitzmaus ( Crocidura Araneus) und Waldspitzmaus ( Sorex vulgaris). Natürliche Größe.
Unaufhörlich sieht man die Spitzmaus beschäftigt, mit ihrem Rüssel nach allen Richtungen hin zu schnüffeln, um Nahrung zu suchen, und was sie findet und überwältigen kann, ist verloren: sie frißt ihre eigenen Jungen oder die Getödteten ihrer eigenen Art auf. »Ich habe«, sagt Lenz, »oft Spitzmäuse in Kisten gehabt. Mit Fliegen, Mehlwürmern, Regenwürmern und dergleichen sind sie fast gar nicht zu sättigen. Ich mußte jeder täglich eine ganze todte Maus oder Spitzmaus oder ein Vögelchen von ihrer eigenen Größe geben. Sie fressen, so klein sie sind, täglich ihre Maus auf und lassen nur Fell und Knochen übrig. So habe ich sie oft recht fett gemästet; läßt man sie aber im geringsten Hunger leiden, so sterben sie. Ich habe auch versucht, ihnen nichts als Brod, Rüben, Birnen, Hanf, Mohn, Rübsamen, Kanariensamen etc. zu geben; aber sie verhungerten lieber, als daß sie anbissen. Bekamen sie fettgebackenen Kuchen, so bissen sie dem Fett zu Liebe an; fanden sie eine in einer Falle gefangene Spitzmaus oder Maus, so machten sie sich augenblicklich daran, selbige aufzufressen. Bei guter Abwartung hält die Waldspitzmaus monatelang in Gefangenschaft aus.«
Der Dichter Welcker band einer lebenden Spitzmaus einen festen Faden an den Hinterfuß und ließ sie auf dem Felde in von Mäusen bewohnte Löcher kriechen. Nach einer kurzen Zeit kam aus einem derselben eine Ackermaus in größter Angst hervor gekrochen, aber mit der Spitzmaus auf dem Rücken. Das gierige Raubthier hatte sich mit den Zähnen im Nacken des Schlachtopfers eingebissen, saugte ihm luchsartig das Blut aus, tödtete es in kurzer Zeit und fraß es auf.
Die Bewegungen der Waldspitzmaus sind außerordentlich rasch und behend. Sie läuft huschend gewandt auf dem Boden dahin, springt ziemlich weit, vermag an schiefen Stämmen empor zu klettern und versteht im Nothfalle recht leidlich zu schwimmen. Ihre Stimme besteht in einem scharfen, feinzwitschernden, fast pfeifenden aber leisen Tone, wie ihn auch die übrigen Arten der Familie vernehmen lassen. Unter den Sinnen steht unzweifelhaft der Geruch obenan. Es kommt oft vor, daß lebend gefangene, welche wieder frei gelassen werden, in die Falle zurücklaufen, bloß weil diese den Spitzmausgeruch an sich hat. Ihrem Gesichte scheint die Spitzmaus nicht zu folgen, und ebenso muß ihr Gehör ziemlich schwach sein; die feine Nase ersetzt aber auch beide Sinne fast vollkommen.
Es gibt wenig andere Thiere, welche so ungesellig sind und sich gegen ihres Gleichen so abscheulich benehmen wie eben die Spitzmäuse; bloß der Maulwurf noch dürfte ihnen hierin gleichkommen. Nicht einmal die verschiedenen Geschlechter leben, die Paarzeit ausgenommen, im Frieden mit einander. Sonst frißt eine Spitzmaus die andere auf, sobald sie derselben habhaft werden und sie überwältigen kann. Oft sieht man zwei von ihnen in einen so wüthenden Kampf verwickelt, daß man sie mit den Händen greifen kann; sie bilden einen förmlichen Knäuel und rollen nun über den Boden dahin, fest in einander verbissen und mit einer Wuth an einander hängend, welche des unfläthigsten Bulldoggen würdig wäre. Ein wahres Glück ist es, daß die Spitzmäuse nicht Löwengröße haben: sie würden die ganze Erde entvölkern und schließlich verhungern müssen. Nur höchst selten trifft man größere Gesellschaften von Spitzmäusen an, zwischen denen Frieden herrscht oder zu herrschen scheint. Cartrey hörte einmal in trockenem Laube ein ununterbrochenes Rascheln und Lärmen und entdeckte eine zahlreiche Menge unserer Thiere, seiner Schätzung nach etwa hundert Stück, welche unter einander zu spielen schienen und unter beständigem Zirpen und Quieken hin- und herrannten, warum, war nicht zu ergründen; vielleicht handelte es sich um eine großartige Freierei.
Die trächtige Spitzmaus baut sich ein Nest aus Moos, Gras, Laub und Pfianzenstengeln, am liebsten im Mauerwerk oder unter hohlen Baumwurzeln, versieht es mit mehreren Seitengängen, füttert es weich aus und wirft hier zwischen Mai und Juli fünf bis zehn Junge, welche nackt und mit geschlossenen Augen und Ohren geboren werden. Anfänglich säugt die Alte die Sprößlinge mit vieler Zärtlichkeit, bald aber erkaltet ihre Liebe, und die Jungen machen sich nun auf, um sich selbständig ihre Nahrung zu erwerben. Dabei schwinden, wie bemerkt, alle geschwisterlichen Rücksichten; denn jede Spitzmaus versteht schon in der Jugend unter Nahrung nichts anderes als alles Fleisch, welches sie erbeuten kann, sei es auch der Leichnam ihres Geschwisters.
Auffallend ist, daß die Spitzmäuse nur von wenigen Thieren gefressen werden. Die Katzen tödten sie, wahrscheinlich, weil sie sie anfangs für eine Maus halten, beißen sie aber nur todt, ohne sie jemals zu fressen. Auch die Marderarten scheinen sie zu verschmähen. Bloß einige Raubvögel sowie der Storch und die Kreuzotter verschlingen sie ohne Umstände und mit Behagen. Jedenfalls hat die Abneigung der geruchsbegabten Säugethiere ihren Grund in dem Widerwillen, welchen ihnen die Ausdünstung der Spitzmäuse einflößt. Dieser starke moschusartige Geruch wird durch zwei Absonderungsdrüsen hervorgebracht, welche sich an den Seiten des Leibes, und zwar näher an den Vorder- als an den Hinterbeinen finden, und theilt sich allen Gegenständen, welche die Spitzmaus berührt, augenblicklich mit.
Es ist möglich, daß der Aberglaube, unter welchem die Spitzmäuse in manchen Gegenden Europas zu leiden haben, in diesem Geruche mit begründet ist. Hier und da, in England z. B., wird das harmlose Thier fast noch mehr gefürchtet als die tückische Viper. Jedermann sieht ein, daß eine Spitzmaus dem Menschen mit ihren feinen, dünnen Zähnen nicht das geringste zu Leide thun kann, und dennoch schreibt man ihrem Bisse die giftigsten Wirkungen zu. Ja, das bloße Berühren von einer Spitzmaus wurde als ein sicherer Vorbote irgend welchen Uebels gedeutet, und Thier oder Mensch, welche »spitzmausgeschlagen« waren, mußten, nach allgemein gültiger Meinung aller alten Waschweiber in Frauen- oder Männertracht, nothwendigerweise demnächst erkranken, falls sie nicht ein eigenthümliches Mittel schleunigst anwandten. Dieses Heilmittel, welches allein gegen die Spitzmauskrankheit helfen konnte, bestand in den Zweigen einer »Spitzmausesche«, welche durch ein sehr einfaches Verfahren zu dem heilkräftigen Baume gestempelt worden war. Eine lebendige Spitzmaus wurde gefangen und mit Siegesjubel zu der Esche gebracht, welcher die Ehre zu Theil werden sollte, das Menschengeschlecht vor den Schlingen des Satans in Gestalt des kleinen Raubthieres zu schützen. Man bohrte ein großes Loch in den Stamm der Esche, ließ die Spitzmaus hinein kriechen und verschloß das Loch durch einen festen Pfropfen. So kurze Zeit nun auch das Leben des solchem Wahne geopferten Thieres in dem engen Gefängnisse währen konnte, so kräftig war doch die Wirkung; denn von diesem Augenblick an erhielt die Esche ihre übernatürlichen Kräfte.
Wie verbreitet und allgemein geglaubt dieser Unsinn in der Vorzeit war, geht aus der »Geschichte der vierfüßigen Thiere und der Schlangen von Topsel« hervor, welche im Jahre 1658 zu London erschien. Der spaßhafte alte Thierkundige sagt über die Spitzmaus in jenem Buche ungefähr folgendes: »Sie ist ein raubgieriges Vieh, heuchelt aber Liebenswürdigkeit und Zahmheit; doch beißt sie tief und vergiftet tödtlich, so wie sie berührt wird. Grausamen Wesens, sucht sie jedem Dinge zu schaden, und es gibt kein Geschöpf, welches von ihr geliebt wird, noch eines, welches sie lieben sollte; denn alle Thiere fürchten sie. Die Katzen jagen und tödten sie, aber sie fressen sie nicht; denn wenn sie letzteres thun wollten, würden sie vergehen und sterben. Wenn die Spitzmäuse in ein Fahrgeleise fallen, müssen sie ihr Leben lassen, weil sie nicht wieder weggehen können. Dies bezeugen Marcellus Nicander und Plinius, und die Ursache davon wird von Philes gegeben, welcher sagt, daß sie sich in einem Geleise so erschöpft und bedroht fühlen, als wären sie in Banden geschlagen. Eben deshalb haben die Alten auch die Erde aus Fahrgeleisen als Gegenmittel für den Spitzmausbiß verschrieben. Man hat aber noch mehrere Mittel, wie bei anderen Krankheiten, um die Wirkung ihres Giftes zu heilen, und diese Mittel dienen zugleich auch noch, um allerlei Uebel zu heben. Eine Spitzmaus, welche aus irgend einer Ursache in ein Geleis gefallen und dort gestorben ist, wird verbrannt, zerstampft und dann mit Staub und Gänsefett vermischt: solche Salbe heilt alle Entzündungen unfehlbar. Eine Spitzmaus, welche getödtet und so aufgehängt worden ist, daß sie weder jetzt noch später den Grund berührt, hilft denen, deren Leib mit Geschwüren und Beulen bedeckt ist, wenn sie die wunde Stelle dreimal mit dem Leichname des Thieres berühren. Auch eine Spitzmaus, welche todt gefunden und in Leinen-, Wollen- oder anderes Zeug eingewickelt worden ist, heilt Schwären und andere Entzündungen. Der Schwanz der Spitzmaus, welcher zu Pulver gebrannt und zur Salbe verwandt wurde, ist ein untrügliches Mittel gegen den Biß wüthender oder toller Hunde etc.« Nach diesem einen Pröbchen brauche ich wohl von der sonstigen Verwendung des heilkräftigen Thierchens nichts weiter zu sagen.
Bei den Feldspitzmäusen ( Crocidura ) besteht das Gebiß aus 28 bis 30 weißen Zähnen, da im Oberkiefer, abweichend von dem Gebiß der Spitzmäuse, drei oder vier einspitzige Zähne vorhanden sind. Im übrigen stimmen beide Gruppen wesentlich mit einander überein.
Die Hausspitzmaus ( Crocidura Araneus, Sorex Araneus, russulus, fimbriatus und pachyurus, Crocidura moschata, thoracica und musaranea), ein Thierchen von 11,5 Centim. Gesammt- oder 7 Centim. Leibes- und 4,5 Centim. Schwanzlänge, bei uns zu Lande häufiger Vertreter der Sippe (vergl. die Abbildung auf S. 228[???]), ist oberseits braungrau, in der Jugend schwärzlichgrau, unterseits ohne scharfe Abgrenzung der Färbung heller grau, an Lippen und Füßen bräunlichweiß, auf dem Schwanze oben hellbraungrau, unten graulichweiß behaart. Das Gebiß besteht aus 28 Zähnen.
Von Nordafrika an verbreitet sich die Hausspitzmaus über Süd-, West- und Mitteleuropa, bis Nordrußland, kommt auch im nordöstlichen Sibirien vor, scheint dagegen in England, Dänemark, Skandinavien und Holland zu fehlen. Sie ist, laut Blasius, gewissermaßen an Feld und Garten gebunden, zieht beide wenigstens dem Walde und seinen Rändern, wo sie zuweilen gefunden wird, entschieden vor. Keine ihrer Verwandten gewöhnt sich so leicht an die Umgebung des Menschen, keine kommt so oft in die Gebäude, zumal in Scheuern und Ställe, herein wie sie. In Kellern und Speisekammern siedelt sie gern sich an, vorausgesetzt, daß dunkle Winkel, welche ihr Schlupforte gewähren, vorhanden sind. Im Freien jagt sie in den Früh- und Abendstunden auf Kleingethier aller Art, vom kleinen Säugethiere an bis zum Wurme herab; in den Häusern benascht sie Fleisch, Speck und Oel. Ihre Sitten und Gewohnheiten ähneln denen der Waldspitzmaus fast in jeder Hinsicht. Im Freien wirft sie im Sommer, in warmen Gebäuden auch in den Herbst- und Wintermonaten fünf bis zehn nackte und blinde Junge auf ein verstecktes und ziemlich sorgsam mit weichen Stoffen ausgebettetes Lager; nach Verlauf von etwa sechs Wochen haben die Jungen bereits fast die Größe der Alten erreicht und sind selbständig geworden, gehen wenigstens schon ebenso gut wie die Alte auf Raub aus. Ungeachtet ihrer Näschereien ist auch die Hausspitzmaus ein vorwiegend nützliches Thier, welches durch Wegfangen von allerlei Ungeziefer seine unbedeutenden Uebergriffe reichlich sühnt, also unsere Schonung verdient.
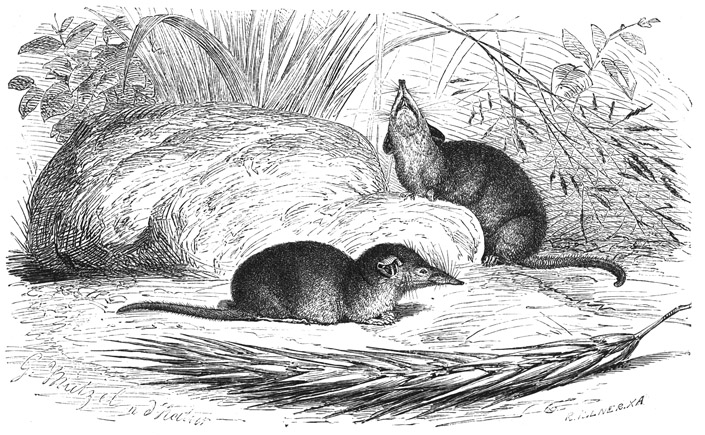
Wimperspitzmaus ( Crocidura suaveolens). Natürliche Grüße.
Eine zweite Art der Sippe, oder wie andere wollen, wegen ihrer 30 Zähne Vertreterin einer besonderen Untersippe ( Pachyura), die Wimperspitzmaus ( Crocidura suaveolens , C. und Pachyura etrusca, Sorex suaveolens und etruscus), verdient aus dem Grunde erwähnt zu werden, weil sie neben einer Fledermaus das kleinste aller bis jetzt bekannten Säugethiere ist. Ihre Gesammtlänge beträgt nur 6,5 Centim., wovon 2,5 Centim. auf den Schwanz kommen. Die Färbung des sammetweichen Pelzes ist hellbräunlich oder röthlichgrau, der Schwanz oben bräunlich, unten lichter, der Rüssel und die Pfoten sind fleischfarben, die Füße haben weißliche Härchen; ältere Thiere sehen heller und rostfarbig, junge dunkler und mehr graufarbig aus. Beachtung verdient die verhältnismäßig sehr große Ohrmuschel.
Die Wimperspitzmaus kommt fast in allen Ländern vor, welche rings um das Mittelländische und Schwarze Meer liegen. Sie ist im Norden Afrikas, im südlichen Frankreich, in Italien und der Krim gefunden worden. In ihrer Lebensweise ähnelt sie ihren Sippschaftsverwandten. Zum Aufenthaltsorte wählt sie sich am liebsten Gärten in der Nähe von Dörfern, aber sie kommt auch in Gebäuden und Wohnungen vor. Da sie viel zarter und empfindlicher gegen die Kälte ist als unsere nordischen Arten, sucht sie sich gegen den Winter dadurch zu schützen, daß sie sich besonders warme Aufenthaltsorte für die kalten Monate auswählt.
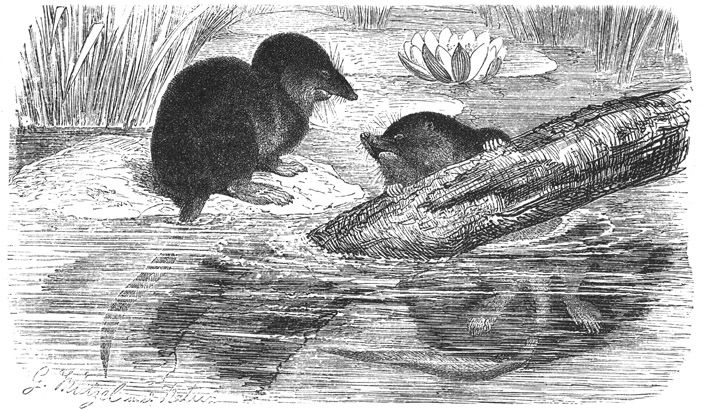
Wasserspitzmaus ( Crossopus fodiens). Natürliche Größe.
Abgesehen von der Gestaltung des hinteren Hakens der oberen Vorderzähne und der dunkelbraunen Färbung der Zahnspitzen stimmt das Gebiß der Wasserspitzmäuse ( Crossopus) mit dem der Wimperspitzmaus in der Anzahl und Anordnung der Zähne überein; jene unterscheiden sich jedoch wesentlich von den Feldspitzmäusen dadurch, daß ihre Füße und Zehen ringsum an den Seiten steife Borstenhaare tragen und der auf der Oberseite gleichmäßig kurz behaarte Schwanz längs der Mitte der Unterseite einen Kiel von eben solchen Borstenhaaren zeigt.
Die Wasserspitzmaus( Crossopus fodiens, Sorex fodiens, hydrophilus, carinatus, constrictus, fluviatilis, remifer, lineatus, ciliatus, bicolor, nigripes, amphibius, natans, stagnatilis, rivalis, Crossopus psilurus, Amphisorex Pennantii und Linneanus), wie aus dem Reichthum wissenschaftlicher Namen ersichtlich, ein bezüglich ihrer Färbung vielfach abänderndes Thier, gehört zu den größeren Arten der bei uns vorkommenden Spitzmäuse. Ihre Gesammtlänge beträgt 11,8 Centim., wovon 5,8 Centim. auf den Schwanz kommen. Der feine, dichte und weiche Pelz ist gewöhnlich auf dem Oberkörper schwarz, im Winter glänzender als im Sommer, auf dem Unterkörper aber grauweiß oder weißlich, zuweilen rein, manchmal mit Grauschwarz theilweise gefleckt. Die Haare des Pelzes stehen so dicht, daß sie vollkommen an einander schließen und keinen Wassertropfen bis auf die Haut eindringen lassen. Die Schwimmhaare, welche nach dem Alter der Jahreszeit länger oder kürzer sind, lassen sich so ausbreiten, daß sie wie die Zinken eines Kammes auf jeder Seite der Füße hervorstehen, und auch wieder so knapp an die Seiten dieser Theile anlegen, daß man sie wenig bemerkt. Sie bilden, gehörig gebreitet, ein sehr vollkommenes Ruder und leisten vortreffliche Dienste. Nach Belieben können sie entfaltet und wieder zusammengelegt und beim Laufen so angedrückt werden, daß sie hinlänglich gegen die Abnutzung geschützt sind.
Wie es scheint, ist die Wasserspitzmaus über fast ganz Europa und einen Theil Asiens verbreitet und an geeigneten Orten überall häufig zu finden. Ihre Nordgrenze erreicht sie in England und in den Ostseeländern, ihre Südgrenze in Spanien und Italien. In den Gebirgen steigt sie zu bedeutenden Höhen empor, in den Alpen etwa bis zu 2000 Meter über dem Meere. Sie bewohnt vorzugsweise die Gewässer gebirgiger Gegenden und am liebsten solche, in denen es auch bei der größten Kälte noch offene Quellen gibt, weil diese ihr im Winter, um frei aus- und ein zu gehen, ganz unentbehrlich sind. Bäche gebirgiger Waldgegenden, welche reines Wasser, sandigen oder kiesigen Grund haben, mit Bäumen besetzt sind und von Gärten oder Wiesen eingeschlossen werden, scheinen Lieblingsorte von ihr zu sein. Ebenso gern aber hält sie sich in Teichen mit hellem Wasser und einer Decke von Meerlinsen auf. Zuweilen findet man sie hier in erstaunlicher Menge. Oft wohnt sie mitten in den Dörfern, gern in der Nähe der Mühle; doch ist sie nicht an das Wasser gebunden, läuft vielmehr auch auf den an Bächen liegenden Wiesen umher, verkriecht sich unter Heuschobern, geht in Scheuern und Ställe, selbst in das Innere der Häuser, und kommt manchmal auf Felder, welche weit vom Wasser entfernt sind. In lockerem Boden nahe am Wasser gräbt sie sich selbst Röhren, benutzt aber doch noch lieber die Gänge der Mäuse und Maulwürfe, welche sie in der Nähe ihres Aufenthaltsortes vorfindet. Ein Haupterfordernis ihrer Wohnung ist, daß die Hauptröhre verschiedene Ausgänge hat, von denen der eine in das Wasser, die anderen über der Oberfläche desselben und noch andere nach dem Lande zu münden. Die Baue sind Schlaf- und Zufluchtsorte des Thierchens und gewähren ihm bei Verfolgung der Katzen und anderer Raubthiere eine sichere Unterkunft.
In dieser Wohnung bringt die Wasserspitzmaus an belebten Orten gewöhnlich den ganzen Tag zu; da aber, wo sie keine Nachstellung zu fürchten hat, ist sie, besonders im Frühjahre, zur Paarungszeit, auch bei Tage sehr munter. Selten schwimmt sie an dem Ufer entlang, lieber geht sie quer durch von dem einen Ufer zum anderen. Will sie sich längs des Baches fortbewegen, so läuft sie entweder unter dem Ufer weg oder auf dem Boden des Baches unter dem Wasser dahin. Sie ist ein äußerst munteres, kluges und gewandtes Thier, welches dem Beobachter in jeder Hinsicht Freude macht. Ihre Bewegungen sind schnell und sicher, behend und ausdauernd. Sie schwimmt und taucht vortrefflich und besitzt die Fähigkeit, bald mit vorstehendem Kopfe, bald mit sichtbarem ganzen Oberkörper auf dem Wasser zu ruhen, ohne dabei merklich sich zu bewegen. Wenn sie schwimmt, erscheint ihr Leib breit, platt gedrückt und gewöhnlich auch mit einer Schicht glänzendweißer, sehr kleiner Perlen überdeckt, den Bläschen nämlich, welche aus der von den dichten Haaren zurückgehaltenen Luft sich bilden. Gerade diese gestaute Luftschicht über dem Körper scheint ihr Fell immer trocken zu halten.
Wenn man an einem Teiche sich versteckt und hier Wasserspitzmäuse beobachtet, welche nicht beunruhigt worden sind, kann man ihr Treiben sehr gut wahrnehmen. Schon früh vor oder gleich nach Sonnenaufgang sieht man sie zum Vorschein kommen und im Teiche umherschwimmen. Oft halten sie inne und legen sich platt auf das Wasser oder schauen halben Leibes aus demselben hervor, so daß ihre weiße Kehle sichtbar wird. Beim Schwimmen rudern sie mit den Hinterfüßen so stark, daß man nach der Bewegung des Wassers ein weit größeres Thier vermuthen möchte; beim Ausruhen sehen sie sich überall um und fallen, wenn sie eine Gefahr ahnen, pfeilschnell in das Wasser, so geschwind, daß der Jäger, welcher sie erlegen will, sehr nahe sein muß, wenn sie der Hagel seines Gewehres erlegen soll: denn sie stürzen sich wie Steißfüße oft in dem Augenblicke in die Tiefe, in welchem sie den Rauch aus dem Gewehr wahrnehmen, entkommen so auch wirklich dem ihnen zugedachten Tode. In früheren Zeiten, als man noch keine Schlagschlösser an den Gewehren hatte, hielt es sehr schwer, Wasserspitzmäuse zu erlegen: sie waren verschwunden, sowie das Feuer auf der Pfanne aufblitzte. Selten bleibt die kleine Taucherin lange auf dem Grunde des Wassers, kommt vielmehr gewöhnlich bald wieder zur Oberfläche herauf. Hier ist ihr Wirkungskreis, hier sieht man sie an einsamen, stillen Orten den ganzen Tag über in Bewegung. Sie schwimmt nicht nur an den Ufern, sondern auch in der Mitte des Teiches umher, oft von einer Seite zur anderen, und ruht gern auf einem in das Wasser hängenden Baumstumpfe oder auf einem darin schwimmenden Holze aus, springt zuweilen aus dem Wasser in die Höhe, um ein vorüberfliegendes Kerbthier zu fangen, und stürzt sich kopfunterst wieder hinein. Dabei ist ihr Fell immer glatt und trocken, und die Tropfen laufen von ihm, sowie sie wieder an die Oberfläche kommt, ab wie Wasser, welches man auf Wachstafft gießt. Im kranken Zustande verliert sich diese Eigenschaft des Pelzes: die Haare werden naß, und die Feuchtigkeit dringt bis auf die Haut; dann aber geht die Wasserspitzmaus auch sehr bald zu Grunde.
Das volle Leben des schmucken Thieres zeigt sich am besten bei der Paarung und Begattung, welche im April oder Mai vor sich zu gehen pflegt. Unter beständigem Geschrei, welches fast wie »Sisisi« klingt und, wenn es von mehreren ausgestoßen wird, ein wahres Geschwirr genannt werden kann, verfolgt das Männchen das Weibchen. Letzteres kommt aus seinem Verstecke herausgeschwommen, hebt den Kopf und die Brust über das Wasser empor und sieht sich nach allen Seiten um. Das Männchen, welches den Gegenstand seiner Sehnsucht unzweifelhaft schon gesucht hat, zeigt sich jetzt ebenfalls auf dem freien Wasserspiegel und schwimmt, so bald es die Verlorene wieder entdeckt hat, eilig auf sie zu. Dem Weibchen ist es aber noch nicht gelegen, die ihm zugedachten Liebkosungen anzunehmen. Es läßt zwar das Männchen ganz nahe an sich heran kommen; doch ehe es erreicht ist, taucht es plötzlich unter und entweicht weit, indem es auf dem Grunde des Teiches eine Strecke fortläuft und an einer ganz anderen Stelle wieder emporkommt. Das Männchen hat dies jedoch bemerkt und eilt von neuem dem Orte zu, an welchem seine Geliebte sich befindet. Schon glaubt es, am Ziele zu sein, da verschwindet das Weibchen wieder und kommt abermals anderswo zum Vorscheine. So geht das Spiel Viertelstunden lang fort, bis sich endlich das Weibchen dem Willen des Männchens ergibt. Dabei vergißt keines der beiden Gatten, ein etwa vorüberschwimmendes Kerbthier oder einen sonstigen Nahrungsgegenstand aufzunehmen, und nicht selten werden bei dieser Liebesneckerei auch alle Gänge am Ufer mit besucht. In einem der letzteren legt das Weibchen sein Wochenbett in einem kleinen Kessel an, welcher mit Moos und trockenem Grase wohl ausgekleidet wurde. Hier bringt es um die Mitte des Mai seine sechs bis zehn Junge zur Welt. Unmittelbar nach der Geburt sehen diese fast nackten Thierchen mit ihren stumpfen Nasen und halb durchsichtigen fleischfarbenen Leibern äußerst sonderbar aus und zeigen so wenig Aehnlichkeit als denkbar mit ihren Eltern; bald aber wachsen sie heran, erlangen allmählich das Aussehen der Erzeuger und machen sich nunmehr, zunächst wohl unter Führung der Mutter, auch bald zu selbstständiger Jagd auf, in der Nähe der Brutröhre sich schmale Pfädchen im Grase austretend und in allerliebster Weise mit einander spielend.
Im Verhältnis zu ihrer Größe ist die Wasserspitzmaus ein wahrhaft furchtbares Raubthier. Sie verzehrt nicht bloß Kerfe aller Arten, zumal solche, welche im Wasser leben, Würmer, kleine Weichthiere, Krebse und dergleichen, sondern auch Lurche, Fische, Vögel und kleine Säugethiere. Die Maus, welcher sie in ihren Löchern begegnet, ist verloren; die vor kurzem ausgeflogene Bachstelze, welche sich unvorsichtig zu nahe an das Wasser wagt, wird plötzlich mit derselben Gier überfallen, mit welcher sich ein Luchs auf ein Reh stürzt, und in wenigen Minuten abgewürgt; der Frosch, welcher achtlos an einer Fluchtröhre vorüberhüpft, fühlt sich an den Hinterbeinen gepackt und trotz seines kläglichen Geschreies in die Tiefe gezogen, wo er bald erliegen muß; Schmerlen und Elleritzen werden in kleine Buchten getrieben und hier auf eigene Weise gefangen: die Wasserspitzmaus trübt das Wasser und bewacht den Eingang der Bucht; sobald nun einer der kleinen Fische an ihr vorüberschwimmen will, fährt sie auf denselben zu und fängt ihn gewöhnlich; sie fischt, wie das Sprichwort sagt, im Trüben. Aber nicht bloß an kleine Thiere wagt sich die Wasserspitzmaus, sondern auch an solche, deren Gewicht das ihre um mehr als das Sechszigfache übertrifft; ja man kann sagen, daß es kein Raubthier weiter gibt, welches eine verhältnismäßig so große Beute überfällt und umbringt.
»Vor Jahren«, erzählt mein Vater, »wurden im Frühjahre im Heinspitzer See bei Eisenberg mehrere Karpfen von zwei Pfund und darüber gefunden, denen Augen und Gehirn ausgefressen waren; einigen von ihnen fehlte auch an dem Körper hier und da Fleisch. Diese merkwürdige Erscheinung kam in einem Wochenblatte zur Sprache und veranlaßte einen heftigen Streit zwischen zwei Gelehrten einer benachbarten Stadt, in welchem der eine behauptete, die Teichfrösche seien es, welche sich den Fischen auf den Kopf setzten, ihnen die Augen auskratzten und das Gehirn ausfräßen. Dies wurde von denen geglaubt, bei welchen der Frosch überhaupt in schlechtem Rufe steht, von solchen z. B., welche dem unschuldigen Grasfrosche schuld geben, daß er den Flachs nicht nur verwirre, sondern ihn auch, ja selbst Hafer fräße. Selbst unser alter ehrwürdiger Blumenbach wurde in den Streit gezogen, weil er in seiner Naturgeschichte sagt, die Frösche fräßen Fische und auch Vögel. Der Gegner vertheidigte die Teichfrösche mit Geschick; allein ihr Ankläger war nicht so leicht aus dem Sattel zu heben. Er brachte die getrockneten Kinnladen in einer Abbildung zur Anschauung und suchte aus ihnen die Gefährlichkeit der Teichfrösche zu beweisen. Endlich wurde auch ich ersucht, meine Stimme in diesem Streite abzugeben. Ich zeigte, um die Unschuld, den guten Namen und die Ehre der Frösche zu retten, die Unmöglichkeit des ihnen Schuld gegebenen Verbrechens, da es ihnen bekanntlich gänzlich an Mitteln gebricht, dasselbe auszuführen. Man schien mir Glauben zu schenken; doch blieb der Mörder der Karpfen unbekannt. Ich wußte nun zwar, daß die Spitzmäuse Fische fangen und ebenso Fischlaich begierig aufsuchen, hatte auch an den gefangenen Wasserspitzmäusen, welche ich eine Zeitlang lebend besaß, die mörderische Natur derselben hinreichend kennen gelernt; dennoch glaubte ich nicht, daß das kleine Thier so große Fische anfallen und tödten könne. Aber der Beweis wurde mir geliefert.
»Ein Bauergutsbesitzer des hiesigen Kirchspiels zog in seinem Teiche schöne Fische und hatte im Herbste 1829 in den Brunnenkasten vor seinen Fenstern, welcher wegen des zufließenden Quellwassers niemals zufriert, mehrere Karpfen gesetzt, um sie gelegentlich zu verspeisen. Der Januar 1830 brachte eine Kälte von 22° und bedeckte fast alle Bäche dick mit Eis; nur die »warmen Quellen« blieben frei. Eines Tages fand der Besitzer seines Brunnens zu seinem großen Verdrusse in seinem Röhrtroge einen todten Karpfen, welchem Augen und Gehirn ausgefressen waren. Nach wenigen Tagen hatte er den Aerger, einen zweiten anzutreffen, der auf ähnliche Weise zu Grunde gerichtet worden war, und so verlor er einen Fisch nach dem anderen. Endlich bemerkte seine Frau, daß gegen Abend eine schwarze »Maus« an dem Kasten hinaufkletterte, im Wasser umher schwamm, sich einem Karpfen auf den Kopf setzte und mit den Vorderfüßen festklammerte. Ehe die Frau im Stande war, das zugefrorene Fenster zu öffnen, um das Thier zu verscheuchen, waren dem Fische die Augen ausgefressen. Endlich war das Oeffnen des Fensters gelungen, und die Maus wurde in die Flucht getrieben. Allein kaum hatte sie den Kasten verlassen, so wurde sie von einer vorüberschleichenden Katze gefangen, dieser wieder abgenommen und mir überbracht. Es war unsere Wasserspitzmaus. So waren denn die fraglichen Mörder der Karpfen in dem Heinspitzer See entdeckt worden, Mörder, welche ohne die Aufmerksamkeit der Frau vielleicht heute noch unbekannt wären. Dabei muß ich noch bemerken, daß die mir überbrachte Wasserspitzmaus nicht die einzige war, welche jenen Brunnenkasten heimsuchte, es kam eine um die andere nach ihr. Dies bewog den Besitzer, einen vergifteten Karpfenkopf in den Kasten zu legen, und er brachte mit diesem auch wirklich mehrere Wasserspitzmäuse um.«
Die Feinde der Wasserspitzmaus sind fast dieselben, welche wir bei der gemeinen Spitzmaus kennen lernten. Bei Tage geschieht jenen gewöhnlich nichts zu Leide; wenn sie aber des Nachts am Ufer herumlaufen, werden sie oft eine Beute der Eulen und Katzen. Nur die ersteren verzehren sie, die letzteren tödten sie bloß und werfen sie, ihres Moschusgeruches wegen, dann weg. Der Forscher, welcher Wasserspitzmäuse sammeln will, braucht deshalb bloß jeden Morgen die Ufer der Teiche abzusuchen; er findet in kurzer Zeit soviel Leichname dieser Art, als er braucht.
In der Gefangenschaft lassen sich Wasserspitzmäuse nicht eben leicht am Leben erhalten. Mein Vater versuchte mehrmals, sie zu pflegen, doch starben alle schon nach wenigen Tagen. Diejenige, welche am längsten lebte, wurde beobachtet. »Da sie sehr hungrig schien,« sagt er, »legte ich ihr eine todte Ackermaus in ihr Behältnis. Sie begann sogleich an ihr zu nagen und hatte in kurzer Zeit ein so tiefes Loch gefressen, daß sie zu dem Herzen gelangen konnte, welches sie auch verzehrte. Dann verspeiste sie noch einen Theil der Brust und der Eingeweide und ließ das übrige liegen. Sie hielt, wie ich dies bei anderen Spitzmäusen beobachtet habe, beständig den Rüssel in die Höhe und schnüffelte unaufhörlich, um etwas für sie genießbares zu erspähen. Hörte sie ein Geräusch, so verbarg sie sich sehr schnell in dem Schlupfwinkel, welchen ich für sie angebracht hatte. Sie that so hohe Sprünge, daß sie aus einer großen, blechernen Gießkanne, in welcher ich sie zuerst hielt, fast entkam. Am ersten Tage kam sie stets trocken aus dem Wasser hervor, am zweiten Tage war dies schon weniger und kurz vor ihrem Tode fast gar nicht mehr der Fall. Sie war sehr bissig und blieb, bis sie ganz ermattete, scheu und wild.«
Ausden war glücklicher als mein Vater; denn ihm gelang es, Wasserspitzmäuse monatelang in Gefangenschaft zu erhalten. Um sie zu fangen, gebrauchte er einfache Mäusefallen, welche mit einem Frosche geködert wurden. Zum Aufenthalte wies er seinen Pfleglingen einen mit möglichst tiefem Wassernapfe versehenen Käfig an. Die Wasserspitzmäuse, ein Pärchen, schienen sich von Hause aus in besagtem Käfige wohl zu befinden, bekundeten wenigstens kein Zeichen von Furcht, benahmen sich ganz wie zu Hause und fraßen ohne jegliche Scheu Würmer, rohes Fleisch und Kerbthiere, welche ihnen vorgeworfen wurden. Wenige Tage später verschaffte der Pfleger ihnen drei oder vier kleine Fischchen und setzte diese in den Schwimm- und Badenapf. Augenblicklich stürzten sich die Wasserspitzmäuse auf die Fische, kamen wenige Sekunden später mit je einem zum Vorscheine, tödteten die Beute durch einen Biß in den Kopf, hielten sie zwischen den Vorderfüßen fest, ganz wie der Fischotter es zu thun pflegt, und begannen hinter dem Kopfe zu fressen, nach und nach gegen den Schwanz hin vorschreitend. Ihre Freßlust war so groß, daß jede von ihnen zwei oder drei Ellritzen verzehrte, gewiß eine tüchtige Mahlzeit in Anbetracht ihrer Größe. Wenn die Thiere in ihrem Käfige hin- und herrannten, ließen sie oft einen schrillenden Laut hören, nicht unähnlich dem Schwirren des Heuschreckenrohrsängers. In ihrem Wassernapfe vergnügten sie sich durch Ein- und Ausgehen und Baden, wobei sie sich oft halb und halb unter der Oberfläche hin- und herwälzten. Obgleich vollkommen ausgesöhnt mit ihrer Gefangenschaft, bekundeten sie doch nicht die geringste Anhänglichkeit oder Zahmheit, bissen im Gegentheile heftig zu, wenn sie berührt wurden. So lebten sie mehrere Monate in vollster Gesundheit, bis sie eines Tages in Abwesenheit ihres Besitzers und Pflegers die Käfigthüre offen fanden und auf Nimmerwiedersehen verschwanden.
Als Uebergangsglieder von den Spitzmäusen zu den Maulwürfen erscheinen uns die wenigen Angehörigen der zweiten Unterfamilie, Biberspitzmäuse oder Bisamrüßler ( Myogalina ) genannt. Peters betrachtet sie ihres aus 44 Zähnen bestehenden Gebisses halber als Glieder der Maulwurfsfamilie, während wir mit anderen Naturforschern in ihnen Spitzmäuse erkennen. Doch unterscheiden sie sich auch außer ihres Zahnreichthums und der ihnen eigenen Bildung der Schneidezähne nicht unwesentlich von ihren Familienverwandten. Der vordere der drei oberen Schneidezähne ist sehr groß, dreiseitig und senkrecht gestellt, während die zwei unteren stabförmigen, abgestutzten Vorderzähne nach vorne sich neigen; der Schädel ist überall knöchern geschlossen, ein Jochbein in Form eines feinen Stäbchens vorhanden; die Wirbelsäule wird gebildet aus den Hals-, 13 rippentragenden, 6 rippenlosen, 5 Kreuz- und 27 Schwanzwirbeln. Der Leib ist gedrungener als bei den übrigen Spitzmäusen, der Hals außerordentlich kurz, ebenso dick als der Leib, und von diesem nicht zu unterscheiden; die Beine, deren fünf Zehen durch eine lange Schwimmhaut mit einander verbunden werden, sind niedrig, die Hinterbeine länger als die vorderen; der Schwanz ist länglich gerundet, gegen das Ende ruderartig zusammengedrückt, geringelt und geschuppt und nur spärlich mit Haaren besetzt. Aeußere Ohren fehlen, und die Augen sind sehr klein. Das merkwürdigste am ganzen Thiere ist die Nase, welche noch eher als bei den Rohrrüßlern ein Rüssel genannt werden kann. Sie besteht aus zwei langen, dünnen, verschmolzenen, knorpeligen Röhren, welche sich durch Hülfe zwei größerer und drei kleinerer Muskeln auf jeder Seite nach jeder Richtung bewegen und zu den verschiedenartigsten Zwecken, namentlich zum Betasten aller Gegenstände, verwenden läßt. In diesem Rüssel scheinen sämmtliche übrigen Sinne vertreten zu sein, und somit ist die Biberspitzmaus als echtes Nasenthier zu betrachten. Unter der Schwanzwurzel liegt eine Moschusdrüse, welche aus zwanzig bis vierzig Säckchen besteht, deren jedes einen oben bauchigen und einen unten schmäleren Theil hat und in der Wandung viele Drüsenschläuche enthält. Die aus diesen Drüsen stammende Absonderung riecht auffallend stark.
Bis jetzt kennt man bloß zwei Arten der Unterfamilie und Sippe, welche beide im südlichen Europa zu finden sind; eine von ihnen bewohnt die Pyrenäenkette und ihre Ausläufer, die andere Südrußland. Erstere, die Bisamspitzmaus, » Almizilero« (Moschusthier) der Spanier ( Myogale pyrenaica ), ein Thier von 25 Centim. Gesammtlänge, von welcher etwa die Hälfte auf den Schwanz kommt, ist oben kastanienbraun, an den Seiten braungrau, am Bauche silbergrau, an den Seiten des Rüssels weißlich, am Schwanze dunkelbraun mit weißen Härchen, die Vorderpfoten sind bräunlich behaart, die hinteren nackt und beschuppt.
Man glaubte anfänglich, daß diese Art bloß auf die Pyrenäen beschränkt sei; doch haben sie Graëlls und mein Bruder auch in der Sierra de Gredos aufgefunden, und geht hieraus hervor, daß ihr Heimatskreis sich wohl über den ganzen Norden Spaniens erstrecken mag.
Der Desman oder Wuchuchol ( Myogale moschata, Castor und Sorex mochatus, M. moscovitica) unterscheidet sich von dem spanischen Verwandten zunächst durch seine Größe; denn seine Gesammtlänge beträgt bis 42 Centim., wovon auf den Leib 25 Centim., auf den Schwanz 17 Centim. kommen. Die Augen sind klein, die Ohröffnungen dicht mit Haaren bedeckt, die Nasenöffnungen durch eine Warze verschließbar, die Pfoten kahl, auf der Oberseite fein geschuppt, unten genetzt, am äußeren Rande mit Schwimmborsten besetzt. Der aus sehr glatten Grannen und äußerst weichen Wollhaaren bestehende Pelz ist oberseits röthlichbraun, unterseits weißlich aschgrau, silbern glänzend.
Der Desman bewohnt den Südosten Europas und zwar hauptsächlich die Flußgebiete der Ströme Wolga und Don, findet sich jedoch auch in Asien und zwar in der Bucharei. Sein Leben ist an das Wasser gebunden, und nur höchst ungern unternimmt er kleine Wanderungen von einem Bache zum anderen. Ueberall, wo er vorkommt, ist er häufig.
Sein Leben ist sehr eigenthümlich, dem des Fischotters ähnlich. Es verfließt halb unter der Erde, halb im Wasser. Stehende oder langsam fließende Gewässer mit hohen Ufern, in denen er leicht Gänge sich graben kann, sagen ihm am meisten zu. Hier findet man ihn einzeln oder paarweise in großer Anzahl. Die Röhren sind künstlich und ebenfalls nach Art des Fischotterbaues angelegt. Unterhalb der Oberfläche des Wassers beginnt ein schief nach aufwärts steigender Gang, welcher unter Umständen eine Länge von sechs Meter und darüber erreichen kann; dieser führt in einen Kessel, welcher regelmäßig anderthalb bis zwei Meter über dem Wasserspiegel und jedenfalls über dem höchsten Wasserstande liegt, somit auch unter allen Umständen trocken bleibt. Ein Luftgang nach oben hin findet sich nicht; demungeachtet ist die Angabe, daß der Desman im Winter oft in seinen Bauen ersticken müsse, eine Unwahrheit.

Desman ( Myogale moschata). 1/2 natürl. Größe.
Als vortrefflicher Schwimmer und Taucher bringt der Desman den größten Theil seines Lebens im Wasser zu, und nur, wenn Ueberschwemmungen ihn aus seinen unterirdischen Gängen vertreiben, betritt er die Oberfläche der Erde; aber selbst dann entfernt er sich nur gezwungen auf kurze Strecken von dem Wasser. Hier treibt er sich Tag und Nacht, Sommer und Winter umher; denn auch wenn Eis die Flüsse deckt, geht er seinem Gewerbe nach und zieht sich bloß, wenn er gesättigt und ermüdet ist, nach seiner Höhle zurück, deren Mündung immer so tief angelegt wird, daß selbst das dickste Eis sie nicht verschließen kann. Seine Nahrung besteht aus Blutegeln, Würmern, Wasserschnecken, Schnaken, Wassermotten und Larven anderer Kerbthiere. Die Fischer sagen freilich, daß er Wurzeln und Blätter vom Kalmus fresse, haben sich aber zu solchem Glauben nur von dem Umstande verleiten lassen, daß er gerade diese Pflanze als vorzügliche Jagdgebiete besonders oft nach Beute absucht.
So plump und unbeholfen der Desman erscheint, so behend und gewandt ist er. Sobald das Eis aufgeht, sieht man ihn in dem Schilfe und in dem Gesträuch des Ufers unter dem Wasser umherlaufen, sich hin- und herwenden, mit schnellen Bewegungen des Rüssels Gewürm suchen und oft, um zu athmen, an die Oberfläche kommen. Bei heiterem Wetter spielt er im Wasser und sonnt sich am Ufer. Den Rüssel krümmt er nach allen Seiten, tastet auch geschickt mit ihm. Oft steckt er ihn in das Maul und läßt dann schnatternde Töne hören, welche denen einer Ente ähneln. Reizt man ihn oder greift man ihn an, so pfeift und quiekt er wie eine Spitzmaus, sucht sich auch durch Beißen zu vertheidigen. Mit dem Rüssel vermag er, wie man an Gefangenen beobachtet hat, sehr hübsch und geschickt Regenwürmer und andere kleine Thiere zu erhaschen und sie nach Elefantenart in das Maul zu schieben. Im Trocknen wird er sehr unruhig und sucht zu entkommen; sobald er dann in das Wasser gelangt, scheint er sich wahrhaft beglückt zu fühlen und wälzt sich vor Vergnügen hin und her.
Man kann den Desman ziemlich leicht fangen, zumal im Frühlinge und zur Zeit der Begattung, wenn beide Geschlechter mit einander spielen. In einem großen Netze, welches man durch das Wasser zieht, findet man regelmäßig mehrere verwickelt. Aber man muß dabei natürlich die Vorsicht gebrauchen, immer nur kürzere Strecken auf einmal durchzufischen, damit die Thiere, welche durch die Netze in ihren Bewegungen gehindert werden, nicht unter dem Wasser ersticken. In Reußen und Netzen, welche die Fischer ausstellen, werden viele von ihnen aufgefunden, welche auf diese Weise ums Leben gekommen sind. Im Herbste betreibt man eine förmliche Jagd auf das Thier, weil um diese Zeit seine Jungen erwachsen sind und die Ausbeute dann ergiebig wird.
Ueber die Fortpflanzung und die Anzahl der Jungen des Desman ist bis jetzt noch nichts sicheres bekannt; doch scheint es, daß er sich ziemlich zahlreich vermehrt: hierfür sprechen mindestens die acht Zitzen, welche man am Weibchen findet. Wie häufig das Thier sein muß, geht daraus hervor, daß man die Felle, welche man zur Verbrämung der Kappen und Hauskleider verbraucht, nur mit einem oder zwei Kreuzern unseres Geldes bezahlt. Im Winter werden aus unbekannten Gründen meistens Männchen, selten Weibchen, gefangen, im Sommer dagegen nur wenige Männchen.
Pallas ist der einzige Forscher, welcher über den freilebenden wie auch über den gefangenen Desman Mittheilungen macht. Das Thier hält stets nur sehr kurze Zeit in der Gefangenschaft aus, selten länger als drei Tage; doch glaubt genannter Forscher, daß dies wohl in der üblen Behandlung liegen möchte, welche der Wuchuchol beim Fange seitens der Fischer erleiden muß. Wenn man ihm in sein Behältnis Wasser gießt, zeigt er eine besondere Lust, schmatzt, wäscht den Rüssel und schnuppert dann umher. Läßt man den unruhigen Gesellen gehen, so wälzt er sich unaufhörlich von einer Seite auf die andere, und indem er sich auf die Sohle der einen Seite stützt, kämmt und kratzt er sich so schnell, als mache er es mit zitternder Bewegung. Die Sohlen sind wunderbar gelenkig und können selbst die Lenden erreichen, der Schwanz dagegen bewegt sich wenig und wird fast immer wie eine Sichel gebogen. Der Desman ergreift alle ihm zugeworfene Beute hastig mit dem Rüssel, wie mit einem Finger, und schiebt sie sich ins Maul, schnüffelt auch nach allen Seiten hin beständig umher und scheint dieselbe Unersättlichkeit zu besitzen wie andere Mitglieder seiner Familie. Abends begibt er sich zur Ruhe und liegt dann mit zusammengezogenem Leibe, die Vorderfüße auf einer Seite, den Rüssel nach unten, fast unter den Arm gebogen, auf der flachen Seite. Aber auch im Schlafe ist er unruhig und wechselt oft den Platz. Nach sehr kurzer Zeit wird das Wasser von seinem Unrathe und der Aussonderung der Schwanzdrüsen stinkend und muß deshalb beständig erneuert werden. So angenehm er durch seine Beweglichkeit und Lebendigkeit ist, so unangenehm wird ein gefangener durch den Moschusgeruch, welcher so stark ist, daß er nicht nur das ganze Zimmer füllt und verpestet, sondern sich auch allen Thieren, welche jenen fressen, mittheilt und förmlich einprägt.
Wie es scheint, hat der Desman weder unter den Säugethieren, noch unter den Vögeln viele Feinde: um so eifriger aber stellen ihm die großen Raubfische und namentlich die Hechte nach. Solche Uebelthäter sind zu erkennen; denn sie stinken so fürchterlich nach Moschus, daß sie vollkommen ungenießbar geworden sind. Der Mensch verfolgt das schmucke Thier seines Felles wegen, welches dem des Bibers und der Zibetratte so ähnelt, daß sich Linné verleiten ließ, den Desman als Castor moschatus oder » Moschusbiber« unter die Nager zu stellen.
Borstenigel ( Centetina ) heißen, einem auf Madagaskar lebenden, igelähnlichen Kerbthierfresser zu Liebe, die Mitglieder der fünften Familie unserer Ordnung. In ihrer äußeren Erscheinung haben die Borstenigel ebensowenig mit einander gemein wie in der Anzahl der Zähne ihres Gebisses. Sie sind gestreckt gebaut, langköpfig und durch einen ziemlich langen Rüssel ausgezeichnet, haben kleine Augen und mittelgroße Ohren, keinen oder einen langen, nackten Schwanz, kurze Beine und fünfzehige mit starken Krallen bewehrte Füße und tragen ein theils aus Stachelborsten, theils aus steifen Haaren bestehendes Kleid. Dem Schädel fehlt der Jochbogen; die Unterschenkelknochen sind getrennt; die Wirbelsäule wird zusammengesetzt aus 7 Hals-, 14 bis 15 rippentragenden, 4 bis 7 rippenlosen-, 3 bis 5 Kreuz- und 9 bis 23 Schwanzwirbeln. Der einfache Darm hat keinen Blinddarm.
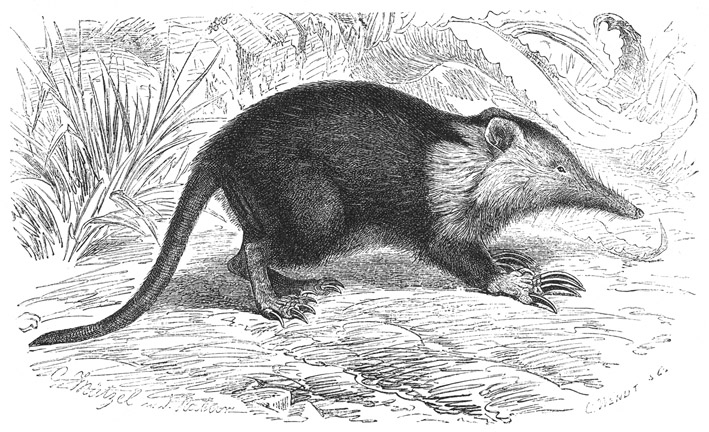
Almiqui ( Solenodon cubanus). 1/2 natürl. Größe.
Etwas allgemeines über die Lebensweise der verschiedenen Glieder dieser Familie läßt sich kaum sagen, weil wir nur über wenige Arten einigermaßen eingehende Mittheilungen erhalten haben. So muß es genügen, wenn ich im nachstehenden zwei Arten zu schildern versuche.
Die Sippe der Schlitzrüßler ( Solenodon) kennzeichnet sich durch folgende Merkmale. Der Leib ist kräftig, der Hals kurz, der Kopf gestreckt, der Nasentheil in einen langen Rüssel ausgezogen, das Auge sehr klein, das rundliche Ohr mittelgroß, der Schwanz körperlang; die Beine sind mittelhoch, die fünfzehigen Füße vorn mit sehr starken und stark gebogenen, hinten mit kürzeren und schwächeren Krallen bewehrt. Ein ziemlich langes Borstenkleid deckt den Leib, bekleidet aber den Rüssel nur spärlich, geht auf den Beinen in feineres Haar über und läßt Oberrücken und Gesäß wie den schuppigen Schwanz fast vollständig nackt. Das Gebiß besteht aus 40 Zähnen, und zwar zwei Schneidezähnen, einem Eckzahne, vier Lück- und drei Backenzähnen in jedem Kiefer.
Eine von Peters genau beschriebene Art der Sippe, der Almiqui, Tacuache, Aedarás und wie er sonst noch genannt wird ( Solenodon cubanus), hat eine Leibeslänge von 34 Centim., eine Schwanzlänge von 19 Centim. und am Kopfe, dem Seitenhalse und Bauche schmutzig ockergelbe, übrigens schwarze, der Schwanz bläulichschwarze Färbung. Unter den langen Rückenhaaren sind einige ganz gelb, andere ganz schwarz, die meisten aber gelb an der Wurzel und schwarz an der Spitze.
Ueber die Lebensweise hat Peters mehrere Mittheilungen zusammengestellt. Wie die eigentlichen Spitzmäuse, ist auch dieses Thier ein nächtlich lebendes; wahrend des Tages schläft es in irgend einem Verstecke, nachts treibt es sich außen umher. In manchen Gebirgen soll es ziemlich häufig sein. Verfolgt es der Jäger, so soll es den Kopf verstecken, in der Meinung, sich dadurch zu verbergen, und so ruhig liegen bleiben, daß man es am Schwanze ergreifen kann. In der Gefangenschaft weigert es sich gar nicht, ans Futter zu gehen; da es aber schwer kaut, muß man ihm feingeschnittenes Fleisch vorlegen, damit es nicht etwa ersticke. Reinlichkeit ist zu seinem Wohlbefinden unumgängliche Bedingung; gern stürzt es sich ins Wasser und scheint sich hier angenehm zu unterhalten; dabei trinkt es denn auch mit größerer Leichtigkeit, während ihm sonst die lange Rüsselspitze hier hinderlich ist. Seine durchdringende Stimme erinnert bald an das Grunzen des Schweines, bald an das Geschrei eines Vogels. Zuweilen schreit das Thier wie ein Käuzchen; beim Berühren grunzt es wie die Ferkelratte. Es wird sehr leicht zornig und sträubt dann das Haar in eigenthümlicher Weise. Ein vorübergehendes Huhn oder anderes kleines Thier erregt es aufs höchste, und es versucht wenigstens, sich desselben zu bemächtigen. Die erfaßte Beute zerreißt es mit den langen, krummen Krallen wie ein Habicht. Dann und wann ergießt sich aus seiner Haut eine röthliche, ölige, übelriechende Flüssigkeit.
Die Gefangenen, welche ein Herr Corona hielt, starben theils an den Wunden, welche sie einander durch Beißen zufügten, theils an einer eigenthümlichen Wurmkrankheit. Einige von diesen zeigten sich ganz voll von Würmern, welche sich zwischen dem Bindegewebe und den Muskeln, besonders am Halse, wie in einen weichen Sack eingehüllt, in ungeheurer Menge fanden.
Die Borstenigel ( Cetentes) unterscheiden sich durch das Fehlen eines äußerlich sichtbaren Schwanzes von den Schlitzrüßlern und durch ihre im Verhältnis zu den übrigen außerordentlich großen und in eine Grube des Oberkiefers aufgenommenen unteren Eckzähne von allen Kerbthierfressern überhaupt. Das Gebiß besteht, wie bei den Familienverwandten, aus 40 Zähnen; es sind jedoch drei Schneide- und nur sechs Backenzähne vorhanden. An dem schlanken Leibe des Tanrek ( Centetes ecaudatus, Erinaceus ecaudatus, C. setosus, armatus und variegatus), der bekanntesten Art der Sippe, sitzt der sehr lange Kopf, welcher etwa ein Drittel der ganzen Körperlänge einnimmt, hinten besonders dick ist, nach vornhin aber sich verschmälert; die rundlichen Ohren sind kurz und hinten ausgebuchtet, die Augen klein; der Hals ist kurz und dünner als der Leib, aber wenigstens einigermaßen abgesetzt; die Beine sind mittelhoch, die hinteren nur wenig länger als die vorderen, die Füße fünfzehig, die Krallen mittelstark. Der ganze Körper ist ziemlich dicht mit Stacheln, Borsten und Haaren bedeckt, welche gewissermaßen in einander übergehen oder wenigstens deutlich zeigen, daß der Stachel bloß eine Umänderung des Haares ist. Nur am Hinterkopfe, im Nacken und an den Seiten des Halses finden sich wahre, wenn auch nicht sehr harte, etwas biegsame Stacheln von ungefähr 1 Centim. Länge. Weiter gegen die Seiten hin werden die Stacheln länger, zugleich aber auch dünner, weicher und biegsamer; auf dem Rücken überwiegen die Borsten bei weitem, hüllen auch das Hintertheil des Tanrek vollkommen ein. Die ganze untere Seite und die Beine werden von Haaren bekleidet, und auf der nackten, spitzigen Schnauze stehen lange Schnurren. Die Schnauzenspitze und die Ohren sind nackt, die Füße bloß mit kurzen Haaren bedeckt. Stacheln, Borsten und Haare sind hellgelb gefärbt, bisweilen lichter, bisweilen dunkler, sämmtliche Gebilde aber in der Mitte schwarzbraun geringelt, und zwar auf dem Rücken mehr als an den Seiten. Das Gesicht ist braun, die Füße sind rothgelb, die Schnurren dunkelbraun gefärbt. Junge Thiere zeigen auf braunem Grunde gelbe Längsbänder, welche bei zunehmendem Alter verschwinden. Die Länge des erwachsenen Thieres beträgt ungefähr 25 Centim.

Tanrek ( Centetes ecaudatus). [2/5] natürl. Größe.
Der Tanrek, ursprünglich nur auf Madagaskar heimisch, aber auch auf der Moritzinsel, Mayotte und Reunion eingebürgert, bewohnt mit Vorliebe busch-, farn- und moosreiche Berggegenden und gräbt hier Höhlen und Gänge in die Erde, welche seine Schlupfwinkel bilden. Er ist ein scheues, furchtsames Geschöpf, welches den größten Theil des Tages in tiefster Zurückgezogenheit lebt, bloß nach Sonnenuntergang zum Vorscheine kommt, ohne sich jemals weit von seiner Höhle zu entfernen. Nur im Frühlinge und im Sommer jener Länder, d. h. nach dem ersten Regen und bis zum Eintritte der Dürre, zeigt er sich. Wahrend der größten Trockenheit, welche, wie ich schon wiederholt bemerkt habe, unserem Winter zu vergleichen ist, zieht er sich in den tiefsten Kessel seines Baues zurück, hier die Monate April bis November in ähnlicher Weise wie unser Igel den Winter verschlafend. Die Eingeborenen glauben, daß die heftigen Donnerschläge, welche die ersten Regen verkünden, ihn aus seinem Todtenschlafe erwecken, und bringen ihn deshalb auf eine geheimnisvolle Weise mit dem wiederkehrenden Frühlinge in Beziehung. Dieser ist für den Tanrek allerdings die günstigste Zeit des ganzen Jahres. Er bekommt zunächst ein neues Kleid und hat dann die beste Gelegenheit, für die dürren Monate ein Schmerbäuchlein sich anzumästen, dessen Fett ihm in der Hungerszeit das Leben erhalten muß. Sobald also der erste Regen die verdurstete Erde angefeuchtet und das Leben des tropischen Frühlings wachgerufen hat, erscheint er wieder, läuft langsamen Ganges mit zu Boden gesenktem Kopfe umher und schnuppert mit seiner spitzigen Nase bedächtig nach allen Seiten hin, um seine Nahrung zu erspähen, welche zum größten Theile aus Kerfen, sonst aber auch aus Würmern, Schnecken und Eidechsen sowie verschiedenen Früchten besteht. Für das Wasser scheint er eine besondere Vorliebe zu haben, steigt in der Nacht gern in seichte Lachen und wühlt dort mit Lust nach Schweineart im Schlamme. Seine geringe Gewandtheit und die Trägheit seines Ganges bringt ihn leicht in die Gewalt seiner Feinde, um so mehr, als ihm nicht einmal ein gleiches Mittel zur Abwehr gegeben ist wie den eigentlichen Igeln. Seine einzige, aber schwache Waffe besteht in einem höchst unangenehmen, moschusartigen Gestank, den er beständig verbreitet und, wenn er gestört oder erschreckt wird, merklich steigern kann. Selbst ein plumpes Säugethier ist fähig, ihn zu fangen und zu überwältigen; die Raubvögel stellen ihm eifrig nach, und die Eingeborenen seiner heimatlichen Inseln jagen ihn mit Leidenschaft, ebensowohl während seines Sommerlebens wie in der Zeit seines Winterschlafes. Laut Pollen erkennt man sein Winterlager an einem kleinen Hügel über der Höhlung, benutzt auch wohl besonders abgerichtete Hunde, welche ihm nachspüren und ausgraben. Während der Feistzeit sieht man auf den Märkten der Insel überall lebende, abgeschlachtete und zubereitete Borstenigel, und die Bewohner der Gebirge erscheinen an Feiertagen einzig und allein deshalb in der Stadt, um sich mit dem nach ihrer Meinung kostbaren Fleische zu versorgen. Wahrscheinlich würde er den unausgesetzten Verfolgungen bald erliegen, wäre er nicht ein so fruchtbares Thier, welches mit einem Wurfe eine ungemein zahlreiche Nachkommenschaft, zwölf bis sechszehn Junge nämlich, zur Welt bringt. Diese erreichen schon nach einigen Monaten eine Länge von sieben Zentimeter und sind sehr bald befähigt, ihre Nahrung auf eigne Faust sich zu erwerben. »Die Mutterliebe der Alten«, sagt Pollen, »ist wirklich bewunderungswürdig. Sie vertheidigt die Jungen wüthend gegen jeden Feind, und gibt sich eher dem Tode Preis, als sie zu verlassen.«
In der Gefangenschaft frißt der Tanrek rohes Fleisch, gekochten Reis und Bananen. Den Tag verschläft er, nachts dagegen ist er sehr munter. Wenn man ihm Erde gibt, durchwühlt er dieselbe mit seinem Rüssel wie ein Schwein, wälzt sich auch gern auf ihr umher. Mittels seiner starken Krallen versucht er, den Käfig zu zerbrechen, kommt auch manchmal zum Ziele. Mit anderen seiner Art streitet er sich oft, zumal um die Nahrung. So viel mir bekannt, hat man ihn lebend noch nicht nach Europa gebracht.
Die Igel ( Erinacei ), welche die sechste Familie bilden, sind so ausgezeichnete Thiere, daß auch die kürzeste Beschreibung genügt, sie zu kennzeichnen. Ein aus 36 Zähnen bestehendes Gebiß und ein Stachelkleid sind die wichtigsten Merkmale der wenigen Arten, welche wir als wirkliche Angehörige der Familie betrachten. Alle Igel haben gedrungen gebauten Leib, nicht besonders langen, obgleich am Schnauzentheile zu einem Rüssel ausgezogenen Kopf, mit mäßig großen Augen und ziemlich großen Ohren, kurze und dicke Beine mit plumpen Füßen, deren vordere stets fünf und deren hintere meist ebensoviele, ausnahmsweise vier Zehen tragen, einen kurzen Schwanz und ein starres, oberseits aus kurzen Stacheln, unterseits aus Haaren bestehendes Kleid. Von ihren Ordnungsverwandten unterscheidet sie bestimmt das Gebiß. »In dem breiten Zwischenkieferknochen«, beschreibt Blasius, »stehen oben jederseits drei, in der Mitte durch eine Lücke getrennte, einwurzelige Vorderzähne; dann folgen zwei einspitzige zweiwurzelige Lückzähne und auf diese ein zweisitziger, dreiwurzeliger kleinerer Zahn, auf ihn drei vielhöckerige und vielwurzelige Backenzähne und zuletzt ein querstehender, zweihöckeriger und zweiwurzeliger Backenzahn. Im Unterkiefer reihen sich an den großen Vorderzahn jederseits drei einspitzige, einwurzelige, darauf drei vielhöckerige zweiwurzelige Backenzähne und zuletzt ein kleiner einwurzeliger Backenzahn. Eckzähne sind nicht vorhanden.« An dem kurzen und gedrungenen, allseitig verknöcherten Schädel ist der Jochbogen vollständig. Die Wirbelsäule besteht außer den Halswirbeln aus 15 rippentragenden, 9 rippenlosen, 3 Kreuz- und 14 Schwanzwirbeln. Die Unterschenkelknochen sind verwachsen. Unter den Muskeln verdient der Hautmuskel, welcher das Zusammenrollen des Igels bewerkstelligt und mit seinen verschiedenen Theilen fast den ganzen Leib umgibt, besonderer Erwähnung.
Die Familie verbreitet sich über Europa, Afrika und Asien. Wälder und Auen, Felder und Gärten, ausgedehnte Steppen sind die hauptsächlichsten Aufenthaltsorte ihrer Glieder. Hier schlagen die Igel in den dichtesten Gebüschen, unter Hecken, hohlen Bäumen, Wurzeln, im Felsengeklüft, in verlassenen Thierbauen und an anderen Orten ihren Wohnsitz auf oder graben sich selbst kurze Höhlen. Sie leben den größten Theil des Jahres hindurch einzeln oder paarweise und führen ein vollkommen nächtliches Leben. Erst nach Sonnenuntergang ermuntern sie sich von ihrem Tagesschlummer und gehen ihrer Nahrung nach, welche bei den meisten in Pflanzen und Thieren, bei einigen aber ausschließlich in letzteren besteht. Früchte, Obst und saftige Wurzeln, Samen, kleine Säugethiere, Vögel, Lurche, Kerfe und deren Larven, Nacktschnecken, Regenwürmer etc. sind die Stoffe, mit welchen die freigebige Natur ihren Tisch deckt. Ausnahmsweise wagen sich einzelne auch an größere Thiere, stellen z. B. den Hühnerarten oder jungen Hasen nach. Sie sind langsame, schwerfällige und ziemlich träge, auf den Boden gebannte Kerfjäger, welche beim Gehen mit der ganzen Sohle auftreten. Unter ihren Sinnen steht der Geruch oben an; aber auch das Gehör ist scharf, während Gesicht und Geschmack sehr wenig ausgebildet sind und das Gefühl eine Stumpfheit erreicht, welche gerade ohne Beispiel dasteht. Die geistigen Fähigkeiten stellen die Igel ziemlich tief. Sie sind furchtsam, scheu und dumm, aber ziemlich gutmüthig oder besser gleichgültig gegen die Verhältnisse, in denen sie leben, und deshalb leicht zu zähmen. Die Mütter werfen drei bis acht blinde Junge, pflegen sie sorglich und zeigen bei der Verteidigung derselben sogar einen gewissen Grad von Muth, welcher ihnen sonst gänzlich abgeht. Die meisten haben die Eigenthümlichkeit, sich bei der geringsten Gefahr in eine Kugel zusammenzurollen, um auf diese Weise ihre weichen Theile gegen etwaige Angriffe zu schützen. In dieser Stellung schlafen sie auch. Die, welche in den nördlichen Gegenden wohnen, bringen die kalte Zeit in einem ununterbrochenen Winterschlafe zu, und diejenigen, welche unter den Wendekreisen wohnen, schlafen während der Zeit der Dürre.
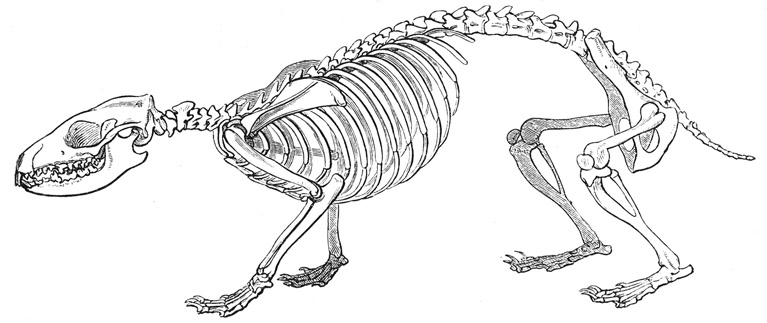
Geripp des Igels. (Aus dem Berliner anatomischen Museum).
Der unmittelbare Nutzen, welchen sie den Menschen bringen, ist gering. Gegenwärtig wenigstens weiß man aus einem erlegten Igel kaum noch etwas zu machen. Größer aber wird der mittelbare Nutzen, welchen sie durch Vertilgung einer Masse schädlicher Thiere leisten. Aus diesem Grunde verdienen sie, anstatt der sie gewöhnlich treffenden Verachtung, unsere vollste Theilnahme und den ausgedehntesten Schutz.
Wenn an den ersten warmen Abenden, welche der junge, lachende Frühling bringt, Alt und Jung hinausströmt, um sich in den während des Winters verwaisten und nun neu erwachenden Gärten, Hainen und Wäldchen neue Lebensfrische zu holen, vernimmt der Aufmerksamere vielleicht ein eigenthümliches Geräusch im trockenen, abgefallenen Laube, gewöhnlich unter den dichtesten Hecken und Gebüschen, wird auch, falls er hübsch ruhig bleiben will, bald den Urheber dieses Lärmens entdecken. Ein kleiner, kugelrunder Bursche, mit merkwürdig rauhem Pelze, arbeitet sich aus dem Laube hervor, schnuppert und lauscht und beginnt sodann seine Wanderung mit gleichmäßig trippelnden Schritten. Kommt er näher, so bemerkt man ein sehr niedliches, spitzes Schnäuzchen, gleichsam eine nette Wiederholung des gröberen und derberen Schweinsrüssels vorstellend, ein Paar klare, freundlich blickende Aeuglein und einen Stachelpanzer, welcher die ganzen oberen Theile des Leibes bedeckt, ja auch an den Seiten noch weit herabreicht. Das ist unser, oder ich will eher sagen mein lieber Gartenfreund, der Igel, ein zwar beschränkter, aber gemüthlicher, ehrlicher, treuherziger Gesell, welcher harmlos in das Leben schaut und nicht begreifen zu können scheint, daß der Mensch so niederträchtig sein kann, ihn, welcher sich so hohe Verdienste um das Gesammtwohl erwirbt, nicht nur mit allerlei Schimpfnamen zu belegen, sondern auch nachdrücklich zu verfolgen, ja aus reiner Bubenmordlust sogar todtzuschlagen. Man muß das Entsetzen gesehen haben, mit welchem eine Gesellschaft von Frauen aufspringt, wenn sich plötzlich der Stachelheld zwischen sie drängt oder auch nur von ferne zeigt. Sie thun gerade, als wäre dies ein Feind, welcher das Leben bedrohen oder ihnen wenigstens Verletzungen beibringen könnte, an denen sie jahrelang zu leiden hätten! Keine einzige der aufschreienden aber hat sich jemals die Mühe genommen, das Thier selbst zu beobachten. Hätte sie dies gethan, so würde sie bemerkt haben, daß der scheinbar so muthig auf den Menschen zutrabende Held, sobald er sich von der Nähe des gefährlichen Feindes überzeugt hat, im höchsten Entsetzen einen Augenblick lang stutzt, die Stirne runzelt und plötzlich, Gesicht und Beine an den Leib ziehend, zu einer Kugel sich zusammenrollt und in dieser Stellung verharrt, bis die vermeintliche Gefahr vorüber ist. Der Harmlose ist froh, wenn er selbst nicht behelligt wird und geht gern jedem größeren Thiere, und zumal dem Menschen, aus dem Wege.

Igel ( Erinaceus europaeus) [1/3] natürl. Größe.
Unser Igel ( Erinaceus europaeus) ist bald beschrieben. Der ganze Körper mit all seinen Theilen ist sehr gedrungen, dick und kurz, der Rüssel spitzig und vorn gekerbt, der Mund weit gespalten; die Ohren sind breit, die schwarzen Augen klein. Wenige schwarze Schnurren stehen im Gesichte unter den weiß- oder rothgelb, an den Seiten der Nase und Oberlippe aber dunkelbraun gefärbten Haaren; hinter den Augen liegt ein weißer Fleck. Das Haar am Halse und Bauche ist lichtrothgelblichgrau oder weißgrau; die Stacheln sind gelblich, in der Mitte und an der Spitze dunkelbraun; in ihre Oberfläche sind feine Längsfurchen, 24 bis 25 an der Zahl, eingegraben, zwischen denen sich gewölbte Leisten erheben; das Innere zeigt eine mit großen Zellen erfüllte Markröhre. Die Länge des Thieres beträgt 25 bis 30 Centim., die des Schwanzes 2,5 Centim., die Höhe am Widerrist ungefähr 12 bis 15 Centim. Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen außer seiner etwas bedeutenderen Größe durch spitzigere Schnauze, stärkeren Leib und lichtere, mehr grauliche Färbung; auch ist die Stirn bei ihm gewöhnlich nicht so tief herab mit Stacheln besetzt, und der Kopf erscheint hierdurch etwas länger. An den meisten Orten unterscheiden die Leute zwei Abarten des Igels: den Hundsigel, welcher eine stumpfere Schnauze, dunklere Färbung und geringere Größe haben soll, und den Schweinsigel, dessen hauptsächlichste Kennzeichen in der spitzigeren Schnauze, der helleren Färbung und der bedeutenderen Größe liegen sollen. Diese Unterschiede beruhen offenbar bloß auf zufälligen Eigenthümlichkeiten; auch sind die Ansichten der so fein unterscheidenden naturkundigen Alleswisser keineswegs dieselben, und wenn man der Sache genau auf den Grund geht, wird man regelmäßig mit geheimnisvollen Bemerkungen abgespeist, aus denen, trotz aller Bemühungen, kein Sinn zu entnehmen ist. »Ich erinnere mich noch sehr wohl«, sagt Vogt, »daß mir die Bauern in der Wetterau, in dem Geburtsdorfe meines Vaters, wo wir gewöhnlich die Ferien zubrachten, mit Abscheu von den Franzosen erzählten, sie hätten sogar Hundsigel am Spieße gebraten und mit großer Befriedigung verzehrt. Wir suchten damals alle Igel zusammen, deren wir habhaft werden konnten, um den Unterschied kennen zu lernen: der alte Bauer aber, welcher unser Orakel war, erklärte sie insgesammt für uneßbare Hundsigel und fügte endlich mit boshaftem Lächeln hinzu, daß die Schweinsigel wohl viel eher an anderen Orten als im Felde zu finden seien.«
Das Verbreitungsgebiet des Igels erstreckt sich nicht bloß über ganz Europa, mit Ausnahme der kältesten Länder, sondern auch über den größten Theil von Nordasien: man findet ihn in Syrien wie in West- und Südostsibirien, und zwar in einem Zustande, welcher von großer Behäbigkeit zeigt; denn er erlangt dort wie in der Krim eine viel bedeutendere Größe als bei uns. In den europäischen Alpen kommt er bis zum Krummholzgürtel, einzeln bis über 2000 Meter über dem Meere vor, im Kaukasus steigt er noch um tausend Meter höher empor. Er findet sich ebensowohl in flachen wie in bergigen Gegenden, in Wäldern, Auen, Feldern, Gärten, und ist in ganz Deutschland eigentlich nirgends selten, aber auch nirgends häufig. Weit zahlreicher tritt er in Rußland auf, wo er, wie es scheint, besonders geschont wird, und Fuchs und Uhu, seine Hauptfeinde aus dem Thierreiche, so viele andere Nahrung haben, daß sie ihn in Frieden lassen können. Laubholz mit dichtem Gebüsch oder faule, an der Wurzel ausgehöhlte Bäume, Hecken in Gärten, Haufen von Mist und Laub, Löcher in Umhegungsmauern, kurz Orte, welche ihm Schlupfwinkel gewähren, wissen ihn zu fesseln, und hier darf man auch mit ziemlicher Sicherheit darauf rechnen, ihn jahraus jahrein zu finden. Will man ihn hegen und pflegen, so muß man sein hauptsächlichstes Augenmerk auf Anlegung derartiger Zufluchtsorte richten. »Früher«, sagt Lenz, »hatte ich in meinem Garten mit Stroh gefüllte, in Abtheilungen gebrachte und mit niederen Gängen versehene Häuschen für die Igel, stellte ihnen auch Milch zum Trinken hin und kaufte zu ihrer Vermehrung neue. Sie zogen aber meinen Zaun und noch mehr einen großen, aus Reisich und Dornen aufgebauten Haufen vor, und durch das Anschaffen neuer brachte ich gar keine Vermehrung zu Stande, wahrscheinlich weil sie, ihre Heimat suchend, entflohen. Später habe ich in dem genannten Garten ein zweihundert Schritt langes Wäldchen angelegt, dessen Buschwerk dicht in einander schließt und wo alle geringen Lücken jährlich mit Dornen beworfen werden, so daß sich weder ein Mensch, noch ein Hund darin herumtreiben kann. Hier steht eine Anzahl Kästchen, welche unten und an einer Seite offen sind und den Igeln eine gute Winterherbcrge geben. Dieses Wäldchen behagt ihnen gar sehr, und neben
ihnen tummeln sich Drosseln, Rothkehlchen, Zaunkönige, Goldammern und Grasmücken lustig herum. Ich möchte anrathen, da, wo es angeht, ähnliche Schlupfwinkel für den unschuldig Geächteten anzulegen. Aus dem folgenden mag hervorgehen, warum.
Der Igel ist ein drolliger Kauz und dabei ein guter, furchtsamer Gesell, welcher sich ehrlich und redlich, unter Mühe und Arbeit durchs Leben schlägt. Wenig zum Gesellschafter geeignet, findet er sich fast stets allein oder höchstens in Gemeinschaft mit seinem Weibchen. Unter den dichtesten Gebüschen, unter Reisichhaufen oder in Hecken hat sich jeder einzeln sein Lager aufgeschlagen und möglichst bequem zurechtgemacht. Es ist ein großes Nest aus Blättern, Stroh und Heu, welches in einer Höhle oder unter dichtem Gezweige angelegt wird. Fehlt es an einer schon vorhandenen Höhle, so gräbt er sich mit vieler Arbeit eine eigne Wohnung und füttert diese aus. Sie reicht etwa 30 Centim. tief in die Erde und ist mit zwei Ausgängen versehen, von denen der eine in der Regel nach Mittag, der andere gegen Mitternacht gelegt ist. Allein diese Thüren verändert er wie das Eichhorn, zumal bei heftigem Nord- oder Südwinde. In hohem Getreide gräbt er sich selten eine Höhle, sondern macht sich bloß ein großes Nest. Die Wohnung des Weibchens ist fast immer nicht weit von der des Männchens, gewöhnlich in einem und demselben Garten. Es kommt wohl auch vor, daß beide Igel in der warmen Jahreszeit in ein Nest sich legen; ja zärtliche Igel vermögen es gar nicht, von ihrer Schönen sich zu trennen, und theilen regelmäßig das Lager mit ihr. Dabei spielen sie allerliebst miteinander, necken und jagen sich gegenseitig, kurz, kosen zusammen, wie Verliebte überhaupt zu thun pflegen. Wenn der Ort ganz sicher ist, sieht man die beiden Gatten wohl auch bei Tage ihre Liebesspiele und Scherze treiben, an halbwegs lauten Orten aber erscheinen sie bloß zur Nachtzeit. Man hört, wie ich oben andeutete, ein Geraschel im Laube und sieht den Igel plötzlich in schnurgerader Richtung weglaufen, trotz der schnell trippelnden Schritte langsam und ziemlich schwerfällig. Dabei schnuppert er mit der Nase wie ein Spürhund auf dem Boden und beriecht jeden Gegenstand, welchen er unterwegs trifft, sehr sorgfältig. Bei solchen Wanderungen trieft ihm beständig Speichel aus Mund und Nase, und man behauptet, daß er den Rückweg nach seiner Wohnung durch das Wittern dieser Flüssigkeit wieder auffinde. Ich glaube nicht daran, weil ich die große Ortskenntnis des Thieres oft bemerken konnte. Hört unser Stachelheld auf seinem Wege etwas verdächtiges, so bleibt er stehen, lauscht und wittert, und man sieht dabei recht deutlich, daß der Sinn des Geruchs bei weitem der schärfste ist, zumal im Vergleiche zum Gesicht. Nicht selten kommt es vor, daß ein Igel dem Jäger auf dem Anstande geradezu bis vor die Füße läuft, dann aber plötzlich stutzt, schnüffelt und nun eiligst Reißaus nimmt, falls er nicht vorzieht, sogleich seine Schutz- und Trutzwaffe zu gebrauchen, nämlich zur Kugel sich zusammenzuballen. Von der früheren Gestalt des Thieres bemerkt man sodann nichts mehr; es bildet jetzt vielmehr einen eiförmigen Klumpen, welcher an einer Seite eine Vertiefung zeigt, sonst aber ringsum ziemlich regelmäßig gerundet ist. Die Vertiefung führt nach dem Bauche zu, und in ihr liegen dicht an denselben gedrückt die Schnauze, die vier Beine und der kurze Stummelschwanz. Zwischen den Stacheln hindurch hat die Luft ungehinderten Zutritt, und somit wird es dem Igel leicht, selbst bei längerem Aushalten in seiner Stellung zu athmen. Diese Zusammenrollung verursacht ihm keine Anstrengung; denn Hautmuskeln, welche dieselbe bewirken, sind bei ihm in einer Weise ausgebildet wie bei keinem anderen Thiere und wirken gemeinschaftlich mit solcher Kraft, daß ein an den Händen gehörig geschützter Mann kaum im Stande ist, den zusammengekugelten Igel gewaltsam aufzurollen. Einem solchen Unternehmen bieten nun auch die Stacheln empfindliche Hindernisse. Während bei der ruhigen Bewegung des Thieres das Stachelkeid hübsch glatt aussieht und die tausend Spitzen, im ganzen dachziegelartig geordnet, glatt übereinander liegen, sträuben sie sich, sobald der Igel die Kugelform annimmt, nach allen Seiten hin und lassen ihn jetzt als eine furchtbare Stachelkugel erscheinen. Einem einigermaßen Geübten wird es gleichwohl nicht schwer, auch dann noch einen Igel in den Händen fortzutragen. Man setzt die Kugel in die Lage, welche das Thier beim Gehen einnehmen würde, streicht von vorn nach hinten leise die Stacheln zurück und wird nun nicht im mindesten von ihnen belästigt. Will man sich einen Spaß machen, so setzt man den Igel auf einen Gartentisch und sich still daneben, um das Aufrollen zu beobachten. Nicht leichter kann man eine größere Abwechselung in den Gesichtszügen wahrnehmen, als sie jetzt stattfindet. Obgleich der Geist natürlich sehr wenig mit diesen Veränderungen des Gesichtsausdrucks zu thun hat, sieht es doch so aus, als durchliefen das Igelgesicht in kürzester Zeit alle Ausdrücke von dem finstersten Unmuthe an bis zur größten Heiterkeit. Falls man sich ruhig verhält, denkt der zusammengerollte Igel nach geraumer Zeit daran, sich wieder auf den Weg zu machen. Ein eigenthümliches Zucken des Felles verkündet den Anfang seiner Bewegung. Leise schiebt er den vorderen und hinteren Theil des Stachelpanzers auseinander, setzt die Füße vorsichtig auf den Boden und streckt sachte das Schweineschnäuzchen vor. Noch ist die Kopfhaut dick gefaltet, und finsterer Zorn scheint auf seiner niederen Stirne sich auszudrücken; selbst das so harmlose Auge liegt unter buschigen Brauen tief versteckt. Mehr und mehr glättet sich das Gesicht, weiter und weiter wird die Nase vorgeschoben, weiter und weiter der Panzer zurückgedrückt, endlich hat man auf einmal das gemüthliche Gesicht in seiner gewöhnlichen, behäbigen oder harmlosen Ruhe vor sich, und in diesem Augenblicke beginnt auch der Igel seine Wanderung, gerade so, als ob es für ihn niemals eine Gefahr gegeben hätte. Stört man ihn jetzt zum zweiten Male, so rollt er sich blitzschnell wieder zusammen und bleibt etwas länger als das vorige Mal gekugelt. Sehr hübsch sieht es aus, wenn man von Zeit zu Zeit einen abgebrochenen, kurzen Ruf ausstößt. Der Laut berührt den Igel wie ein elektrischer Schlag; er zuckt bei jedem zusammen, auch wenn man ihm zehnmal in der Minute zuruft. Der bereits ganz an den Menschen gewöhnte Igel macht es geradeso, selbst wenn er eben beim Ausleeren einer Milchschüssel sein sollte. Wiederholt man aber die Neckerei, so kriegt er das Ding endlich satt und rollt sich entweder für eine ganze Viertelstunde lang zusammen, oder aber – gar nicht mehr, gerade als wisse er, daß man ihn doch nur foppen wolle. Anders ist es freilich, wenn man sein Ohr mit gellenden Tönen beleidigt. Ein Igel, vor dessen Ohr man mit einem Glöckchen klingelt, zuckt fort und fort bei jedem Schlage gleichsam krampfhaft zusammen. Klingelt man nah bei einem Ohre, so zuckt er seinen Panzer auf der betreffenden Seite herab, bei größerer Entfernung zieht er die Stirnhaut gerade nach vorn. Immer erfolgt dieses Zucken in demselben Augenblicke, in welchem der Klang laut wird; man kann ihn ganz nach Belieben sich verneigen lassen. Wenn ihn einer seiner Hauptfeinde, ein Hund oder ein Fuchs aufstöbert, kugelt er sich eiligst ein und bleibt unter allen Umständen in seiner Lage. Er merkt an dem wüthenden Bellen oder Knurren der Verfolger, daß sie ihm in ernster Absicht zu Leibe gehen, und hütet sich wohl, irgend eines seiner anererbten Vorrechte sich zu entäußern. Mittel gibt es freilich noch genug, den Igel augenblicklich dahin zu bringen, daß er seine Kugelgestalt aufgibt. Wenn man ihn mit Wasser begießt oder in das Wasser wirft, rollt er sich sofort auf: das weiß nicht bloß der Schelm Reinecke, sondern auch mancher Hund zum Nachtheile unseres Thieres anzuwenden. Auch Tabaksrauch, den man ihm zwischen den Stacheln durch in die Nase bläst, bewirkt dasselbe; denn seinem empfindlichen Geruchswerkzeuge ist der Rauch etwas ganz entsetzliches: er wird förmlich berauscht von ihm, streckt sich augenblicklich, hebt die Nase hoch auf und taumelt wankenden Schrittes davon, bis ihn einige Züge reiner, frischer Luft wieder einigermaßen erquickt haben. In seiner Zusammenkugelung besteht die einzige ihm mögliche Abwehr gegen Gefahren, denen er ausgesetzt ist. Auch wenn er, wie es bei dem täppischen Gesellen häufig vorkommt, einmal einen Fehltritt thut, über eine hohe Gartenmauer herunterfällt oder plötzlich an einem steilen Abhange ins Rollen kommt, kugelt er sich augenblicklich zusammen und stürzt jetzt mit erstaunlicher Schnelligkeit den Abhang oder die Mauer hinab, ohne sich im geringsten weh zu thun. Man hat beobachtet, daß er von mehr als sechs Meter hohen Wallmauern herabgefallen ist, ohne sich zu schaden.
Der Igel ist keinesweges ein ungeschickter und tölpischer Jäger, sondern versteht Jagdkunststücke auszuführen, welche man nimmermehr ihm zutrauen möchte. Allerdings besteht die Hauptmasse seiner Nahrung aus Kerbthieren, und eben hierdurch wird er so nützlich. Allein er begnügt sich nicht mit solcher, so wenig nährenden Kost, sondern erklärt auch anderen Thieren den Krieg. Kein einziger der kleinen Säuger oder Vögel ist vor ihm sicher, und unter den niederen Thieren haust er in arger Weise. Außer der Unmasse von Heuschrecken, Grillen, Küchenschaben, Mai- und Mistkäfern, anderen Käfern aller Art und deren Larven, verzehrt er Regenwürmer, Nacktschnecken, Wald- oder Feldmäuse, kleine Vögel und selbst Junge von großen. Man sollte nicht denken, daß er wirklich im Stande wäre, die kleinen, behenden Mäuse zu fangen; aber er versteht sein Handwerk und bringt selbst das unglaublich scheinende fertig. Ich habe ihn einmal bei seinem Mäusefang beobachtet und mich über seine Pfiffigkeit billig gewundert. Er strich im Frühjahre im niederen Getreide hin und blieb plötzlich vor einem Mäuseloche stehen, schnupperte und schnüffelte daran herum, wendete sich langsam hin und her und schien sich endlich überzeugt zu haben, auf welcher Seite die Maus ihren Sitz hatte. Da kam ihm nun sein Rüssel vortrefflich zu statten. Mit großer Schnelligkeit wühlte er den Gang der Maus auf und holte sie so auch wirklich nach kurzer Zeit ein; denn ein Quieken von Seiten der Maus und behagliches Murmeln von Seiten des Igels bewies, daß dieser sein Opfer gefaßt hatte. Nun wurde mir freilich sein Mausefang klar; wie er es aber anstellt, in Scheunen und Ställen das behende Wild zu übertölpeln, erfuhr ich erst neuerdings durch meinen Freund Albrecht. Beim Umherlaufen im Zimmer wurde ein von diesem Beobachter gepflegter Igel plötzlich eine naseweise Maus gewahr, welche sich aus ihrem Loche hervorgewagt hatte. Mit unglaublicher Schnelligkeit, obschon mit einem gewissen Ungeschick, schoß er auf dieselbe los und packte sie, bevor sie Zeit hatte, zu entrinnen. »Die fabelhaft flotte Bewegung des anscheinend so plumpen Thieres, welche ich später noch öfters beobachtete«, schreibt mir mein Freund, »brachte mich stets zum Lachen; ich weiß sie mit nichts richtig zu vergleichen. Fast war es wie ein abgeschossener Pfeil von Rohr, welcher vom Winde rechts und links getrieben wird, aber trotzdem wieder an die rechte Bahn kommt.«
Weit bedeutsamer als solche Räubereien sind die Gefechte, welche er den Schlangen liefert. Er beweist dabei einen Muth, den man ihm nicht zutrauen sollte. Lenz hat hierüber vortreffliche Beobachtungen gemacht. »Am 24. August«, berichtet er, »that ich einen Igel in eine große Kiste, in welcher er zwei Tage später sechs mit kleinen Stacheln versehene Junge gebar, welche er fortan mit treuer Mutterliebe pflegte. Ich bot ihm, um seinen Appetit zu prüfen, recht verschiedenartige Nahrung an und fand, daß er Käfer, Regenwürmer, Frösche, selbst Kröten, diese jedoch nicht so gern, Blindschleichen und Ringelnattern mit großem Behagen verzehrte. Mäuse waren ihm das allerliebste; Obst aber fraß er nur dann, wenn er keine Thiere hatte, und da ich ihm einst zwei Tage gar nichts als Obst gab, fraß er so spärlich, daß zwei seiner Jungen aus Mangel an Milch verhungerten. Hohen Muth zeigte er auch gegen gefährliche Thiere. So ließ ich einmal acht tüchtige Hamster in seine Kiste, bekanntlich bitterböse Thiere, mit denen nicht zu spaßen ist. Kaum hatte er die neuen Gäste gerochen, als er zornig seine Stacheln sträubte und, die Nase tief am Boden hinziehend, einen Angriff auf den nächsten unternahm. Dabei ließ er ein eignes Trommeln, gleichsam den Schlachtmarsch, ertönen, und seine gesträubten Kopfstacheln bildeten zum Schutz und Trutz einen Helm. Was half es dem Hamster, daß er fauchend auf den Igel biß: er verwundete sich nur den Rachen an den Stacheln, so daß er von Blut triefte, und bekam dabei soviel Stöße vom Stachelhelm in die Rippen und soviel Bisse in die Beine, daß er erlegen wäre, wenn ich ihn nicht entfernt hätte. Nun wandte sich der Stachelheld auch gegen die anderen Feinde und bearbeitete sie ebenso kräftig, bis ich sie entfernte.
»Doch wir gehen zur Hauptsache über und folgen unserem Helden zum Otternkampfe. Staunend über seine Thaten, müssen wir zugestehen, daß wir nicht den Muth haben, ihm es nachzuthun. Am 30. August ließ ich eine große Kreuzotter in die Kiste des Igels, während er seine Jungen ruhig säugte. Ich hatte mich im voraus davon überzeugt, daß diese Otter an Gift keinen Mangel litt, da sie zwei Tage vorher eine Maus sehr schnell getödtet hatte. Der Igel roch sie sehr bald (er folgt nie dem Gesicht, sondern immer dem Geruch), erhob sich von seinem Lager, tappte unbehutsam bei ihr herum, beroch sie, weil sie ausgestreckt dalag, vom Schwanze bis zum Kopfe und beschnupperte vorzüglich den Rachen. Sie begann zu zischen und biß ihn mehrmals in die Schnauze und in die Lippen. Ihrer Ohnmacht spottend, leckte er sich, ohne zu weichen, behaglich die Wunde und bekam dabei einen derben Biß in die herausgestreckte Zunge. Ohne sich beirren zu lassen, fuhr er fort, das wüthende und immer wieder beißende Thier zu beschnuppern, berührte sie auch öfter mit der Zunge, aber ohne anzubeißen. Endlich packte er schnell ihren Kopf, zermalmte ihn, trotz ihres Sträubens, sammt Giftzähnen und Giftdrüsen zwischen seinen Zähnen und fraß dann weiter bis zur Mitte des Leibes. Jetzt hörte er auf und lagerte sich wieder zu seinen Jungen, die er säugte. Abends fraß er das noch übrige und eine junge, frischgeborene Kreuzotter. Am folgenden Tage fraß er wieder drei frischgeborene Ottern und befand sich nebst seinen Jungen sehr wohl. Auch war an den Wunden weder eine Geschwulst noch sonst derartiges zu sehen.
»Am 1. September ging es wieder zur Schlacht. Er näherte sich, wie früher, der Otter, beschnupperte sie und bekam mehrere Bisse ins Gesicht, in die Borsten und Stacheln. Während er so schnupperte, besann sich die Otter, welche sich bis jetzt vergeblich bemüht und auch tüchtig an seinen Stacheln gestochen hatte, und suchte sich aus dem Staube zu machen. Sie kroch in der Kiste umher; der Igel folgte ihr schnuppernd nach und erhielt, so oft er ihrem Kopfe nahe kam, tüchtige Bisse. Endlich hatte er sie in der Ecke, wo seine Jungen lagen, ganz in der Enge; sie sperrte den Rachen mit gehobenen Giftzähnen weit auf, er wich nicht zurück, sie fuhr zu und biß so heftig in seine Oberlippe, daß sie eine Zeitlang hängen blieb. Er schüttelte sie ab, sie kroch weg, er wieder nach, und dabei bekam er wieder einige Bisse. Dies hatte wohl zwölf Minuten gedauert; ich hatte zehn Bisse gezählt, welche er in die Schnauze erhalten, und zwanzig, welche seine Borsten oder die Luft getroffen hatten. Ihr Rachen, von den Stacheln verletzt, war vom Blute geröthet. Er faßte jetzt ihren Kopf mit den Zähnen, aber sie riß sich wieder los und kroch weg. Ich hob sie nun am Schwanze heraus, packte sie hinter dem Kopfe und sah, da sie sogleich den Rachen aufsperrte, um mich zu beißen, daß ihre Giftzähne noch in gutem Stande waren. Als ich sie wieder hineingeworfen, ergriff er ihren Kopf nochmals mit den Zähnen, zerknirschte ihn und fraß ihn dann langsam, ohne sich viel um ihr Krümmen und Winden zu kümmern, auf, worauf er zu seinen Jungen eilte und sie säugte. Alte und Junge blieben gesund, und keine Spuren von üblen Folgen waren zu sehen.
»Seitdem hat der Igel oftmals mit demselben Erfolge gekämpft, und immer zeigte es sich, daß er den Kopf jedesmal zuerst zermalmte, während er dies bei giftlosen Schlangen ganz und gar nicht berücksichtigte. Was von der Mahlzeit übrig blieb, trug er gern in sein Nest und verspeiste es dann zu gelegnerer Zeit.«
Diese Beobachtungen sind unzweifelhaft in jeder Hinsicht merkwürdig. Nach physiologischen Gesetzen läßt es sich nicht einsehen, wie ein warmblütiges Thier so ruhig Bisse aushalten kann, deren Wirkung bei anderen seiner Klasse sogleich Zersetzung des Blutes hervorruft und dadurch den Tod nach sich zieht. Man muß nur bedenken, daß der Biß einer Kreuzotter Säugethiere tödtet, welche wenigstens die dreißigfache Größe und das dreißigfache Gewicht des Igels haben, anscheinend also auch weit stärker sein müßten, als er es ist. Aber unser Stachelheld scheint wirklich giftfest zu sein; denn er verzehrt nicht bloß Giftschlangen, deren Gift bekanntlich nur dann schadet, wenn es unmittelbar in das Blut übergeführt wird, sondern auch Thiere, welche dann giftig wirken, wenn sie in den Magen kommen, wie z. B. die allbekannten spanischen Fliegen, deren Leib ja schon auf der äußeren Haut heftige Entzündungen hervorruft, und deren Genuß anderen Thieren unfehlbar den Tod bringen würde.
Der geringe Schaden, welchen der Igel anrichtet, kann gegenüber dem von ihm gebrachten Nutzen kaum in Betracht kommen, zumal jener noch keineswegs genügend erwiesen ist. Man behauptet, daß der Igel leidenschaftlich gern Hühnereier fresse und diese nicht nur sehr geschickt aufzufinden verstehe, sondern auch höchst pfiffig ausschlürfe, ohne von ihrem Inhalt etwas zu verschütten; denn man will gesehen haben, daß er das Ei vorsichtig auf den Boden lege, mit seinen Vorderbeinen halte, eine kleine Oeffnung durch die Schale beiße und den Inhalt sodann bedächtig auslecke. Außerdem geben ihm Hühnerzüchter schuld, daß er, wenn er zu gelegener Zeit in einen Hühnerstall kommen könne, unter dem Hausgeflügel Schaden anrichte, und Einer will sogar einen Igel gefunden haben, welcher fünfzehn Hühner in einer Nacht umgebracht und eine davon gefressen haben soll. Der Beweis für die Wahrheit dieser Angabe ist nicht stichhaltig. Nachdem nämlich der Eigentümer den Schaden gemerkt hatte, legte er rings um den Stall Tellereisen, und am folgenden Morgen fand man drei Igel in diesen Fallen, welche nun die Missethat irgend eines schlauen Marders auf sich nehmen mußten; denn jedenfalls war letzterer der Urheber jener Schandtat gewesen, welche jetzt den wahrscheinlich auf Mäusefang umherstreifenden, ungeschickt genug in die Falle tappenden Igeln zur Last gelegt wurde. Daß unser Stachelritter ein Küchlein verzehrt oder selbst ein erwachsenes Huhn, ein Kaninchen und sonst ein anderes kleines Thier abzuwürgen vermag, wenn er es erlangen kann, auch gute Lust zeigt, gelegentlich solche Beute zu machen, soll nicht in Abrede gestellt werden. Erst vor kurzem empfing ich von Becker, einem ostfriesischen Arzte, Bericht über einen Igel, welcher am hellen Tage einer Schar von erwachsenen Hühnern in eiligem, schnurgeraden Laufe nachjagte. Aber die Hühner bekundeten nicht eben Angst vor diesem Feinde. »Wenn der Igel«, sagt Becker, »die ersehnte Beute fast erreicht hatte, flog die betreffende Henne gackernd in die Höhe, und der borstige Held kollerte dann jedesmal vier bis fünf Schritte über sein Ziel hinaus, was unendlich komisch aussah. Unter Ausstoßung eines Lautes, welchen ich am besten mit dem Schnarren einer Kindertrompete vergleichen möchte, raffte sich der geprellte Igel ärgerlich wieder auf, um die Verfolgung fortzusetzen, und trieb so die Hühner durch den ganzen, großen Garten. Der Hahn, an welchen jener sich übrigens niemals wagte, schien in den mindestens zwanzigmal wiederholten Angriffen des beutesüchtigen Räubers etwas besonders gefährliches nicht zu sehen; er warnte seine Schutzbefohlenen zwar von Zeit zu Zeit, unternahm jedoch sonst nichts gegen den Ruhestörer.« Ein Räuber also ist der Igel freilich, aber durchaus kein schädlicher gegenüber den von uns gepflegten und gehegten Thieren.
Die Paarzeit des Igels währt von Ende März bis zu Anfang Juni. Auch er zeigt sich, wenn er mit seinem Weibchen zusammen ist, sehr erregt. Er spielt nicht nur mit seiner Gattin, sondern stößt außerdem Laute aus, welche man sonst nur bei der größten Aufregung vernimmt. Ein dumpfes Gemurmel oder heiser quiekende Laute oder auch ein helles Schnalzen scheint behagliche Stimmung auszudrücken, während ein eigenthümliches Trommeln, wie der Dachs es hören läßt, ein Zeichen von gestörter Gemüthlichkeit, Wuth oder Angst ist. Alle diese Laute werden aber gerade bei der Paarungszeit vernommen; denn der Igel hat ebenfalls seine Noth, um ein Weib an sich zu fesseln. Unberufene Nebenbuhler drängen sich auch in sein Gehege und machen ihm den Kopf warm, zumal sein Weibchen sich keineswegs in den Schranken einer gebührenden Treue hält. Sieben Wochen nach der Paarung wirft letzteres seine drei bis sechs, in seltenen Fällen wohl auch acht, blinden Jungen in einem besonders hierzu errichteten, schönen, großen und gut ausgefütterten Lager unter dichten Hecken, Zäunen, Laub- und Mooshaufen oder in Getreidefeldern. Die neugeborenen Igelchen sind etwa 6,5 Centim. lang, sehen anfangs weiß aus und erscheinen fast ganz nackt, da die Stacheln erst später zum Vorschein kommen. Daß sie schon bei der Geburt vorhanden sind, hat Lenz bei den Igeln gesehen, welche in seinem Zimmer geboren wurden. »Die Sache«, sagt er, »gibt auch bei der Geburt gar keinen Anstoß. Die Stacheln stehen auf einer sehr weichen, federnden Unterlage; der Rücken ist noch ganz zart, und jeder Stachel, den man z. B. mit dem Finger berührt, sticht Einen gar nicht, sondern drückt sich rückwärts in den weichen Rücken, aus dem er jedoch gleich wieder hervorkommt, sobald man die Fingerspitze wegthut. Nur wenn man den Stachel von der Seite mit dem Nagel oder mit einem eisernen Züngelchen faßt, fühlt man, daß er hart ist. Da nun die Thierchen gewöhnlich mit dem Kopfe vorweg geboren werden und die Stacheln etwas nach hinten gerichtet sind, ist an eine Verletzung der Alten nicht zu denken.«
Um das Maul haben die Neugebornen Borsten, im übrigen sind sie unbehaart und ihre Augen und Ohren geschlossen. Schon binnen den ersten vierundzwanzig Stunden treten die Stacheln auf eine Länge von 9 Millim. hervor. Anfangs sind sie ganz weiß, nach einem Monate aber hat der junge Igel ganz die Farbe des alten. Dann frißt er schon allein, obgleich er auch noch saugt. Erst ziemlich spät erlangt er die Fertigkeit, sich zusammenzurollen und die Kopfhaut bis gegen die Schnauze herabzuziehen. Die Mutter trägt schon frühzeitig Regenwürmer und Nacktschnecken sowie abgefallenes Obst als Nahrung in das Lager und führt die kleine Brut später wohl auch abends mit sich aus. Im Freileben beweist sie sich gegen ihre Jungen jedenfalls zärtlicher als in der Gefangenschaft; denn hier frißt sie, wie ich zu meinem Befremden erfahren mußte, zuweilen die ganze Schar ihrer Kinder mit der ihr überhaupt eignen Seelenruhe auf, der reichlichsten und leckersten Speise ungeachtet!
Gegen den Herbst hin sind die jungen Igel soweit erwachsen, daß sich jeder einzelne selbst seine Nahrung aufsuchen kann, und ehe noch die kalten Tage kommen, hat jeder sich ein Schmerbäuchlein angelegt und denkt jetzt, wie die Alten, daran, sich seine Winterwohnung herzurichten. Diese ist ein großer, wirrer, aus Stroh, Heu, Laub und Moos bestehender, im Innern aber sehr sorgfältig ausgefütterter Haufen. Die Stoffe trägt der Igel auf seinem Rücken nach Hause und zwar auf sehr sonderbare Weise. Er wälzt sich nämlich in dem Laube herum, dort, wo es am dichtesten liegt, und spießt sich hierdurch eine Ladung auf die Stacheln, welche ihm dann ein ganz großartiges Ansehen verleiht. In ähnlicher Weise schafft er auch Obst nach Hause. Man hat dies oft bezweifelt, Lenz aber hat es gesehen, und einem solchen Beobachter gegenüber wäre fernerer Zweifel ein Frevel, dessen wir uns nicht schuldig machen wollen.
Mit Eintritt des ersten, starken Frostes vergräbt sich der Igel tief in sein Lager und bringt hier die kalte Winterzeit in einem ununterbrochenen Winterschlafe zu. Die Fühllosigkeit des Thieres, welche schon, wenn es am regsten sich bewegt, bedeutend ist, steigert sich jetzt noch in merkwürdiger Weise. Nur wenn man ihm sehr arg mitspielt, erwacht es, wankt ein wenig hin und her und fällt dann augenblicklich wieder in seinen Todtenschlaf zurück. Man hat solchen Igeln während des Winterschlafes den Kopf abgeschnitten, und dabei bemerkt, daß das Herz nach der Enthauptung noch längere Zeit fortschlug. Bei einer Gelegenheit war nicht bloß das Gehirn, sondern auch das Rückenmark durchschnitten; gleichwohl schlug das Herz noch zwei Stunden fort. Tiefe Verwundungen in der Brust führen bei einem schlafenden Igel den Tod oft erst nach mehreren Tagen herbei. Der Winterschlaf währt gewöhnlich bis zum März.
Die jungen Igel sind im ersten Jahre noch nicht fortpflanzungsfähig, sondern treiben sich während des ganzen nächsten Sommers einzeln umher. Im zweiten Lebensjahre aber paaren sie sich und leben in lockerem Verbande mit ihren Weibchen bis zum Winter, wo dann jeder abgesondert für sich ein Lager bezieht. Unter günstigen Verhältnissen dürfte der freilebende Igel sein Alter auf acht bis zehn Jahre bringen.
Um einen Igel zu zähmen, braucht man ihn bloß wegzunehmen und an einen ihm passenden Ort zu bringen. Hier gewohnt er bald ein und verliert in kürzester Zeit alle Scheu vor dem Menschen. Nahrung nimmt er ohne weiteres zu sich, sucht auch selbst in Haus und Hof oder noch mehr in Scheunen und Schuppen nach solchen umher. Tschudi bezweifelt zwar, daß er zum Mäusefang gebraucht werden kann, weil er einen Igel besaß, welcher mit einer Maus zugleich aus einer Schüssel fraß. Dies beweist jedoch nichts, da zahlreiche Beobachtungen dargethan haben, daß der Igel ein ganz tüchtiger Mäusejäger ist. In manchen Gegenden wird er zu diesem Geschäft gerade sehr gesucht und namentlich in Niederlagen verwendet, in denen man keine Katze halten mag, weil diese oft die üble Gewohnheit hat, mit ihrem stinkenden Harn kostbare Zeuge zu verderben. Auch ich habe Igel im Käfige gehalten, welche tagelang mit Mäusen zusammenlebten und mit ihnen Semmelmilch fraßen; schließlich fiel es ihnen aber doch ein, ihre Kameraden abzuwürgen und zu verspeisen. Zur Vertilgung lästiger Kerbthiere, zumal zum Aufzehren der häßlichen Küchenschaben, eignet sich der Igel vortrefflich, liegt seinem Geschäfte auch mit größtem Eifer ob. Wenn er nur einigermaßen freundlich und verständig behandelt wird, und für ein verborgenes Schlupfwinkelchen gesorgt worden ist, verursacht die Gefangenschaft ihm durchaus keinen Kummer.
»Ein Igel«, erzählt Wood, »welcher einige Jahre in unserem Hause lebte, mußte ein wirkliches Nomadenleben führen, weil er beständig von unseren Freunden zur Vertilgung von Küchenschaben entliehen wurde und so ohne Unterlaß von einem Hause zum anderen wanderte. Das Thier war bewundernswürdig zahm, und kam selbst bei hellem lichten Tage, um seine Milchsemmeln zu verzehren. Nicht selten unternahm er kleine Lustwanderungen im Garten, steckte hier, nach Nahrung spürend, seine scharfe Nase in jedes Loch, in jeden Winkel oder drehte jedes abgefallene Blatt auf seinem Wege um. Sobald er einen fremden Fußtritt hörte, kugelte er sich sofort zusammen und verharrte mehrere Minuten in dieser Lage, bis die Gefahr vorüber schien. Vor uns fürchtete er sich bald nicht im geringsten mehr und lief auch in unserer Gegenwart ruhig auf und nieder. Wahrscheinlich würde das hübsche Thier noch länger gelebt haben, hätte nicht ein unvorhergesehener Zufall ihm sein Leben genommen. In dem Gartenschuppen wurden nämlich stets eine große Menge von Bohnenstangen aufbewahrt und gewöhnlich sehr liederlich übereinander geworfen. Der hierdurch entstehende Reisichhaufen übte auf unseren Igel eine besondere Anziehungskraft. Wir durften, wenn er einige Tage verschwunden war, sicher darauf rechnen, ihn dort zu finden. Als wir ihn eines Morgens ebenfalls suchten, fanden wir den armen Burschen an der Gabel einer Stange erhängt. Er hatte wahrscheinlich auf den Haufen klettern wollen, war aber heruntergefallen, zwischen die Gabel eingepreßt worden, und hatte sich nicht befreien können. Der Kummer über diesen Verlust war groß, und niemals haben wir wieder einen so gemächlichen Hausgenossen gehabt als ihn.«
Unangenehm wird der im Hause gehaltene Igel durch sein langweiliges Gepolter bei Nacht. Sein täppisches Wesen zeigt sich bei seinen Streifereien wie bei jeder Bewegung. Von dem geisterhaften Gange der Katzen bemerkt man bei ihm nichts. Auch ist er ein unreinlicher Gesell, und der widrige, bisamähnliche Geruch, den er verbreitet, keineswegs angenehm. Dagegen erfreut er wieder durch seine Drolligkeit. Leicht gewöhnt er sich an die allerverschiedenartigste Nahrung und ebenso an ganz verschiedenartige Getränke. Milch liebt er ganz besonders, verschmäht aber auch geistige Getränke nicht und thut nicht selten hierin des Guten zu viel. Dr. Ball erzählt von seinen gefangenen Igeln mancherlei lustige Dinge, unter anderen auch, daß er dieselben mehr als einmal in Rausch versetzte. Er gab einem starken Wein oder Branntwein zu trinken, und der Igel nahm davon solche Mengen zu sich, daß er sehr bald vollkommen betrunken wurde. Ein frisch gefangener Igel soll nach dem ersten Rausche, den er gehabt, augenblicklich zahm geworden sein, und der genannte Beobachter hat deshalb späterhin alle seine Igel zunächst mit süßem Branntwein, Rum oder Wein bewirtet. »Mein stacheliger Freund«, sagt er, »benahm sich ganz wie ein trunkener Mensch. Er war vollkommen von Sinnen, und sein sonst so dunkles, aber harmloses Auge bekam einen eigenthümlichen, unsicheren Blick und einen merkwürdigen Glanz, kurz, ganz und gar den Ausdruck, welchen man bei Trunkenen überhaupt wahrnimmt. Er stolperte, ohne uns im geringsten zu beachten, in der merkwürdigsten und lächerlichsten Weise, wankte, fiel bald auf diese, bald auf jene Seite und geberdete sich in einer Weise, als wollte er sagen: geht mir nur Alle aus dem Wege, denn ich brauche heute viel Platz. Mehr und mehr nahm dann seine Hülflosigkeit überhand; er wankte häufiger, fiel öfter und war schließlich so vollkommen betrunken, daß er alles über sich ergehen ließ. Wir konnten ihn hin- und herdrehen, seinen Mund aufmachen, ihn an den Haaren zupfen, er rührte sich nicht. Nach zwölf Stunden sahen wir ihn wieder umherlaufen. Er war vollkommen gebändigt, und seine Stacheln blieben jetzt, wenn wir uns ihm näherten, stets in schönster Ordnung liegen.«
Auch Albrecht hat seinen gefangenen Igel öfters durch Vorsetzen geistiger Getränke in einen Rausch versetzt und ähnliche Beobachtungen gemacht wie Ball.
Der Igel hat außer dem unwissenden, böswilligen Menschen noch viele andere Feinde. Die Hunde hassen ihn aus tiefster Seele und verkünden dies durch ihr anhaltendes, wüthendes Gebell. Sobald sie einen Igel entdeckt haben, versuchen sie alles mögliche, um dem Stachelträger ihren Grimm zu zeigen. Der aber verharrt in seiner leidenden Stellung, solange sich der Hund mit ihm beschäftigt, und überläßt es diesem, sich eine blutige Nase zu holen. Die Wuth des Hundes ist wahrscheinlich größtentheils in dem Aerger begründet, dem Gepanzerten nicht nur nichts anhaben zu können, sondern sich selbst zu schaden. Manche Jagdhunde achten die Stacheln übrigens nicht, wenn sie ihren Grimm an dem Igel auslassen wollen. So besaß ein Freund von mir eine Hühnerhündin, welche alle Igel, die sie auffand, ohne weiteres todt biß. Als mit zunehmendem Alter ihre Zähne stumpf wurden, konnte sie diese Heldenthaten der Jugend nicht mehr vollbringen; ihr Haß blieb aber derselbe, und sie nahm fortan jeden Igel, welchen sie entdeckte, in das Maul, trug ihn nach einer Brücke und warf ihn dort wenigstens noch ins Wasser. Der Fuchs soll, wie versichert wird, dem Igel eifrig nachstellen und ihn auf niederträchtige Weise zum Aufrollen bringen, indem er die Stachelkugel mit seinen Vorderpfoten langsam dem Wasser zuwälzt und sie da hineinwirft oder sie so dreht, daß der Igel auf den Rücken zu liegen kommt, und ihn sodann mit seinem stinkenden Harn bespritzt, worauf sich der arme Geselle verzweifelt aufrollt, im gleichen Augenblicke aber von dem Erzschurken an der Nase gefaßt und getödtet wird. Auf diese Weise gehen viele Igel zu Grunde, zumal in der Jugend. Aber sie haben einen noch gefährlicheren Feind, den Uhu. »Nicht weit von Schnepfenthal«, erzählt Lenz, »steht ein Felsen, der Thorstein, auf dessen Höhe Uhus ihr Wesen zu treiben pflegen. Dort habe ich öfters außer dem Miste und den Federn dieser Eulen auch Igelhäute, und nicht bloß diese, sondern selbst die Stacheln der Igel in den Gewöllen, welche die Uhus ausspeien, gefunden. Wir heben hier eins dieser Gewölle als eine Seltenheit im Kabinet auf, welches fast ganz aus Stacheln des Igels besteht. Die Krallen und der Schnabel des Uhu sind lang und unempfindlich, so daß er mit großer Leichtigkeit durch das Stachelkleid des Igels greifen kann. Vor nicht gar langer Zeit gingen unsere Zöglinge unweit Schnepfenthal bei trübem Wetter spazieren. Da kam ein Uhu angeflogen, welcher einen großen Klumpen in den Füßen hielt. Die Knaben erhoben ein lautes Geschrei, und siehe, der Vogel ließ seine Beute fallen. Es war ein großer, frischblutender, noch lebenswarmer Igel.« Noch mehr Igel, als den genannten Feinden zum Opfer fallen, mögen eine Beute des Winters werden. Die unerfahrenen Jungen wagen sich oft, vom Hunger getrieben, noch im Spätherbste mit der beginnenden Nacht aus ihren Verstecken hervor und erstarren in der Kühle des Morgens. Viele sterben auch während des Winters, wenn ihr Nest dem Sturm und Wetter zu sehr ausgesetzt ist. So geht in manchem Garten oder Wäldchen in einem Winter zuweilen die ganze Brut zu Grunde.
Auch noch nach seinem Tode muß der Igel dem Menschen nützen, wenigstens in manchen Gegenden. Sein Fleisch wird wahrscheinlich bloß von Zigeunern und ähnlichem umherstreifenden Gesindel verzehrt, also doch gegessen, und man hat sogar eine eigne Zubereitungsweise erfunden. Der Igel wird von dem wahren Kochkünstler mit einer dicken Lage gut durchgekneteten, klebrigen Lehms überzogen und mit dieser Hülle übers Feuer gebracht, hieraus sorgfältig in gewissen Zeiträumen gedreht und gewendet. Sobald die Lehmschicht trocken und hart geworden ist, nimmt man den Braten vom Feuer, läßt ihn etwas abkühlen und bricht dann die Hülle ab, hierdurch zugleich die sämmtlichen Stacheln, welche in der Erde stecken bleiben, entfernend. Bei dieser Zubereitungsart wird der Saft vollkommen erhalten und ein nach dem Geschmacke der genannten Leute ausgezeichnetes Gericht erzielt. In Spanien wurde er früher, zumal während der Fastenzeit, häufig genossen, weil ihm von den Pfaffen seine Stellung in der Klasse der Säugethiere abgesprochen, und er, wer weiß für welches Thier erklärt wurde. Bei den Alten spielte er auch in der Arzneikunde seine Rolle. Man gebrauchte sein Blut, seine Eingeweide, ja selbst seinen Mist als Heilmittel oder brannte das ganze Thier zu Asche und verwendete diese in ähnlicher Weise wie die Hundeasche. Selbst heutzutage wird sein Fett noch als besonders heilkräftig angesehen. Die Stachelhaut benutzten
die alten Römer zum Karden ihrer wollenen Tücher, und man trieb deshalb mit Igelhäuten lebhaften Handel, welcher so bedeutenden Gewinn abwarf, daß er durch Senatsbeschlüsse geregelt werden mußte. Außerdem wandte man den Stachelpelz als Hechel an. Heutigen Tags noch sollen manche Landwirte von dem Igelfell Gebrauch machen, wenn sie ein Kalb absetzen wollen, dem noch sauglustigen Thiere nämlich ein Stückchen Igelfell mit den Stacheln auf die Nase binden und es dann der Mutter selbst überlassen, den Säugling, welcher ihr äußerst beschwerlich fällt, von sich abzutreiben und an anderes Futter zu gewöhnen.
Die Kerbthierfresser, welche wir als die am tiefsten stehenden ansehen dürfen, haben sich gänzlich unter die Oberfläche der Erde zurückgezogen und führen hier ein in jeder Hinsicht eigenthümliches Leben.
Die Maulwürfe oder Mulle ( Talpina ) verbreiten sich fast über Europa, einen großen Theil von Asien, Südafrika und Nordamerika. Ihre Artenzahl ist nicht eben groß; es scheint jedoch wahrscheinlich, daß es noch viele den Naturforschern unbekannte Maulwürfe gibt. Alle Arten sind so auffallend gestaltet und ausgerüstet, daß sie sofort sich erkennen lassen. Der gedrungene Leib ist walzenförmig und geht ohne abgesetzten Hals in den kleinen Kopf über, welcher sich seinerseits zu einem Rüssel verlängert und zuspitzt, während Augen und Ohren verkümmert und äußerlich kaum oder nicht sichtbar sind. Der Leib ruht auf vier kurzen Beinen, von denen die vorderen als verhältnismäßig riesige Grabwerkzeuge erscheinen, während die Hinterpfoten schmal, gestreckt und rattenfußartig sind und der Schwanz nur kurz ist. Letzterer zeichnet sich besonders dadurch aus, daß die Haare einen wirklichen Metallglanz haben, wie man ihn sonst bei keinem Säugethiere bemerkt. Mit diesen äußerlichen Merkmalen steht die Anlage und Ausbildung der inneren Theile im innigsten Einklange. Das Gebiß besteht aus 36 bis 44 Zähnen, da alle Zahnarten mehr oder weniger abändern, ebensowohl was Form und Größe, als was die Anzahl betrifft. Der Schädel ist sehr gestreckt und platt, seine Höhle vollständig, ein Jochbogen vorhanden, die einzelnen Kopfknochen sind auffallend dünn. In der Wirbelsäule, welche außer den Halswirbeln von 19 bis 20 rippentragenden, 3 bis 5 rippenlosen, 3 bis 5 Kreuz- und 6 bis 11 Schwanzwirbeln zusammengesetzt wird, fällt die Verwachsung mehrerer Halswirbel auf. Bau und Stellung der Vorderfüße bedingen eine Stärke des Oberbrustkorbes, wie sie verhältnismäßig kein anderes Thier besitzt. Das Schulterblatt ist das schmälste und längste, das Schlüsselbein das dickste und längste in der ganzen Klasse, der Oberarm ungemein breit, der Unterarm stark und kurz. Zehn Knochen finden sich in der Handwurzel. Man erkennt, daß diese riesigen Vorderglieder bloß zum Graben bestimmt sein können: sie sind Schaufeln, welche man sich nicht vortrefflicher gestaltet denken kann. An diese Knochen setzen sich nun auch besonders kräftige Muskeln an, und daher kommt eben die verhältnismäßige Stärke des Thieres im Vordertheile seines Körpers.
Alle Maulwürfe bewohnen mit Vorliebe ebene, fruchtbare Gegenden, ohne jedoch im Gebirge zu fehlen. Wiesen und Felder, Gärten, Wälder und Auen werden von ihnen erklärlicherweise den trockenen, unfruchtbaren Hügelabhängen oder sandigen Stellen vorgezogen. Nur ausnahmsweise finden sie sich an den Ufern der Flüsse oder Seen ein, und noch seltner begegnet man ihnen an den Küsten des Meeres. Alle Arten führen ein vollkommen unterirdisches Leben. Sie scharren sich Gänge durch den Boden und werfen Haufen auf, ebensowohl im trockenen, lockern oder sandigen als im feuchten und weichen Boden. Manche Arten legen sich weit ausgedehnte und sehr zusammengesetzte Baue an. Als Kinder der Finsternis empfinden sie schmerzlich die Wirkung des Lichts. Deshalb kommen sie auch nur selten freiwillig an die Oberfläche der Erde und sind selbst in der Tiefe bei Nacht thätiger als bei Tage. Ihr Leibesbau verbannt sie entschieden von der Oberfläche der Erde. Sie können weder springen noch klettern, ja kaum ordentlich gehen, obgleich sich manche rasch auf dem Boden fortbewegen, diesen meist bloß mit der Sohle der Hinterfüße und dem Innenrande der Hände berührend. Um so rascher ist ihr Lauf in ihren Gängen unter der Erde und wahrhaft bewundernswürdig die Geschwindigkeit, mit welcher sie graben. Auch das Schwimmen verstehen sie sehr gut, obgleich sie von dieser Fertigkeit bloß im Nothfalle Gebrauch machen. Die breiten Hände geben vorzügliche Ruder ab, und die kräftigen Arme erlahmen im Wasser erklärlicher Weise noch weit weniger als beim Graben in der Erde.
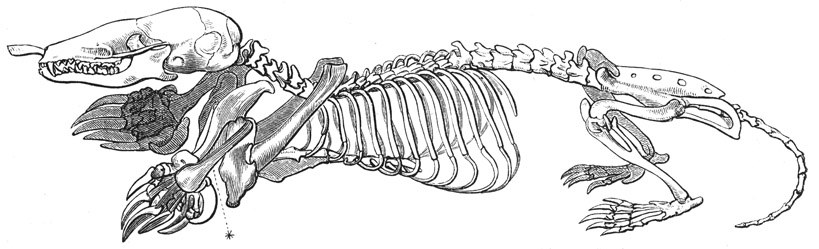
Geripp des Maulwurfs. (Aus dem Berliner anatomischen Museum).
Unter den Sinnen sind Geruch, Gehör und Gefühl besonders ausgebildet, während das Gesicht sehr verkümmert ist. Ihre Stimme besteht in zischenden und quiekenden Lauten. Die geistigen Fähigkeiten sind gering, obwohl nicht in dem Grade, als man gewöhnlich zu glauben geneigt ist. Doch scheinen die sogenannten schlechten Eigenschaften weit mehr entwickelt zu sein als die guten; denn alle Mulle sind im höchsten Grade unverträgliche, zänkische, bissige, räuberische und mordlustige Thiere, welche selbst den Tiger an Grausamkeit übertreffen und mit Lust einen ihres Gleichen auffressen, sobald er ihnen in den Wurf kommt.
Die Nahrung besteht ausschließlich in Thieren, nie aus Pflanzenstoffen. Unter der Erde lebende Kerbthiere aller Art, Würmer, Asseln und dergleichen bilden die Hauptmasse ihrer Mahlzeiten. Außerdem verzehren sie, wenn sie es haben können, kleine Säugethiere und Vögel, Frösche und Nacktschnecken. Ihre Gefräßigkeit ist ebenso groß wie ihre Beweglichkeit; denn sie können bloß sehr kurze Zeit ohne Nachtheil hungern und verfallen deshalb auch nicht in Winterschlaf. Gerade aus diesem Grunde werden sie als Kerbthiervertilger nützlich, während sie durch ihr Graben dem Menschen viel Aerger bereiten.
Ein- oder zweimal im Jahre wirft der weibliche Maulwurf zwischen drei bis fünf Junge und pflegt dieselben sorgfältig. Die Kleinen wachsen ziemlich rasch heran und bleiben ungefähr einen oder zwei Monate bei ihrer Mutter. Dann machen sie sich selbständig, und die Wühlerei beginnt. In der Gefangenschaft kann man sie nur bei sorgfältigster Pflege erhalten, weil man ihrer großen Gefräßigkeit kaum Genüge zu leisten vermag.
Nach der Beschaffenheit des Gebisses, der Bildung des Rüssels und dem Fehlen oder Vorhandensein des mehr oder weniger langen Schwanzes theilt man die Maulwürfe in Sippen ein, welche wir aus dem Grunde übergehen können, als die Mulle im wesentlichen eine durchaus übereinstimmende Lebensweise führen und die in Europa lebenden Arten letztere uns genügend kennen lehren.
Der Maulwurf oder Mull ( Talpa, europaea, T. vulgaris), das Urbild der Familie und einer auf Europa und Asien beschränkten Sippe, läßt sich, nach den vorstehend gegebenen Merkmalen der Familie, mit wenigen Worten beschreiben. Die Leibeslänge beträgt, einschließlich des 2,5 Centim. langen Schwanzes, 15, höchstens 17 Centim., die Höhe am Widerrist ungefähr 5 Centim. Das Gebiß besteht aus 44 Zähnen und zwar im Oberkiefer sechs, im Unterkiefer acht einfachen unter sich nicht wesentlich verschiedenen, einwurzeligen Vorderzähnen, großen, zweiwurzeligen Eckzähnen und oben sieben, unten sechs Backenzähnen jederseits, von denen die ersten drei und beziehentlich zwei klein und einwurzelig, daher als Lückzähne anzusprechen, die darauf folgenden vier aber mehrwurzelig, theilweise auch mehrspitzig, also Mahlzähne sind. Von der Leibeswalze stehen die sehr kurzen Beine ziemlich wagerecht ab; die sehr breite, handförmige Pfote kehrt die Fläche, welche bei anderen Thieren die innere ist, immer nach außen und rückwärts. Unter den kurzen, durch breite, stark abgeplattete und stumpfschneidige Krallen bewehrten Zehen ist die mittelste am längsten, die äußeren aber verkürzen sich allmählich und sind fast vollständig mit einander durch Spannhäute verbunden, ja beinahe verwachsen. An den kleinen und kurzen Hinterfüßen sind die Zehen getrennt und die Krallen spitzig und schwach. Die Augen haben etwa die Größe eines Mohnkornes, liegen in der Mitte zwischen der Rüsselspitze und den Ohren und sind vollkommen von den Kopfhaaren überdeckt, besitzen aber Lider und können willkürlich hervorgedrückt und zurückgezogen, also benutzt werden. Die kleinen Ohren haben keine äußeren Ohrmuscheln, sondern werden außen bloß von einem kurzen Hautrande umgeben, welcher ebenfalls unter den Haaren verborgen liegt und zur Oeffnung und Schließung des Gehörganges dient. Die gleichmäßig schwarze Behaarung ist überall sehr dicht, kurz und weich, sammetartig; auch die glänzenden Schnurren und Augenborsten zeichnen sich durch Kürze und Feinheit aus. Mit Ausnahme der Pfoten, der Sohlen, der Rüsselspitze und des Schwanzendes bedeckt der Pelz den ganzen Körper. Sein bald mehr ins Bräunliche, bald mehr ins Bläuliche oder selbst ins Weißliche schillernder Glanz ist ziemlich lebhaft. Die nackten Theile sind fleischfarbig, die Augen schwarz wie kleine einfarbige Glasperlen, denn man kann an ihnen den Stern von der Regenbogenhaut nicht unterscheiden. Das Weibchen ist schlanker gebaut als das Männchen, und junge Thiere sind etwas mehr graulich gefärbt. Dies sind die einzigen Unterschiede, welche zwischen den Geschlechtern und Altern bestehen. Es gibt aber auch Abarten, bei denen die aschgraue Färbung des Jugendkleides eine bleibende ist, oder welche am Bauche auf der aschgrauen Grundfarbe breite, graugelbe Längsstreifen zeigen, auch solche, welche mit weißen Flecken auf schwarzem Grunde gezeichnet sind. Aeußerst selten findet man gelbe und weiße Maulwürfe.

Maulwurf ( Talpa europaea). 1/2 natürl. Größe.
Der Verbreitungskreis des Maulwurfes erstreckt sich über ganz Europa, mit Ausnahme weniger Länder, und reicht noch bis in den östlichen Theil von Nord- und Mittelasien hinüber. In Europa bilden das südliche Frankreich, die Lombardei und die nördliche Türkei seine Südgrenze; von hier aus verbreitet er sich nach Norden hinauf bis auf das Dovrefjeld, in Großbritannien bis zu dem mittleren Schottland und in Rußland bis zu den mittleren Dwinagegenden. Auf den Orkney- und Shetlandsinseln sowie auf dem größten Theil der Hebriden und in Irland fehlt er gänzlich. In Asien geht er bis zum Amur und südwärts bis in den Kaukasus; in den Alpen steigt er bis zu 2000 Meter Gebirgshöhe empor. Er ist überall gemein und vermehrt sich da, wo man ihm nicht nachstellt, in überraschender Weise.
Von seinem Aufenthalte gibt er selbst sehr bald die sicherste Kunde, da er beständig neue Hügel aufwerfen muß, um leben zu können. Diese Hügel bezeichnen immer die Richtung und Ausdehnung seines jedesmaligen Jagdgrundes. Bei seiner außerordentlichen Gefräßigkeit muß er diesen fortwährend vergrößern und daher auch beständig an dem Ausbaue seines unterirdischen Gebietes arbeiten. Ohne Unterlaß gräbt er wagerechte Gänge in geringer Tiefe unter der Oberfläche und wirft, um den losgescharrten Boden zu entfernen, die bekannten Hügel auf. »Unter allen einheimischen, unterirdischen Thieren«, schildert Blasius, »bereitet sich der gemeine Maulwurf am mühsamsten seine kunstreichen Wohnungen und Gänge. Er hat nicht allein für die Befriedigung seiner lebhaften Freßlust, sondern auch für die Einrichtung seiner Wohnung und Gänge, für Sicherheit gegen Gefahr mancherlei Art zu sorgen. Am kunstreichsten und sorgsamsten ist die eigentliche Wohnung, sein Lager, eingerichtet. Gewöhnlich befindet es sich an einer Stelle, welche von außen schwer zugänglich ist, unter Baumwurzeln, unter Mauern und dergleichen und meist weit entfernt von dem täglichen Jagdgebiete. Mit letzterem, in welchem die täglich sich vermehrenden Nahrungsröhren mannigfaltig sich verzweigen und kreuzen, ist die Wohnung durch eine lange, meist ziemlich gerade Laufröhre verbunden. Außer diesen Röhren werden noch eigenthümliche Gänge in der Fortpflanzungszeit angelegt. Die eigentliche Behausung zeichnet sich an der Oberfläche meist durch einen gewölbten Erdhaufen von auffallender Größe aus. Sie besteht im Innern aus einer rundlichen, reichlich acht Centim. weiten Kammer, welche zum Lagerplatze dient, und aus zwei kreisförmigen Gängen, von denen der größere, in gleicher Höhe mit der Kammer, dieselbe ringsum in einer Entfernung von ungefähr 16 bis 25 Centim. einschließt, und der kleinere, etwas oberhalb der Kammer, mit dem größeren ziemlich gleichartig verläuft. Aus der Kammer gehen gewöhnlich drei Röhren schräg nach oben in die kleinere Kreisröhre und aus dieser, ohne Ausnahme abwechselnd mit den vorhergehenden Verbindungsröhren, fünf bis sechs Röhren schräg abwärts in die größere Kreisröhre; von letzterer aus strecken sich strahlenförmige und ziemlich wagerechte nach außen, und ebenfalls wieder abwechselnd mit den zuletzt genannten Verbindungsröhren etwa acht bis zehn einfache oder verzweigte Gange nach allen Richtungen hin, die aber in einiger Entfernung meist bogenförmig nach der gemeinsamen Laufröhre umbiegen. Auch aus der Kammer abwärts führt eine Sicherheitsröhre in einem wieder ansteigenden Bogen in diese Laufröhre. Die Wände der Kammer und der zu der Wohnung gehörigen Röhren sind sehr dicht, fest zusammengestampft und glatt gedrückt. Die Kammer selbst ist zum Lager ausgepolstert mit weichen Blättern von Gräsern, meist jungen Getreidepflänzchen, Laub, Moos, Stroh, Mist oder zarten Wurzeln, welche der Maulwurf größtentheils von der Oberfläche der Erde herbeiführt. Kommt ihm Gefahr von oben, so schiebt er das weiche Lagerpolster zur Seite und fällt nach unten, sieht er sich von unten oder von der Seite bedroht, so bleiben ihm die Verbindungsröhren zu der kleineren Kreisröhre theilweise offen. Die Wohnung bietet ihm zu Schlaf und Ruhe unter allen Umständen Sicherheit dar und ist deshalb auch sein gewöhnlicher Aufenthalt, wenn er nicht auf Nahrung ausgeht. Sie liegt 30 bis 60 Centim. unter der Erdoberfläche. Die Laufröhre ist weiter als die Körperdicke, so daß das Thier schnell und bequem vorwärts kommen kann; auch in ihr sind die Wände durch Zusammenpressen und Festdrücken von auffallender Festigkeit und Dichtigkeit. Aeußerlich zeichnet sie sich nicht wie die übrigen Gänge durch aufgeworfene Haufen aus, indem bei der Entfernung die Erde nur zur Seite gepreßt wird. Sie dient bloß zu einer möglichst raschen und bequemen Verbindung mit dem
täglichen Jagdgebiete und wird nicht selten von anderen unterirdischen Thieren, Spitzmäusen, Mäusen und Kröten, benutzt, welche sich aber sehr zu hüten haben, dem Maulwurf in ihr zu begegnen. Von außen kann man sie daran erkennen, daß die Gewächse über ihr verdorren und der Boden über ihr sich etwas senkt. Solche Laufröhren sind nicht selten 30 bis 50 Meter lang. Das Jagdgebiet liegt meist weit von der Wohnung ab und wird tagtäglich Sommer und Winter in den verschiedensten Richtungen durchwühlt und durchstampft. Die Gänge in ihm sind bloß für den zeitweiligen Besuch zum Aufsuchen der Nahrung gegraben und werden nicht befestigt, so daß die Erde von Strecke zu Strecke haufenweise an die Oberfläche der Erde geworfen wird und auf diese Weise die Richtung der Röhren bezeichnet. Die Maulwürfe besuchen ihr Jagdgebiet gewöhnlich dreimal des Tages, morgens früh, mittags und abends. Sie haben daher in der Regel sechsmal täglich von ihrer Wohnung aus und wieder zurück die Laufröhre zu durchlaufen und können bei dieser Gelegenheit, sobald gedachtes Rohr aufgefunden ist, mit Sicherheit in Zeit von wenigen Stunden gefangen werden.«
Das Innere der Baue steht nie unmittelbar mit der äußeren Luft in Verbindung; doch dringt diese zwischen den Schollen der aufgeworfenen Haufen in hinreichender Menge ein, um dem Thiere den nöthigen Sauerstoff zuzuführen. Außer der Luft zur Athmung bedarf der Maulwurf aber auch Wasser zum Trinken, und deshalb errichtet er sich stets besondere Gänge, welche zu nahen Pfützen oder Bächen führen, oder gräbt, wo solche ihm mangeln, besondere Schächte, worin sich dann Regenwasser sammelt. Ein alter Maulwurfsfänger hat häufig an der untersten Stelle tiefer Röhren ein senkrechtes Loch gefunden, welches den Brunnen bildet, aus dem der Maulwurf trinkt. »Manche dieser Löcher«, beschreibt er, »sind von beträchtlicher Größe. Sie waren oft anscheinlich trocken; allein wenn ich ein wenig Erde hineinwarf, überzeugte ich mich, daß sie Wasser enthielten. In diesen Röhren kann der Maulwurf sicher hinab- und heraufrutschen. Bei nassem Wetter sind alle seine Brunnen bis an den Rand gefüllt und ebenso in manchen Arten von Boden auch bei trockner Witterung. Wie sehr der Maulwurf des Wassers benöthigt ist, ergibt sich übrigens aus dem Umstande, daß man bei anhaltender Trockenheit in einer Röhre, welche nach dem Loche oder Wasserbehälter führt, ihrer sehr viele fangen kann.«
Das Graben selbst wird dem Maulwurfe sehr leicht. Mit Hülfe seiner starken Nackenmuskeln und der gewaltigen Schaufelhände, mit denen er sich an einem bestimmten Orte festhält, bohrt er die Schnauze in den lockeren Boden ein, zerscharrt um sich herum die Erdschollen mit den Vorderpfoten und wirft sie mit außerordentlicher Schnelligkeit hinter sich. Durch die Schließfähigkeit seiner Ohren ist er vor dem Eindringen von Sand und Erde in dieselben vollkommen geschützt. Die aufgescharrte Erde läßt er in seinem eben gemachten Gange so lange hinter sich liegen, bis die Menge ihm unbequem wird. Dann versucht er an die Oberfläche zu kommen und wirft die Erde nach und nach mit der Schnauze heraus. Dabei ist er fast immer mit einer l2 bis 15 Centim. hohen Schicht lockerer Erde überdeckt. In leichtem Boden gräbt er mit einer wirklich verwunderungswürdigen Schnelligkeit. Oken hat einen Maulwurf ein Vierteljahr lang in einer Kiste mit Sand gehabt und beobachtet, daß sich das Thier fast ebenso schnell, wie ein Fisch durch das Wasser gleitet, durch den Sand wühlt, die Schnauze voran, dann die Tatzen, den Sand zur Seite werfend, die Hinterfüße nachschiebend. Noch schneller bewegt sich der Maulwurf in den Laufgängen, wie man durch sehr hübsche Beobachtungen nachgewiesen hat.
Ueberhaupt sind die Bewegungen des Thieres schneller, als man glauben möchte. Nicht bloß in den Gängen, sondern auch auf der Oberfläche des Bodens, wo er gar nicht zu Hause ist, läuft er verhältnismäßig sehr rasch, so daß ihn ein Mann kaum einholen kann. In den Gängen aber soll er so rasch gehen wie ein trabendes Pferd. Auch im Wasser ist er, wie bemerkt, sehr zu Hause, und man kennt Beispiele, daß er nicht bloß breite Flüsse, sondern sogar Meeresarme durchschwommen hat. So erzählt Bruce, daß mehrere Maulwürfe an einem Juniabend bei Edinburg gegen zweihundert Meter weit durch das Meer nach einer Insel geschwommen sind, um sich daselbst anzusiedeln. Nicht selten kommt es vor, daß der Wühler über breite Flüsse setzt, und Augenzeugen haben ihn dabei in sehr lebhafter Bewegung gesehen. Auch in großen Teichen bemerkt man ihn zuweilen; er schwimmt hier, den Rüssel sorgfältig in die Höhe gehalten, scheinbar ohne alle Noth und zwar mit der Schnelligkeit einer Wasserratte. Da er nun noch außerdem unter dem Bette selbst großer Flüsse sich durchwühlt und dann am anderen Ufer lustig weitergräbt, gibt es für seine Verbreitung eigentlich kein Hindernis, und mit der Zeit findet er jedes gut gelegene Oertchen sicher auf. So hat man, wie Tschudi sagt, öfters gefragt, wie der Maulwurf auf die Hochebene des Ursernthales komme, welche doch stundenweit von Felsen und Flühen, von einem Schneegebirgskranze und den Schrecken des Schöllenengrundes umgeben ist. »Unseres Erachtens«, bemerkt der genannte Forscher, »darf man sich nicht denken, es habe irgend einmal ein keckes von dem Instinkt geleitetes Maulwurfspaar die stundenweite Wanderung aus den Matten des unteren Reußthales unternommen und sich dann, in der Höhe bleibend, angesiedelt. Die Einwanderung bedurfte vielleicht Jahrhunderte, bis das neue Kanaan gefunden war. Sie ging unregelmäßig, langsam, ruckweise von unten über die Grasplätzchen und erdreichen Stellen der Felsenmauern nach oben, mit vielen Unterbrechungen, Rückzügen, Seitenmärschen, im Winter oft auf den nackten Steinen unter der Schneedecke fort, und so gelangte das erste Paar wahrscheinlich von den Seitenbergen her in das Thal, in dessen duftigen Gründen es sich rasch genug vermehren konnte.«
Die Hauptnahrung des Maulwurfs besteht in Regenwürmern und Kerbthierlarven, welche unter der Erde leben. Namentlich der Regenwürmer halber legt er seine großen und ausgedehnten Baue an, wie man sich sehr leicht überzeugen kann, wenn man einen Pfahl in lockeres Erdreich stößt und an ihm rüttelt. Die Würmer wissen, daß sie an dem Maulwurfe einen Feind haben. Sobald sie die Bewegung verspüren, kommen sie von allen Seiten eilfertig aus der Erde hervor und versuchen, auf der Oberfläche sich zu retten, ganz offenbar, weil sie glauben, daß die Erschütterung von einem wühlenden Maulwurfe herrührte. Außer diesen Würmern und Larven frißt dieser noch Käfer, namentlich Mai- und Mistkäfer, Maulwurfsgrillen und alle übrigen Kerbthiere, welche er erlangen kann, wie ihm auch Schnecken und Asseln besonders zu behagen scheinen. Sein ungewöhnlich feiner Geruch hilft ihm die Thiere aufspüren, und er folgt ihnen in größeren oder kleineren Tiefen, je nachdem sie selbst höher oder niedriger gehen. Aber er betreibt nicht bloß in seinen Bauen die Jagd, sondern holt sich auch ab und zu von der Oberfläche, ja wie man sagt, sogar aus dem Wasser eine Mahlzeit. Die Spitzmaus oder die Wühlmaus, der Frosch, die Eidechse oder Blindschleiche und Natter, welche sich in seinen Bau verirren, sind verloren. »Ich habe«, sagt Blasius, »mehrere Male im Freien beobachtet, daß ein Frosch von einem Maulwurfe überlistet und an den Hinterbeinen unter die Erde gezogen wurde, bei welcher unfreiwilligen Versenkung das unglückliche Opfer ein lautes, klägliches Geschrei ausstieß.« Lenz erfuhr, daß er ebenso auch mit den Schlangen verfährt.
Der Hunger des Maulwurfs ist unstillbar. Er bedarf täglich so viel an Nahrung, als sein eignes Körpergewicht beträgt, und hält es nicht über zwölf Stunden ohne Fraß aus. Flourens, welcher überhaupt wissen wollte, was das Thier am liebsten fräße, setzte zwei Maulwürfe in ein Gefäß mit Erde und legte eine Meerrettigwurzel vor. Am anderen Tage fand er die Wurzel unversehrt, von einem Maulwurfe aber bloß die Haut, das übrige, selbst die Knochen aufgefresssn. Er that sodann den lebenden in ein leeres Gefäß. Das Thier sah schon wieder sehr unruhig und hungrig aus. Nun brachte der Beobachter einen Sperling mit ausgerupften Schwungfedern zu dem Maulwurfe. Dieser näherte sich dem Vogel augenblicklich, bekam aber einige Schnabelhiebe, wich zwei- bis dreimal zurück, stürzte sich dann plötzlich auf den Spatz, riß ihm den Unterleib auf, erweiterte die Oeffnung mit den Tatzen und hatte in kurzer Zeit die Hälfte unter der Haut mit einer Art von Wuth aufgefressen. Flourens setzte nunmehr ein Glas Wasser in das Gefängnis. Als der Maulwurf es bemerkte, stellte er sich aufrecht mit den Vordertatzen auf das Glas und trank mit großer Begierde, dann fraß er nochmals von dem Sperlinge, und jetzt war er vollständig
gesättigt. Es wurde ihm nun Fleisch und Wasser weggenommen; er war aber schon sehr bald wieder hungrig, höchst unruhig und schwach, und der Rüssel schnüffelte beständig umher. Kaum kam ein neuer lebender Sperling hinzu, so fuhr er auf ihn los, biß ihm den Bauch auf, fraß die Hälfte, trank wieder gierig, sah sehr strotzend aus und wurde vollkommen ruhig. Am anderen Tage hatte er das übrige bis auf den umgestülpten Balg aufgefressen und war schon wieder hungrig. Er fraß sogleich einen Frosch, welcher aber auch bloß bis Nachmittag anhielt. Da gab man ihm eine Kröte; sobald er an sie stieß, blähte er sich auf und wandte wiederholt die Schnauze ab, als wenn er einen unüberwindlichen Ekel empfände, fraß sie auch nicht. Am anderen Tage war er Hungers gestorben, ohne die Kröte oder etwas von einer Möhre, Kohl oder Salat angerührt zu haben. Drei andere Maulwürfe, welche Flourens bloß zu Wurzeln und Blättern gesperrt hatte, starben sämmtlich vor Hunger. Diejenigen, welche mit lebendigen Sperlingen, Fröschen oder mit Rindfleisch und Kellerasseln genährt wurden, lebten lange. Einmal setzte der Beobachter ihrer zehn in ein Zimmer ohne alle Nahrung. Einige Stunden später begann der Stärkere den Schwächeren zu verfolgen; am anderen Tage war dieser aufgefressen, und so ging es fort, bis zuletzt nur noch zwei übrig blieben, von denen ebenfalls der eine den anderen aufgefressen haben würde, wäre beiden nicht Nahrung gereicht worden.
Oken fütterte seinen Gefangenen mit geschnittenem Fleische und zwar mit rohem wie mit gekochtem, so wie es gerade zur Hand war. Als dieser Forscher einen zweiten Gefangenen zu dem ersten brachte, entstand augenblicklich Krieg; beide gingen sofort auf einander los, packten sich mit den Kiefern und bissen sich minutenlang gegenseitig. Hierauf fing der Neuling an zu fliehen, der Alte suchte ihn überall und fuhr dabei blitzschnell durch den Sand. Oken machte nun dem Verfolgten in einem Zuckerglase eine Art von Nest zurecht und stellte es während der Nacht in den Kasten. Am anderen Morgen lag der Schützling aber doch todt im Sande. Wahrscheinlich war er aus dem Glase gekommen und von dem früheren Eigner des Gefängnisses erbissen worden, und zwar jedenfalls nicht aus Hunger, sondern aus angeborener Böswilligkeit. Der schwache Unterkiefer war entzweigebissen. Am anderen Tage war auch der Alte verendet, nicht an einer Verwundung, sondern, wie es schien, in Folge von Uebereiferung und Erschöpfung im Kampfe.
Lenz nahm einen frischen und unversehrt gefangenen Maulwurf und ließ ihn in ein Kistchen, dessen Boden bloß 5 Centim. hoch mit Erde bedeckt war, damit er hier, weil er keine unterirdischen Gänge bauen konnte, sich die meiste Zeit frei zeigen mußte. Schon in der zweiten Stunde seiner Gefangenschaft fraß er Regenwürmer in großer Menge. Er nahm sie, wie er es auch bei anderem Futter thut, beim Fressen zwischen die Vorderpfoten und strich, während er mit den Zähnen zog, durch die Bewegung der Pfoten den anliegenden Schmutz zurück. Pflanzennahrung der verschiedensten Art, auch Brod und Semmel, verschmähte er stets, dagegen fraß er Schnecken, Käfer, Maden, Raupen, Schmetterlingspuppen und Fleisch von Vögeln und Säugethieren. Am achten Tage legte ihm Lenz eine große Blindschleiche vor. Augenblicklich war er da, gab ihr einen Biß und verschwand, weil sie sich stark bewegte, unter der Erde. Gleich darauf erschien er wieder, biß nochmals zu und zog sich von neuem in die Tiefe zurück. Dies trieb erwohl sechs Minuten lang; endlich wurde er kühner, packte fest zu und nagte, konnte aber nur mit großer Mühe die zähe Haut durchbeißen. Nachdem er jedoch erst ein Loch gemacht hatte, wurde er äußerst kühn, fraß immer tiefer hinein, arbeitete gewaltig mit den Vorderpfoten, um das Loch zu erweitern, zog zuerst Leber und Gedärme hervor und ließ schließlich nichts übrig als den Kopf, die Rückenwirbel, einige Hautstücken und den Schwanz. Dies war am Morgen geschehen. Mittags fraß er noch eine große Gartenschnecke, deren Gehäuse zerschmettert worden war, und nachmittags verzehrte er drei Schmetterlingspuppen. Um fünf Uhr hatte er bereits wieder Hunger und erhielt nun eine etwa 80 Centim. lange Ringelnatter. Mit dieser verfuhr er gerade so wie mit der Blindschleiche, und da sie aus der Kiste nicht entkommen konnte, erreichte er sie endlich und fraß so emsig, daß am nächsten Morgen nichts mehr übrig war als der Kopf, die Haut, das Gerippe und der Schwanz. Einer Kreuzotter gegenüber, welche ihn unfehlbar getödtet haben würde, wurde sein Muth nicht auf die Probe gestellt; denn er kam durch einen Zufall früher ums Leben. Doch glaubt Lenz, daß er unter der Erde, wo er entschieden muthiger als in der Gefangenschaft und in Gegenwart von Menschen ist, auch wohl eine Kreuzotter angreifen dürfte, wenn diese zum Winterschlafe einen seiner Gänge bezieht und hier von ihm in ihrer Erstarrung angetroffen wird.
Recht deutlich kann man sich an gefangenen Maulwürfen von der Schärfe ihrer Sinne überzeugen. Ich brachte einen Mull in eine Kiste, welche etwa 16 Centim. hoch mit Erde bedeckt war. Er wühlte sich sofort in die Tiefe. Nun drückte ich die Erde fest und legte fein geschnittenes, rohes Fleisch in eine Ecke. Schon nach wenig Minuten hob sich hier die Erde, die feine, höchst biegsame Schnauze brach durch, und das Fleisch wurde verzehrt. Der Geruch befähigt ihn, die Nahrung zu entdecken, ohne sie zu sehen oder zu berühren, und führt ihn erfolgreich durch seine verwickelten, unterirdischen Gänge. Alle Manlwurfsfänger wissen, wie scharf dieser Sinn ist, und nehmen deshalb, wenn sie Fallen stellen, gern einen todten Maulwurf zur Hand, mit dem sie die Rasenstücke oder Fallen abreiben, welche sie vorher in ihrer Hand gehabt haben. Die spitzige, äußerst bewegliche Nase dient ihm zugleich als Tastwerkzeug. Dies sieht man hauptsächlich dann, wenn der Mull zufällig auf die Oberfläche der Erde gekommen ist und hier eine Stelle erspähen will, welche ihm zu raschem Eingraben geeignet scheint. Er rennt eilig hin und her und untersucht tastend überall den Grund, bevor er seine gewaltigen Grabwerkzeuge in Thätigkeit setzt. Auch während er eifrig gräbt, ist diese Nase immer sein Vorläufer nach jeder Richtung hin. Das Gehör ist vortrefflich. Wahrscheinlich wird es besonders benutzt, um Gefahren zu entgehen; denn der Maulwurf vernimmt nicht bloß die leiseste Erschütterung der Erde, sondern hört auch jedes ihm bedenklich erscheinende Geräusch mit aller Sicherheit und sucht sich dann so schnell als möglich auf und davon zu machen. Daß der Geschmack hinter diesem Sinne zurücksteht, geht schon aus der Vielartigkeit der Nahrung und aus der Gier hervor, mit welcher er frißt. Er gibt sich keine Mühe, erst zu untersuchen, wie eine Sache schmeckt, sondern beginnt gleich herzhaft zu fressen, scheint auch zu zeigen, daß ihm so ziemlich alles Genießbare gleich sei. Deshalb ist jedoch noch nicht abzuleugnen, daß auch sein Geschmackssinn rege ist, nur freilich in einem weit untergeordneteren Grade als die vorher genannten Sinne. Hinsichtlich des Gesichtes will ich hier nur an die bereits in der Einleitung angeführten hochdichterischen Worte unseres Rückert erinnern; übrigens weiß man, daß der Maulwurf sich nach diesem Sinne richtet, wenn er schwimmend Ströme übersetzt, welche ihm zum Unterwühlen zu breit sind. Sobald er sich in die Notwendigkeit versetzt sieht, zu schwimmen, legt er augenblicklich die das Auge umgebenden Haare auseinander und zeigt die kleinen, dunkelglänzenden Kügelchen, welche er jetzt weit hervorgedrückt hat, um sie besser benutzen zu können.
Schon aus dem bis jetzt Mitgetheilten ist hervorgegangen, daß der Maulwurf im Verhältnis zu seiner Größe ein wahrhaft furchtbares Raubthier ist. Dem entsprechen auch seine geistigen Eigenschaften. Er ist wild, außerordentlich wüthend, blutdürstig, grausam und rachsüchtig, und lebt eigentlich mit keinem einzigen Geschöpfe im Frieden, außer mit seinem Weibchen, mit diesem aber auch bloß während der Paarungszeit, und so lange die Jungen klein sind. Während des übrigen Jahres duldet er kein anderes lebendes Wesen in seiner Nähe, am allerwenigsten einen Mitbewohner in seinem Baue, ganz gleichgültig, welcher Art dieser sein möge. Falls überlegene Feinde, wie Wiesel oder Kreuzotter, seine Gänge befahren, und zwar in der Absicht, auf ihn Jagd zu machen, muß er freilich unterliegen, wenn er auf diese ungebetenen Gäste trifft; mit ihm gleich kräftigen oder schwächeren Thieren aber kämpft er auf Leben und Tod. Nicht einmal mit anderen seiner Art, seien sie nun von demselben Geschlecht wie er oder nicht, lebt er in Freundschaft. Zwei Maulwürfe, die sich außer der Paarungszeit treffen, beginnen augenblicklich einen Zweikampf miteinander, welcher in den meisten Fällen den Tod des einen, in sehr vielen anderen Fällen aber auch den Tod beider herbeiführt. Am eifersüchtigsten und wüthendsten kämpfen erklärlicherweise zwei Maulwürfe desselben Geschlechts miteinander, und der Ausgang solcher
Gefechte ist dann auch sehr zweifelhaft. Der eine unterliegt, verendet und wird von dem anderen sofort aufgefressen. So ist es sehr begreiflich, daß jeder Maulwurf für sich allein einen Bau bewohnt und sich hier auf eigne Faust beschäftigt und vergnügt, entweder mit Graben und Fressen oder mit Schlafen und Ausruhen. Fast alle Landleute, welche ihre Betrachtungen über das Thier angestellt haben, sind darin einig, daß der Maulwurf drei Stunden »wie ein Pferd« arbeite und dann drei Stunden schlafe, hierauf wieder dieselbe Zeit zur Jagd verwende und die nächstfolgenden drei Stunden wieder dem Schlafe widme u. s. f.
Ein anderes Leben beginnt um die Paarungszeit. Jetzt verlassen die liebebedürftigen Männchen und Weibchen zur Nachtzeit häufig ihren Bau und streifen über der Erde umher, um andere Maulwurfspaläste aufzusuchen und hier Besuche abzustatten. Es ist erwiesen, daß es weit mehr Männchen als Weibchen gibt, und daher treffen denn auch gewöhnlich ein Paar verliebte Männchen eher zusammen als ein Maulwurf mit einer Maulwürfin. So oft dies geschieht, entspinnt sich ein wüthender Kampf und zwar ebensowohl über als unter der Erde oder hier und dort nacheinander, bis schließlich der eine sich für besiegt ansieht und zu entfliehen versucht. Endlich, vielleicht nach mancherlei Kampf und Streit, findet der männliche Maulwurf ein Weibchen auf und versucht nun, es mit Gewalt oder Güte an sich zu fesseln. Er bezieht also mit seiner Schönen entweder seinen oder ihren Bau und legt hier Röhren an, welche den gewöhnlichen Jagdröhren ähneln, aber zu einem ganz anderen Zwecke bestimmt sind, nämlich um das Weibchen darin einzusperren, wenn sich ein anderer Bewerber für dasselbe findet. Sobald er seine liebe Hälfte derartig in Sicherheit gebracht hat, kehrt er sofort zu dem etwaigen Gegner zurück. Beide erweitern die Röhren, in denen sie sich getroffen haben, zu einem Kampfplatze, und nun wird auf Tod und Leben gefochten. Das eingesperrte Weibchen hat inzwischen sich zu befreien gesucht und, neue Röhren grabend, weiter und weiter entfernt; der Sieger, sei es jetzt der erste oder zweite Bewerber, eilt ihm jedoch nach und bringt es wieder zurück, und nach mancherlei Kämpfen gewöhnen sich die beiden mürrischen Einsiedler auch wirklich aneinander. Jetzt graben sie gemeinschaftlich Sicherheits- und Nahrungsröhren aus, und das Weibchen legt ein Nest für ihre Jungen an, in der Regel da, wo drei oder mehr Gänge in einem Punkte zusammenstoßen, damit bei Gefahr möglichst viele Auswege zur Flucht vorhanden sind. Das Nest ist eine einfache, dicht mit weichen, meist zerbissenen Pflanzentheilen, hauptsächlich mit Laub, Gras, Moos, Stroh, Mist und anderen derartigen Stoffen ausgefütterte Kammer und liegt gewöhnlich in ziemlich weiter Entfernung von dem früher geschilderten Kessel, mit dem es durch die Laufröhre verbunden ist. Nach etwa vierwöchentlicher Tragzeit wirft das Weibchen in dieses Nest drei bis fünf blinde Junge, welche zu den unbehülflichsten von allen Säugern gerechnet werden müssen. Sie sind anfangs nackt und blind und etwa so groß wie eine derbe Bohne. Aber schon in der frühesten Jugend zeigen sie dieselbe Unersättlichkeit wie ihre Eltern und wachsen deshalb sehr schnell heran. Die Mutter gibt die größte Sorgfalt für die Erhaltung ihrer Kinderschar kund und scheut keine Gefahr, wenn es deren Rettung gilt. Wird sie zufällig mit den Jungen aus dem Boden gepflügt oder gegraben, so schleppt sie dieselben im Maule in ein nahes Loch oder in einen Moos-, Mist- oder Laubhaufen etc., und verbirgt sie hier vorläufig so eilig als möglich. Aber auch das Männchen nimmt sich, wie behauptet wird, ihrer an, trägt ihnen Regenwürmer und andere Kerbthiere zu, theilt bei Ueberfluthungen redlich die Gefahr und sucht die Jungen im Maule an einen sicheren Ort zu schaffen. Nach etwa fünf Wochen haben diese ungefähr die halbe Größe der Alten erreicht, liegen jedoch immer noch im Neste und warten, bis eines von den Eltern ihnen Atzung zuträgt, welche sie dann mit unglaublicher Gier in Empfang nehmen und verspeisen. Wird ihre Mutter ihnen weggenommen, so wagen sie sich wohl auch, gepeinigt vom wüthendsten Hunger, in die Laufröhre, wahrscheinlich um nach der Pflegerin zu suchen; werden sie nicht gestört, so gehen sie endlich aus dem Neste heraus und selbst auf die Oberfläche, wo sie sich necken und miteinander balgen. Ihre ersten Versuche im Wühlen sind noch sehr unvollkommen: sie streichen ohne alle Ordnung flach unter der Oberfläche des Bodens hin, oft so dicht, daß sie kaum mit Erde bedeckt sind, und versuchen es nur selten, Haufen aufzuwerfen. Aber die Wühlerei lernt sich mit den Jahren, und im nächsten Frühjahre sind sie schon vollkommen geschult in ihrer Kunst. Ungeachtet man junge Maulwürfe vom April an bis zum August und noch länger findet, darf man doch nicht annehmen, daß das Weibchen zweimal im Jahre wirft, hat vielmehr Ursache zu vermuthen, daß die Paarungs- und demzufolge auch die Wurfzeit in verschiedene Monate fällt.
Der Maulwurf hält keinen Winterschlaf wie mancher andere Kerbthierjäger, sondern ist Sommer und Winter in ewiger Bewegung. Er folgt den Regenwürmern und Kerbthieren und zieht sich mit ihnen in die Tiefe der Erde oder zur Oberfläche des Bodens empor, gerade so, wie sie steigen oder fallen. Nicht selten sieht man Maulwürfe im frischen Schnee oder in tief gefrorenem Boden ihre Haufen aufwerfen, und unter dem weichen Schnee unmittelbar über dem vereisten Boden machen sie oft große Wanderungen. Glaubwürdige Fänger haben berichtet, daß sie sich sogar Wintervorräthe anlegen sollen: eine große Menge Würmer nämlich, welche theilweise, jedoch nicht lebensgefährlich, verstümmelt würden, und ebenso, daß in strengen Wintern diese Vorrathskammern reicher gespickt wären als in milden etc. Diese Thatsache bedarf der Bestätigung, wie es überhaupt über den Maulwurf noch viel zu beobachten gibt.
Wie, wird man fragen, ist es möglich, ein so versteckt lebendes Thier überhaupt zu beobachten? Darauf muß ich antworten, daß die Naturforscher einen großen Theil ihres Wissens alten, erprobten Maulwurfsfängern verdanken, welche sie auf diese oder jene Eigenschaften des Thieres aufmerksam gemacht haben und geradezu die ersten Lehrmeister geworden sind. Außerdem hat man sehr viel von den gefangenen Maulwürfen gelernt, jede gewonnene Beobachtung, wie es bei der Wissenschaft überhaupt zu geschehen pflegt, auf das sorgfältigste aufbewahrt und so schließlich ein klares Bild bekommen. Von der Art und Weise der Beobachtung will ich bloß ein Beispiel anführen. Lecourt wollte die Schnelligkeit des Maulwurfs in seinen Gängen untersuchen, und wandte zu diesem Zwecke ein ebenso geeignetes als ergötzliches Mittel an. Er steckte eine Menge von Strohhalmen reihenweise in die Laufröhre, so, daß sie von dem dahineilenden Maulwurf berührt und in Erschütterung gebracht werden mußten. An diese Strohhalme befestigte er oben kleine Papierfähnchen und ließ jetzt den in seinem Jagdgebiete beschäftigten Maulwurf durch einen Hornstoß in die Laufröhre schrecken. Da fielen denn die Fähnchen der Reihe nach in demselben Augenblicke ab, in welchem sie der Maulwurf berührte, und der Beobachter mit seinem Gehülfen bekam hierdurch Gelegenheit, die Schnelligkeit des Laufens für eine gewisse Strecke mit aller Sicherheit zu ermitteln. Die Baue kann man sehr leicht kennen lernen, indem man sie einfach ausgräbt; die Art des Wühlens sieht man bei gefangenen Maulwürfen; die ausgewühlten Kampfplätze und Zweikämpfe zwischen liebenden Bewerbern hat man entdeckt, indem man den Lärm des Kampfes vernahm und die Thiere schnell ausgrub etc.
Es läßt sich nicht leugnen, daß der Maulwurf durch Wegfangen der Regenwürmer, Maulwurfsgrillen, Engerlinge und anderer verderblicher Kerbthiere großen Nutzen stiftet, und er wird deshalb an allen Orten, wo man seine aufgeworfenen Haufen leicht wegschaffen kann, immer eines der wohlthätigsten Säugethiere bleiben. Allein ebenso gewiß ist, daß er in Gärten nicht geduldet werden darf, weil er hier durch das Durchwühlen der Erde, aus welcher theure Pflanzen ihre Nahrung ziehen, oder durch das Herauswerfen der letzteren den geordneten Pflanzenstaat wesentlich gefährden kann. Auf Wiesen, in Laubwäldern, in Feldfruchtstücken ist er ein Gast, welcher unbedingt geschützt werden sollte, an anderen Orten verursacht er unsäglichen Aerger und Schaden. Man kennt viele Mittel, um ihn zu vertreiben, thut aber jedenfalls am besten, wenn man letzteres einem alten, erfahrenen Maulwurfsfänger überträgt, da dieser bekanntlich auf jedem Dorfe zu finden ist, und die Kunst, ihn auszurotten, weit besser versteht, als Beschreibungen sie lehren können. Nur ein einziges Mittel will ich angeben, weil dasselbe noch ziemlich unbekannt und von großem Nutzen ist. Wenn man einen Garten oder einen anderen gehegten Platz mit Sicherheit vor dem Maulwurfe schützen will, braucht man weiter nichts zu thun, als ringsum eine Masse klar gehackter
Dornen, Scherben oder andere spitze Dinge, etwa bis zu einer Tiefe von 60 Centim. in die Erde einzugraben. Eine solche Schutzmauer hält jeden Maulwurf ab; denn wenn er sie wirklich durchdringen will, verwundet er sich an irgend einer Spitze im Gesicht und geht dann regelmäßig sehr bald an dieser Verwundung zu Grunde.
Außer dem Menschen hat der Maulwurf viele Verfolger. Iltis, Hermelin, Eulen und Falken, Bussard, Raben und Storch lauern ihm beim Aufwerfen auf, das kleine Wiesel verfolgt ihn sogar in seinen Gängen, wo er, wie oben bemerkt, auch der Kreuzotter nicht selten zum Opfer fällt. Pinscher machen sich ein Vergnügen daraus, einem grabenden Maulwurf aufzulauern, ihn mit einem plötzlichen Wurfe aus der Erde zu schleudern und durch wenige Bisse umzubringen. Nur die Füchse, Marder, Igel und die genannten Vögel verzehren ihn, die anderen Feinde tödten ihn und lassen ihn liegen.
Bei uns zu Lande bringt der getödtete Maulwurf fast gar keinen Nutzen. Sein Fell wird höchstens zur Ausfütterung von Blaserohren oder zu Geldbeuteln verwendet. Die Russen verfertigen aus demselben kleine Säckchen, mit denen sie bis nach China Handel treiben.
Der Maulwurf hat ebenfalls zu fabelhaften Geschichten Anlaß gegeben. Die Alten hielten ihn für stumm und blind und schrieben seinem Fette, seinem Blute, seinen Eingeweiden, ja selbst dem Felle wunderbare Heilkräfte zu. Heutigen Tages noch besteht an vielen Orten der Aberglaube, daß man von dem Wechselfieber geheilt werde, wenn man einen Maulwurf auf der flachen Hand sterben lasse, und manche alte Weiber sind fest überzeugt, daß sie Krankheiten durch bloßes Auflegen der Hand heilen könnten, wenn sie diese vorher durch einen aus ihr sterbenden Maulwurf geheiligt hätten.
Ich finde es sehr erklärlich, daß ein Thier, welches in seinem Leben so wenig bekannt ist, dem gewöhnlichen Menschen als wunderbar oder selbst heilig erscheinen muß: denn eben da, wo das Verständnis aufhört, fängt das Wunder an.
Von allen Verwandten des Maulwurfs erwähne ich nur noch den Blindmull ( Talpa caeca), welcher im Süden Europas und namentlich in Italien, Dalmatien und Griechenland, seltener in Südfrankreich vorkommt. Seinen Namen erhielt er, weil eine feine, durchschimmernde Haut seine überaus kleinen Augen überzieht. Sie ist dicht vor den Sternen von einer ganz feinen, schrägen, nicht klaffenden Röhre durchbohrt, durch welche das Auge nicht sichtbar wird. Außerdem unterscheidet sich das Thier nur sehr wenig von seinem Verwandten, vor allem durch den längeren Rüssel, die breiteren Obervorderzähne und noch andere geringere Eigenthümlichkeiten im Gebiß sowie die anstatt grau-, weißbehaarten Lippen, die Füße und den Schwanz. Das dichte, sammtähnliche Haar des Körpers ist dunkelgrauschwarz mit bräunlichschwarzen Spitzen. In der Größe bemerkt man kaum einen Unterschied.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß der blinde Maulwurf schon den Alten bekannt gewesen ist. Aristoteles erwähnt ihn unter dem Namen Aspalax; denn gerade die Beschreibung dieses vortrefflichen Naturforschers beweist, daß er unseren Maulwurf gar nicht gekannt, sondern den südlichen vor sich gehabt habe. In der Neuzeit haben einige Forscher behauptet, den Blindmull auch im äußersten Norden von Deutschland gefunden zu haben. Dieses Thier legt sich weniger ausgedehnte Röhren an als der gemeine Maulwurf, geht auch nicht so tief unter die Oberfläche hinab wie dieser, ganz wie es mit seinen heimatlichen Verhältnissen im Einklange steht. Das Nest für die Jungen legt er in seiner Wohnkammer an, im übrigen aber ähnelt er seinem Vetter in jeder Hinsicht.