
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der Tenor als romantischer Held: so wurde Manuel del Populo Garcia 1828 in Paris empfangen, das ihn seit zwanzig Jahren zu seinen merkwürdigsten Künstlererscheinungen zählte. Er hatte es gewagt, italienische Oper nach Amerika zu tragen, war von New York nach Mexiko gegangen, mehr als auf seine. Kosten gekommen, dann aber, als er sich zur Rückkehr nach Europa bereitete, von Räubern angefallen und beraubt worden. Das stimmte so ganz zu dem Wesen dieses Mannes, der, wie seine Tochter Pauline erzählt, in dem nur von Zigeunern bewohnten Teil der Stadt Sevilla geboren war. Erzzigeuner und Theatermensch, hatte er Glück und Verstand genug, aus seiner Familie eine bemerkenswerte Truppe bilden zu können: außer ihm selbst spielten seine Frau, seine Tochter Marie, sein Sohn Manuel. Und schon wuchs ihm auch in der kleinen Pauline ein Theaterkind heran. In den Memoiren des nach New York verschlagenen Lorenzo da Ponte lesen wir, wie Rossinis Opern, voran der »Barbier von Sevilla« im New Yorker Parktheater einschlugen, wie »Don Giovanni«, angeblich auf Betreiben unseres ruhmredigen Gewährsmannes aufgeführt, in Amerika das erste Wort für Mozart sprach. Man konnte sich freilich keinen besseren Fürsprecher des einen wie des anderen wünschen; denn dieser Garcia hatte schon in Europa Don Juan mit seinem dramatischen Vollblut erfüllt und war von Rossini zum Mitschöpfer des Otello und des Almaviva gemacht worden. Aber neben ihm, der damals schon als Fünfziger mehr durch die Kraft der Darstellung als durch die Schönheit des Gesanges gewann, fiel am stärksten seine blutjunge Tochter Marie auf, eine Zerline und eine Desdemona, aus der Werkstatt des Vaters hervorgegangen, von seinem Blick gebannt, aber doch so völlig eigene Natur, daß sie die Gestalt aus sich heraus schuf. Trotzdem: unfähig, sich der grausamen Zucht des Vaters noch länger zu fügen, war sie schon in New York von der Truppe abgezweigt und hatte einem hergelaufenen französischen Bankier Malibran die Hand nicht geweigert. Doch war sie, nach einem Jahr trüber Eheerfahrungen, über denen Dunkel liegt, früher als ihr Vater nach Paris zurückgekehrt.

Marie Malibran-Garcia
Erbschaft und Schicksal walten hier wundersam. Der Tenor Garcia gibt drei Kindern die Prägung seines Geistes. Und eine Stufe des Schöpferischen wird erreicht, wie sie die Geschichte des dramatischen Gesanges noch nicht kannte. Aber mehr noch: das spanische Blut des Vaters ist fruchtbar in einem allgemein künstlerischen Trieb, der nach Betätigung drängt. Alle diese Garcias kennzeichnet eine Willenskraft zum Idealen. Sie ist am unbeugsamsten in dem Vater, gebändigter, weil durch Nebenströmungen beeinflußt, in den Kindern. Aber dieser Vater, der die kleine 1808 geborene Maria als seine Gesangsschülerin wahrhaft martert, der als furchtbarer Otello seiner Tochter als Desdemona körperlichen Schrecken einjagt, gilt ihr doch in der Reife als ihr Verbündeter, dessen frühzeitigen Tod sie beklagt. Hat sie nicht von ihm das Blut, den Willen zum Drama geerbt? Hat nicht er sie den Schmerz gelehrt, aus dem nach ihrem eigenen Geständnis ihre Kunst strömt? Der Mensch, der so eisern, so erbarmungslos sprach und handelte, gab diesen Kindern allen Charakter: nicht blasse, regelmäßige Schönheit, die mühelos zu einem mäßigen Gipfel aufsteigt; sondern Mittel und Anlagen, die erst durch Kampf und Uebung zu glätten sind. Garcia, der dramatische Darsteller, der Kopf, Phantasie, Wirkungswillen, Suggestionskraft, Können und einen wunderbaren Körper ausspielt, ist Schöpfer einer Methode, mit der er ein Sängergeschlecht bilden will. Mehr noch: er schreibt selbst tonadillas, eine Art Vaudevilles, die er nun mit Brio aufführt. Sie vergehen, aber bezeugen seinen unermüdlichen schöpferischen Willen. Kein Wunder, daß er, 1808 kaum am Théatre italien zu Paris erschienen, der führende Mann wird. So führend, daß er später sich mit der Primadonna Catalani entzweit. Italien hat ihn gefeiert, Paris und London haben seine Eigentümlichkeit erkannt. Nun überträgt sich auf seine Nachkommen das Schöpferische und die Methode. Nicht leicht für sie, bei so vielfältiger künstlerischer Anlage ihren Weg zu finden. Sie scheinen für die Bühne bestimmt, könnten aber auch malen, Klavier spielen, komponieren, schreiben; könnten am Ende auch unterrichten. Am sichersten entscheidet sich Maria Felicitas: aller künstlerischer Wille wird durch das Bühnenblut gelenkt. Anders schon Pauline: sie macht Umwege, bevor sie zur Bühne gelangt. Und Manuel, der älteste Bruder, wendet sich bald vom Theater, das seinen glanzlosen Bariton nicht brauchen kann, zur schöpferischen Lehre. Der Erfinder des Kehlkopfspiegels und der Lehrer Stockhausens und Jenny Linds gelangen zu europäischem Ruhm.
Nirgends, so weit wir blicken, leere Virtuosität; überall ein künstlerischer, kulturfreundlicher Wille. Auch scheint in den Menschen unverwüstliche Lebenskraft zu wirken. Nur eine Frau verbraucht sich im Sturmschritt ihres Daseins: Maria. Und von ihr soll zuerst die Rede sein.
*
Der Name Marie Malibran mutet den Deutschen seltsam an. Eine Künstlerin des neunzehnten Jahrhunderts, die eine Welt berauschte und durch ihren frühen Tod verwaiste, scheint einzig dem romanischen und angelsächsischen Teil Europas anzugehören. Damals wurden Künstlernamen zwischen London und Paris geprägt, dem Paris, das in seinem Théatre italien die Talente sammelte, beurteilte, für den Operngroßbetrieb in London reif machte. Das war die Welt. Das von der Fremdherrschaft geknechtete, aber durch Rossini, Bellini, Donizetti reiche Italien hatte sich gewöhnt, diese Namen anzunehmen und in der Mailänder Skala, im Neapler San Carlo auf ihren Goldgehalt zu prüfen. Gewöhnlich war es die Verdoppelung des Trompetenstoßes, der in Paris und London den Weltruhm geschaffen hatte. Deutschland aber lebte von den Abfällen des Ruhms. Die Künstlerdämmerung war ihm bestimmt. Und da diese Malibran als Achtundzwanzigjährige entschwebte, blieb sie dem Deutschen ein Name, weniger klingend als der anderer geringerer Primadonnen. Dem Romanen aber ist sie ein kostbarer Besitz, und so konnte sie noch vor wenigen Jahren in dem Musikhistoriker Arthur Pougin einen schwärmenden Biographen finden. Sein Dithyrambus gipfelt in dem Urteil, daß die Malibran neben Paganini zu stellen sei. Ein wenig zu hoch gegriffen, aber von den Dichtern unterstützt. In London fanden sich kritischere Geister. Aber das Publikum übertönte ihre Stimme und raste.
Sie hatte ja längst, bevor sie in Amerika auftauchte und der Bühne um der Ehe willen scheinbar entsagte, ihre Welt gefunden: in Neapel hatte sie, im Gefolge des Vaters, fünfjährig die Kinderrolle in Paers Agnese gespielt. Das war der Auftakt eines Daseins, das in der Tat in manchem einen Gleichklang mit dem Paganinis zeigt. Auch sie scheint von einer dämonischen Angst vorwärts gepeitscht, von einer Stimme, die sie mahnt, keinen Bruchteil ihres Lebens zu vergeuden, ihre vielfältige Begabung in rasendem Wechsel der Bewegung auszuwerten. Mit heißem Atem stürzt sie sich auf jede künstlerische Arbeit, durchglüht sie mit ihrer Menschlichkeit, ist sich nie gleich, immer unerschöpflich an Einfällen, an Improvisationen. Aber eben ihre Menschlichkeit scheidet sie schon von Paganini, der um diese Zeit begann, Europa in die Knie zu zwingen. Der größte Instrumentalist hatte welthistorischen Zug und verarmte darum menschlich. Die große Primadonna aber hat ihn nicht. Gewiß: sie zeigt oft ein kleines Hirn und ein enges Herz. Doch muß es nicht unbedingt sein. In der Künstlerin Marie Malibran aber finden wir freilich jenen schöpferischen Drang, der sich über alle Regel und Sitte hinwegsetzt, die Verzierungen ohne Rücksicht auf den guten Geschmack ausspinnt, der Situation eine neue überraschende Wendung gibt. Hat sie sich eben auf der Bühne ausgelebt, entzückt sie irgend einen Salon bis in den Morgen mit ihrer Kunst und ihrer Laune, um am nächsten Tage, nach ein paar Stunden Ruhe, hoch zu Roß durch die Felder zu jagen. Zur Probe! Sie nimmt sich kaum Zeit, ein paar Bissen herunterzuwürgen und steht schon wieder auf der Bühne, vor ihrem Publikum, das sie liebt, dessen Händeklatschen sie hören muß, das sie doch aber wieder vergißt, um ganz sie selbst zu sein.
Man höre, wie sie 1827 im Londoner Kingstheater, das eben eine Pasta feiert, bei einem durch den Zufall gegebenen ersten Auftreten ihre ganze Eigenart durchsetzt. Ein Duett in Romeo und Giulietta von Zingarelli führt sie mit Velluti zusammen. Er ist der letzte Kastrat und eben jener, dessen ausschweifende Verzierungen Rossini veranlaßt haben sollen, nun in Zukunft Note für Note der Koloratur vorzuschreiben. Velluti also verziert die Arie Zingarellis wiederum so neu und wirksam, daß der Beifall ihn umtost. Da nimmt die sechzehnjährige Marie Garcia die Verzierung auf, entwickelt, wendet, steigert sie und schlägt den Kastraten, der ihr vor Wut den Arm über dem Ellenbogen kneift und das Wort »briecona«, Schurkin, zuflüstert.
Dabei ist sie keineswegs vollendete Belcantistin. Die Stimme hat Schmiegsamkeit und Umfang erst durch hartnackigste Studien erreicht, hat den Triller den Schlägen eines Vaters zu danken, der ihr mit seinem Auge, mit seinem Willen alles suggerieren konnte, und ist sicher nie zum höchsten Ausgleich der Lagen gelangt. Ihr Vervollkommnungstrieb war unermüdlich, aber ihr Temperament immer auf dem Sprunge, die reine Stimmschönheit zu überholen und ins Charakteristische umzuwandeln, und ihre Wärme so durchdringend, daß sie ihrem unfehlbaren Ohr den Weg vorschrieb. Der Timbre einer Stimme, die von der Kontraaltlage bis in den hohen Sopran reichte und ihr daher gestattete, Alt- und Sopranpartien zu singen, zeigte ihre besondere Mischung von Sinnlichkeit und Empfindung und begründete ein Eigenwesen, das überall sieghaft blieb. Aber es war untrennbar von der Erscheinung dieser Frau, die nicht schön, nicht groß, für jene Zeiten zu schlank, zu blaß, kurz, ein Bild der Unregelmäßigkeit war, aber durch den Ausdruck des dunklen Auges, die bedenkenlose Hingabe, den blitzhaften Einfall, die plötzliche naturhafte Geste alle Dämme der Konvention auch im Publikum niederriß. Wer so schafft, kann sich nicht gleich sein. So wuchs auch sie oft aus der völligen Gleichgültigkeit oder Niedergeschlagenheit der Alltagslaune in die Hingerissenheit des schöpferischen Augenblicks hinein. Rasch wechselte in ihr, dem Bündel Nervenfasern, Heiterkeit und Trübsinn. Ihr Bühnenleben sprach das aus. Sie war nicht geboren, klassisch zu werden wie die Pasta, die in beharrlicher Arbeit sich vervollkommnete, aber alle Leidenschaft durch die Bewußtheit umfärbte und bei aller Wandlung nie überraschte. Die nach antikem Geiste strebende und doch vom Hauch der Moderne berührte Gestalt der Pasta, die ein Stendhal, ein Delacroix über alle stellten, Norditalien feierte, Neapel aber kühl ablehnte, steht als stärkster Gegensatz zu Marie Malibran.
Es kam die Stunde, wo sie zu leidenschaftlichen Vergleichen herausforderten, ja, wo die eine der anderen ohne üblen Wettbewerb doch im Herzen von schaffenden Meistern gefährlich wurde. Bekanntlich hat Rossini für keine von beiden geschrieben. Aber seine Begeisterung gehörte der Malibran. Man hatte in der Desdemona der Pasta, die Ruhm, Unschuld, Anmut, Rührung in stetem Ausbau der Rollen bis zur letzten Harmonie vereinigte, ein unerreichbares Vorbild gesehen. Nun aber spielt die Malibran die vom Dolch Otellos bedrohte Desdemona ganz ohne die unschuldige Gelassenheit, sondern wie ein junges Mädchen, das die Angst vor dem nahen Tode toll macht. Ihr Vater hat sie ja einmal Furcht gelehrt. Das bleibt ihr unauslöschlich. Sie rast im Zimmer umher und sucht nach Ausgängen. Aber das ist es nicht allein: allmählich hat sich auch ihre ererbte Willenskraft gefestigt. »Die Malibran spielte«, sagt Musset, »die Desdemona als Venetianerin und als Heroine; Liebe, Zorn, Schrecken, alles in ihr war zündend; selbst ihre Melancholie atmete Tatkraft, und die Romanze von der Weide kam von ihren Lippen wie ein langes Schluchzen«. Wer sie so gesehen und dann die Rosine schalkhaft und lustig die Verbindungsfäden mit Almaviva knüpfen sah, hatte Grund zu staunen. Staunen und Rührung aber führten Bellini in ihre Arme, als er sie am 1. Mai 1833 im Drury Lane Theater zu London als Amina in der Sonnambula hörte. Man bedenke: die dolce lingua del sol war durch die englische Sprache, die unmusikalischste der Welt, abgelöst. Marie Malibran, Sprachvirtuosin wie alle Glieder der Familie Garcia, wußte auch sie, ohne echt englisch zu »kauen«, klingend zu machen. Und inmitten aller Mittelmäßigkeiten, die sie umgaben und den schwer betroffenen Bellini entsetzten, tröstete ihn sie allein, die er nicht kannte. Im Allegro der letzten Szene aber, zumal bei den Worten: »Ah m'abbraccia« hatte sie den Akzent einer Leidenschaft, die ihn alle Zurückhaltung vergessen und laut brava! rufen ließ. Es gab ein neues Schauspiel auf der Bühne.
So war Bellini, dessen Muse eben noch die Pasta gewesen war, für die Malibran gewonnen, die auch in Italien die Wege der Meisterin kreuzte und den Nachhall ihrer Kunst schwächte. Das Geschick wollte freilich nicht, daß sie auch Bellinis Muse wurde. Die Primadonna, immer bereit, Neues zu singen und jungen Talenten aufzuhelfen, hat ihrem Spielplan aber auch »Fidelio« eingereiht. Das »Töt erst sein Weib« in der Kerkerszene läßt alles erschauern.
Schon aber ist es für die Ahnungsvolle Lebensabend geworden. Sie hat das wildeste Auf und Ab von Leidenschaft, aber doch eigentlich kein Glück erlebt. Sie blutet aus einer inneren Wunde. Nie hat sie die Ereignisse ihrer Ehe erzählt. Da scheint etwas in ihr zerbrochen zu sein. Ein Unwürdiger hat sie gepflückt. Sie schleppt die Ketten dieser Heirat bis 1835, wo sie endlich ihrem Geliebten, dem Geiger de Bériot gehören darf. Es ist eine ewige Sehnsucht in ihr, und wenn die Menschen sich jubelnd an ihren Wagen hängen, dann ist nicht so ihre Eitelkeit wie ihr Verlangen nach Liebe gestillt.
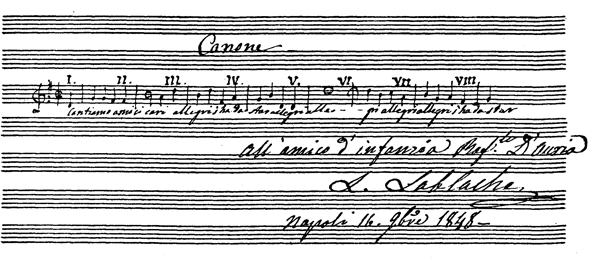
Sie wurde nicht müde zu lernen: von der Pasta, von Caroline Unger, von Madame Pisaroni. Sie wußte, daß alles die Farbe ihres Wesens annehmen würde. Sie konnte freilich auch mokant sein: so wenn sie in einem von Pougin veröffentlichten Briefe das Tonspinnen einer der Sängerinnen mit
![]() darstellt. Ihr liebster Mitspieler war der geniale Buffo Lablache, der sie zuerst nach Italien brachte.
darstellt. Ihr liebster Mitspieler war der geniale Buffo Lablache, der sie zuerst nach Italien brachte.
Wie sie lebte, starb sie. Nach einem Sturz vom Pferde ist sie ohne Rast zur Kunst geeilt. Mit fliegendem Atem, hämmernden Pulsen, verwüstetem Kopf, zwischen Lachkrampf und Ermattung singt sie im September 1836 auf dem Festival von Manchester unaufhörlich, zwingt sich mit übermenschlicher Anstrengung ein Dacapo ab, wird ohnmächtig und stirbt nicht lange darauf. In Brüssel, das ihre zweite Heimat war, auf dem Friedhof von Laeken ist ihr Grab. Alfred de Musset sandte ihr seine Stanzen nach. Die Seele, die aus ihrer Stimme klang, nicht die Kunst beklagte er.
*
Derselbe Musset grüßt die um 13 Jahre jüngere Pauline, als sie nach einem ersten Auftreten in Brüssel 1838 im Théâtre de la Renaissance vor den Parisern erschien. Er findet die Aehnlichkeit zwischen den beiden Schwestern erschreckend. Nicht so sehr in den Zügen wie in der Stimme. Der gleiche Timbre: klar, tönend, kühn, jener spanische zugleich rauhe und süße »coup de gosier«, der dem Klang den Geschmack einer wilden Frucht gibt. Er hört aus ihr dieselbe Seele, das gleiche Genie. Weißgekleidet, die Stirn mit einer schwarzen Kette und einem Diamanten geschmückt, steht sie da, zeigt Anmut und Würde zugleich. Das gütige Dichterauge Mussets sieht über den Mangel jeder Schönheit in diesem Gesicht hinweg, das an die Schwester wohl erinnerte, aber in einem übergroßen Mund zu betont ist. Doch er öffnet sich, und das nicht minder große Auge spricht klug, gütig, leidenschaftlich, phantasievoll mit. Letzte Sicherheit trägt eine nach Tartinis Teufelstriller hergerichtete »Cadence du diable«, die dem Dichter freilich nichts sagt. Seine Sinne aber fassen bald noch mehr. Ganz so gleicht doch Pauline ihrer verstorbenen Schwester nicht. »Die Malibran«, man muß es gestehen, »hat eine Mode aufgebracht: sie überließ sich jeder Bewegung, jeder Geste, griff zu jedem nur möglichen Mittel, um ihre Gedanken auszusprechen. Sie fing plötzlich an, hastig über die Bühne zu schreiten, sie lief, lachte, weinte, schlug sich die Stirn, raufte sich das Haar, warf sich zur Erde; all das, ohne an das Publikum zu denken. Es war ihr echter Ausdruck.« Aber ihre Nachahmerinnen! Der Lärm auf der Opernbühne ist unerträglich geworden, die Uebertreibung ist die Mode. Diese Desdemona hier aber kennt sie nicht. Sie bleibt immer natürlich. Pauline Garcia ist eine sanfte, resignierte, bescheidene Desdemona, ihr Gesang schmerz- und ausdrucksvoll selbst da, wo andere passagenselig in den Konzertstil fallen. Der Dichter grüßte die Debütantin wie die junge Rahel, die er eben noch an der Seite ihrer Mutter, in ihre Rolle vertieft, der Menschen nicht achtend, hatte vorüberfahren sehen. »Soyez les bienvenus, enfants aimés des dieux. Vous avez le même âge et le même génie«. Wird Pauline wie ihre Schwester in die Welt ziehen, anstatt sich Paris zu erhalten?

Pauline Garcia
Der Dichter hat mehr gesehen, als er dachte. Die einander in manchem Familienzug ähnlichen Schwestern gleichen sich doch in wesentlichem nicht. Die Malibran übertrieb aus Leidenschaft, diese tut es nicht. Die Uebertreibung war aus dem Rausch erwachsen. Das Dionysische hatte ein Dasein durchblutet und dann entzwei gerissen. Pauline aber will sich nicht an der Flamme einer Leidenschaft verzehren, sie will lange brennen, ihre Natur, ihr Leben, ihre Gaben eine nach, mit der anderen aussprechen. Lebens- und Geisteskraft sind ihr freundlich. So gelangt sie durch das ganze neunzehnte in das zwanzigste Jahrhundert und stirbt 1910.
Standen wir eben noch unter dem hinreißenden Eindruck einer Malibran, so will das Licht dieses Daseins zu mild scheinen. Aber sehen wir doch näher zu: hier ist Erfüllung. Hier ist alle Naturkraft einer Familie bis zum Höchsten gesteigert, jede Fähigkeit verwertet. Das nächste Geschlecht muß notwendig den Abstieg bringen. Gewiß ist die echte Primadonna jene, die aus dem Rausch den Rausch erzeugt; die nicht Harmonie will, sondern sich rücksichtslos auslebt, ganz wie es ihr Blut befiehlt. Aber zu sehen, wie in dieser Gattung die Kultur durchbricht, ohne doch die Lust am Spiel der Bühne, am bunten Opernflitter aufzuheben, ist von ganz eigenem Reiz.
Pauline Garcia ist etwas Einmaliges: schöpferisch nach vielen Seiten, kulturgesättigt und kulturspendend. Inspiration und Methode verknüpfen sich bei ihr in ungeahntem Grade. Charakter und Idealismus tragen und nähren ihre Kunst. Freilich lebt da schon der Geist eines gebundenen Jahrhunderts, in dem Anständigkeit und Gesinnung viel gilt. Aber Musset hat auch recht, wenn er wehmütig an die Zugvogelnatur des Künstlers dachte. Doch wer ahnte, wohin diese Frau strebte? Anders als ihre Schwester, die das Schicksal fast immer in Westeuropa hielt, wird Pauline zwar in ihrer Laufbahn auch Frankreich und vor allem England, in ihrem innersten Wesen aber Deutschland gehören. Dorthin zieht sie eben ihre Freude am Echten, ihre Verachtung aller Virtuosenleerheit und nicht zuletzt ihr Musikertum. An ihr erleben wir zum ersten Male, wie eine Primadonna eben durch eine ganz bestimmte Art Musik, durch die Weite und Tiefe ihrer musikalischen Auffassung über den reinen Instinkt hinausgeführt wird. Will sie den dionysischen Rausch nicht? Gewiß, sie möchte ihn schon: aber nur als Mittel zum höheren Zweck. Schade nur, daß hier Steine am Wege liegen.
Den Schmerz, der in ihrer Schwester wühlte, kannte Pauline Garcia nicht. Ihr Vater hatte sie nicht gepeinigt. Er war für sie von himmlischer Geduld. Nur eine einzige Ohrfeige will sie von ihm erhalten haben, und zwar machte auch diese Garcia trauriger als die Tochter. Ueberhaupt dieser Vater! Noch hört sie sein weithin schallendes, alle Unglücksgefährten ansteckendes Lachen in der Nacht, die dem allzu gelungenen Raubanfall in der Bergschlucht von Mexiko folgte. Sie kann es nicht vergessen. Ja, dieser Mann faßte das Leben amüsant auf, wußte arm und reich zu sein, ohne sich im geringsten aufzuregen. »Ach«, schreibt sie in ihrem reizenden Deutsch, »schade, daß ich den sonderbaren genialen Mensch nicht habe vollständig kennen lernen gekonnt! Mir ist es immer, als ob wir zwei Freunde hätten sein müssen.« Das Amüsante also lag ihr im Blut. Es vertrug sich mit dem Echten. Auch die Zigeunernatur will sie von dem Vater geerbt haben.
Es gab Anlaß genug, ihr zu folgen. Doch wofür sollte sie sich entscheiden? Rühmt doch Musset die junge Pauline, nachdem sie sich bereits entschieden hat, als »causant comme une artiste et comme une princesse, dessinant comme Granville, chantant comme la soeur«. Und dabei ist noch einiges vergessen. Pauline Garcia spielt Klavier wie eine richtige Pianistin. Sie ist als solche auch in den Konzerten ihrer Schwester aufgetreten. Bei Liszt, der die Garcias liebte, hatte sie studiert und eine Fertigkeit erworben, die ihr gestattete, die dornigsten Transkriptionen zu bewältigen. Das aber ist nicht alles. Schon deutet sich bei ihr auch die Anlage zum Komponieren an. Nur Anlage? Saint-Saens kann die Richtigkeit ihrer Niederschrift nicht genug rühmen. Woher hat sie das? Beinahe schon wahr, daß sie alles weiß, ohne etwas gelernt zu haben. Schamhaft verbirgt sie ihre Schaffensfrüchte und brauchte sich doch ihrer nicht zu schämen; denn Anton Rubinstein zum Beispiel war in ein Lied von rhythmischer Eigenart, das sie lange Zeit hindurch für ein spanisches Volkslied ausgab, toll verliebt. Nicht umsonst hat sie sich Chopin und seinem Kreis genähert. Sie spielt ihn und überträgt seine Mazurken für die Stimme. Das wird sie dann zu passender Zeit in der Oper, etwa in der Gesangsstunde von Rossinis »Barbier« anstatt der furchtbar geschmacklosen Sachen singen, die man sonst hier zu hören pflegt.
Rosine: es ist eine ihrer prächtigsten Leistungen. Da bricht das Amüsante, das Garciasche so recht durch; da kann sie ihren Mezzosopran wie ein Instrument ausspielen. Nun ist sie schon berühmt geworden. Gewiß: sie hat es leicht. Leicht und schwer. Denn scheint sie auch den Faden da aufzunehmen, wo er der Schwester gerissen ist, so ist doch nicht gewiß, ob sie den Vergleichen standhalten wird. Es glückt ihr über Erwarten. Man vergleicht, aber sie gewinnt. Gewinnt an der Seite des Otello Rubini, der, wiederum nach Musset, wunderbar singt, aber wie eine Nachtigall spielt. Nun scheint sie als Primadonna ganz nach der Sitte zwischen Paris und London hin und her zu fliegen. Doch nein: sie ändert die Richtung. Deutschland hat ein Anrecht auf sie. Mendelssohn und Schumann sind romantische Kräfte, die sie anziehen. Immer zunächst entscheidet ihr Musikertum. Das hindert sie nicht, im ersten Dezennium ihrer Laufbahn zwischen dem England, das Mendelssohn ehrt, und zwischen dem Deutschland, in dem sie sich bald heimisch fühlt, einen Spielplan von solcher Buntheit und Vielseitigkeit durchzusingen, wie ihn noch keine Sängerin sich aneignete. Nein, sie hatte nicht nötig, sich etwas anzueignen. Kaum in den Noten gesehen, wurde es ihr Eigentum: Donna Anna, Zerlina, Cenerentola, Norma e tutti quanti. Zu Berlin ist Robert der Teufel mit Pauline Viardot-Garcia als Alice angesagt. Die Isabella wird krank: da singt sie die beiden Frauen. »Jedesmal, wenn ich eine ganz nagelneue Partie zu lernen habe«, schreibt sie, »zerfalle ich in einen halb träumerischen Zustand. Es ist mir, als hätte ich eine kleine Theaterbühne in der Stirn, wo meine kleinen Schauspieler sich bewegen. Selbst in der Nacht, während dem Schlaf sogar, verfolgt mich mein privat Theater – manchmal wird es unerträglich. Nichts hilft dagegen – und so lernen sich meine Rollen von selbst, ohne daß ich brauche laut zu singen, noch vor dem Spiegel zu studieren. Manchmal nur, wenn es mir scheint, daß meine Liliputanische Sängerin sich zu kühn benimmt, dann versuche ich es nach ihr. Diese Art Arbeit, an der ich fast keinen bewußten Teil nehme, ist seltsam, nicht wahr?« Gewiß, recht seltsam. Merkwürdig aber vor allem dieses Zusammenklingen von musikalischen und dramatischen Vorstellungen im Gehirn, das auf eine Riesenassoziationsarbeit ohnegleichen eingestellt ist. Dieses Alleskönnen würde eine Frau geringeren Schlages notwendig zur sogenannten Utilité erniedrigen. Hier aber zeigten sich Stilsicherheit und Urtemperament von so hohem Rang, daß auch die Leistung immer fesselt. So ist sie von Rossini, Mozart, Bellini, Donizetti zu Meyerbeer und gar zum jungen Verdi gelangt, hat zwischen London und Berlin Residenzen und Provinzstädte für sich erobert, scheint also das Leben einer echten Primadonna zu leben, die sich mit Giulia Grisi, mit Tamburini, Lablache, Madame Tuczek auf Du und Du zusammenfindet. Im Grunde verachtet sie ja all das Bühnenvolk, das seine Noten einlernt, sonst aber nichts, keine Phantasie, keine Kenntnis, keinen Geist hat und immer nur noch ein bißchen an Liebe denkt.

Die Liebe in ihr sieht anders aus. Sie hat als Neunzehnjährige Louis Viardot, den damaligen Direktor des Théâtre italien und späteren Begründer der Revue indépendante, einen außergewöhnlich schönen und sehr geistreichen Mann geheiratet. Aber ihr Herz ist da, wo auch ihre Musik lebt: in Deutschland. »Mon mari et Scheffer ont toujours été mes amis les plus chers. Je n'ai jamais pu rendre un autre sentiment en échange du vif et profond amour de Louis, en dépit de toute ma meilleure volonté!« Das schreibt sie dem Manne, den sie liebt; dem Mendelssohnianer Julius Rietz in Leipzig.
Und nun ist diese merkwürdige Frau auch mitten in dem Streit um Wagner und die Zukunftsmusik. Sie muß heftig auch gegen ihren Liszt Partei nehmen, den sie als Menschen liebt, als schaffenden Musiker ablehnt. Nicht umsonst hat sie mit Frau Clara Variationen für zwei Klaviere von Robert Schumann gespielt, nicht umsonst hat sie in Händels und Mendelssohns Oratorien Soli gehalten. Und ihre heimliche Liebe wird Bach, zu dem man sich in Paris damals noch nicht öffentlich bekennen darf.
Paris sieht sie selten. Einmal in diesen Jahren. Aber die Freundin der George Sand, von ihr geschildert als die bleiche Frau, die aus dem Traumzustand zur tätigen Künstlerin erwacht und sich dann völlig verwandelt, die Freundin Ary Scheffers, Bekannte Delacroix' und aller derer, die das Pariser geistige Leben bestimmten, hatte doch immer noch genug Fäden, die sie mit der Hauptstadt verknüpften.
Die Uraufführung von Meyerbeers Prophet, dessen Fides sie ist, am 16. April 1849 hat sie wieder ins Pariser Blickfeld gestellt. Sie ist unbestrittene Meisterin einer Gesangskunst, die man, wie Liszt damals sagt, so gut wie verloren geben muß. Sie ist vornehm und ergreifend. Aber der Kritiker P. Scudo, der ein geschärftes Ohr für italienische Stimmen hat, spürt doch bereits einen Bruch in diesem Mezzosopran. Der hat sich offenbar nicht ungestraft dem musikalischen Heißhunger einer von unaufhörlichen Assoziationen bewegten Frau gefügt, die nichts, was ihr erreichbar schien, ungesungen ließ.
Aber die Meisterin muß mit ihrer Kraft gerade dort zu Diensten sein, wo Probleme sich zeigen: so wenn sie 1859 am Théâtre lyrique Carvalhos in Berlioz' neubearbeitetem Orpheus von Gluck die Titelpartie singt. Da vereinigen sich Stil, Empfindung, Ernst, um eine Neuschöpfung heraufzuführen, die Geheimnisse entsiegelt. Das gleiche Erlebnis bringt »Alceste«. Die Viardot ist wieder Pariserin geworden. Sie wendet sich aber schon 1863 nach jenem Baden-Baden, das damals noch ein mondänes Stelldichein zwischen Deutschland und Frankreich war, freilich nicht ohne der Welt das Schauspiel einer Sängerin zu ersparen, die mit ihrem Stil und ihrem Geist ihre gebrochenen Mittel nicht übertünchen kann. Auch diese Frau, die so ganz oder doch fast ohne Primadonneneitelkeit war, konnte den ehrgeizigen Willen und die Lust am öffentlichen Musizieren auch im Herbst ihrer Kunst nicht zurückdämmen.
Es war ja nicht der Herbst ihres Lebens. Dieses blieb gesegnet durch den vertrauten Verkehr mit Männern wie Turgenjeff, dem Textdichter der Operetten Pauline Viardots, die im häuslichen Kreise aufgeführt wurden; durch die freundschaftlichen Beziehungen mit der gesamten Kunstwelt Europas. Dann aber, als Deutschland ihr 1871 den Schmerz antat, sie als Französin außerhalb der Grenzen zu verweisen, ging sie nach Paris zurück, schuf ihren Salon und unterrichtete. Hätte sie nicht Pianistin sein können? Saint-Saens riet es ihr. Sie wollte nicht und sah lieber Schülerinnen wie Désirée Artôt und Marianne Brandt heranwachsen.
Eine Primadonna, in der die mehrstimmige Instrumentalmusik mit dem Primadonnentum stritt; in der das Drama sich gegen vielfältige musikalische Vorstellungen stieß. In ihr war alles: Geist, Phantasie, Können, Anpassungsfähigkeit; aber weit, weit hatte sie sich von dem Ausgangspunkt alles Primadonnenhaften, von der Sinnlichkeit entfernt, die einer bürgerlichen Zärtlichkeit wich. Sie hatte recht, auf die Mitspieler herabzusehen, die wie Rubini Musik nur mit dem Ohr aufnahmen, die sich kulturfeindlich gegen jeden Zuwachs an Wissen sperrten. Und hatte doch unrecht.
Denn das Geheimnis der starken Wirkung ist der Instinkt, der sich begrenzt. Er spottet der Klugheit, macht einfältig und selig.