
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Ihr seid ein Künstler. ich leugne es nicht,
aber glaubt mir: ein Leben wie das Eure
führt kein der Größe Bestimmter …«
Heinrich Mann (Branzille).
Er war schüchtern eingetreten und aus einer Nützlichkeit eine Notwendigkeit geworden. Er hatte die Wettkämpfe zwischen Primadonna und Kastrat im Winkel erlebt, dann tapfer mitgefochten und war allmählich als ein Stück Männlichkeit beachtet worden. Und wird nun des Kastraten glücklicher Erbe? Halbmann und Mann zugleich. Primadonnenhaft in vielem, aber fähig, seine Geschlechtlichkeit künstlerisch dreiseitig zu entwickeln: zur Weichheit und zur Kraft hin; als lyrischer und als Heldentenor; und auch als Buffo.
Man hatte ja gesehen, wie der Mann für die Verachtung durch die ernste Oper sich rächte. Die rauhe Männlichkeit brach stürmisch hervor und lachte alles Belcanto. Der Baßbuffo war geil, aber gewiß kein verführerischer Mann. Im Gegenteil: als glatzköpfiger Vormund durchkreuzte er gern die Pläne des wahren Verführers, des Tenors, der seine Nichte wollte. Der Tenor hatte seinen Timbre, der ihn seriös machte; er hatte seine Seele, die nach Liebe dürstete. Aber wo ihr ihn auch findet: überall hat er zunächst das Männliche in sich zu verleugnen. In Italien ist er ein Opfer der Leidenschaft für hohe Stimmen, die der Koloratur ihre Leichtbeweglichkeit bieten. Er wird ein Meister des Falsetts. Aber der Kastrat entthront ihn und raubt ihm den Platz des Liebhabers. In Frankreich, wo man sich der Männlichkeit freut und Lully dem Tenor ein gut Teil Arbeit gibt, zwingt man ihn doch, sich als Kontraaltist zu überschrauben. In Deutschland aber scheint der Baß das Sonderrecht auf Männlichkeit zu besitzen. Es ist die Heimat jenes Ludwig Fischer, dessen gewaltiger Stimmumfang und ungewöhnliche Charakterisierungskunst tenorsingender Mitbewerber spottete, nicht nur Frankreich, sogar Italien zur Anerkennung zwang. Derselbe, dem Mozart den dummen, geilen, saufenden, boshaften, kurz: höchst ergötzlichen und kennzeichnenden Osmin zudachte.
Ueberhaupt wirkte dieser Mozart wahrhaft aufrührend auf alle, die er in seinen Kreis zog. Eigentümlich, wie er zuerst für Italien und aus dem Geiste der Koloratur schafft, aber mit der nach dem Ausdruck hinweisenden Magnetnadel schließlich über die Entführung bis zur Zauberflöte gelangt. Was will er denn? »Wer die gabrielli gehört hat, sagt und wird sagen, daß sie nichts als eine Pasagen- und Rouladenmacherin war; und weil sie sie aber auf eine so besondere art ausdrückte, verdiente sie bewunderung, welche aber nicht länger dauerte, als bis sie das 4 te mahl sang … Diese aber (Mlle Weber) singt zum herzen und singt am liebsten Cantabile …« Das ist es: Mozart, der ewige Liebhaber, wollte das Herz … »und in einem Bett schlafen – mag ich mit niemand, als mit meiner zukünftigen Frau – ein lediger Mensch lebt in meinen augen nur halb«. Diese junge Aloysia Weber, werdende Primadonna, ist der wahre Wegweiser Mozarts für Kunst und Liebe. Nun hat er für sie, die eine herzlose Kokotte wurde, die Schwester Constanze eingetauscht. Er suchte Wärme und Zärtlichkeit.
Man hat in Mozart hier nur ein spielerisches Genie, dort einen Künstler von dämonischer Erotik gesehen. Er hat von beidem; er ist spielerisch, er ist Erotiker. Seine Sinnlichkeit aber ist schon von der Bürgerlichkeit ergriffen und gebändigt. Die Sehnsucht nach Wärme und der Geist des Ensembles drücken das aus. Der reine Instinkt will sich nicht mehr ausleben, die Mehrstimmigkeit fängt ihn auf und verteilt ihn auf größere Flächen. Aber Wunderbares vollzieht sich: die immer leise mitschwingende Erotik webt am Ausdruck und am Spielerischen, an der Cantilene und am Ornament. Und alle wühlende Leidenschaft hat ihr Maß. Mozart, der sich entspannen muß, zeigt in seinen Briefen oft eine wahre Lust an Worten, die in keinem Knigge zu finden sind. Der Musiker aber, seiner Sendung stets bewußt, bleibt adlig bei aller Volkstümlichkeit.
Natürlich mußten die Menschen auf der Bühne bald spüren, daß da jemand ihnen den Weg in Neuland wies. Gewiß wollte Mozart die Arie dem Sänger anpassen wie »ein gut gemachtes Kleid«. Und er war ja auch bereit, der Koloratursängerin Cavalieri »Martern aller Arten« zu schenken. Doch nun steht er auf der Bühne, setzt dem Sänger zu, will letzte Ausdrucksmöglichkeiten von ihm erzwingen. In ihm gärt (und das zeigt sehr schön Lert in seinem Mozartbuch) die alte Stegreifkomödie. Harlekin und Hanswurst arbeiten hinter der Szene, ja, geraten manchmal auf die Szene. Figaro, Leporello, Papageno, Blondchen, Susanne wissen von ihnen zu singen. Mehr zu sagen, als zu singen. Denn Mozarts deutsche Oper schafft Verlegenheiten. Hier muß der Schauspieler-Sänger in die Bresche springen. Gut, daß diese Wiener Akteurs Musik im Leibe haben und, wie sie für ihren Gesang den Mund nicht anders zu spitzen brauchen, so auch in der Tonhöhe nie abirren. Und nun ist durch sie für Leben auf der Bühne gesorgt. Zu den geplanten kommen die improvisierten Hanswurstiaden.
Einer aber widersetzt sich allen Neuerungen: der Tenor. Kaum ist er vollwertiges Glied des Ensembles geworden, hat er alle Folgen dieser Rangerhöhung in einer Herabsetzung seiner Menschlichkeit zu spüren. Ein Jahrhundert unermüdlicher, vielseitigster Tätigkeit hat Vorwürfe und Spott, die sich gegen ihn richten, nicht entkräften können. Von den Frauen gehätschelt, von den Männern bespöttelt, hat er nun wirklich die Erbschaft des Kastraten übernommen. Eines scheint ihn freilich über ihn zu erheben: er ist unverstümmelt, im Ausdruck des Erotischen nicht gehemmt. Er gilt als der geborene Eroberer. Doch fragt sich, ob ihm dies günstig ist. Gerade daran scheitert die Vollendung seines Künstlertums. Maßlosigkeit fällt auch ihn. Allerdings ist die künstlerische Anlage gewöhnlich schwach. Denn auch ihn kennzeichnet Zwitterhaftigkeit. Auch in ihm wirken, obwohl kein Messer in sein Geschlecht eingegriffen hat, die gleichen Hemmungen wie im Durchschnittskastraten.
Von allen drei Gattungen der Tenöre ist der lyrische der wesentliche. Das Melos der Männerstimmen wird ihm zunächst anvertraut. Es soll sich naturgemäß in der höchsten erreichbaren Höhe aussprechen. Das drängt den Tenor in eine peinliche Lage. Denn alle anderen Stimmen drängen ihm, in der Sucht sich zu steigern, nach. Er findet sich eingeklemmt zwischen dem Bariton, dem Bassetaille der Franzosen, der Männlichkeit und Weichheit verknüpft, und zwischen dem weiblichen Kontraalt, der den Reiz schillernder Geschlechtlichkeit hat. Doch ist er vielbeneidet und hoch bezahlt. So wagt er es auch, sich in eine Zwangslage zu bringen, in der Hoffnung, sie zu einer Naturlage zu wandeln. Man weiß, daß hohe Stimmen in völliger Reinheit vorzugsweise in unbeschwerten Naturmenschen unter einem Himmelsstrich gedeihen, wo Luft und Licht Versonnenheit und Trübsinn verscheuchen. Immer wieder bildet das Klima Sing- und Sprachorgane, verändert die Funktion den Mechanismus. So schenkt Italien hohe Tenöre, ist auch Südfrankreich reich an ihnen, während Deutschland sie nur schwer aus sich heraus erzeugt. Hier also setzt der Kampf gegen die Natur in dem Augenblick scharf ein, wo die deutsche Oper heranwächst. Der Bariton überschraubt sich gern, um Tenor zu werden. Das führt zu einem Dauerkrampf der Stimmorgane und zehrt Kräfte auf, die Geistiges fördern sollten. Hat doch in Deutschland selbst der echte Tenor, der sein Dasein in diesem Klima nur seiner unbelasteten Frohnatur, seiner völligen Problemlosigkeit dankt, die Gelöstheit der Stimme mit Mühe und Gespanntheit zu erkaufen.
Was bleibt für das Künstlertum übrig? Es ist hier sehr eingeengt. Der singende Tenor hat sich vielfach zu teilen und doch zusammenzufassen. Er hört sich, soll darstellen, sucht den Ausdruck und will die Geste erreichen. Sein Reich ist die Lyrik. Lyrik bedeutet erhöhtes Allgemeingefühl. Wißt Ihr, was es heißt, hier Klang und Ausdruck auf gleicher Höhe zu halten? Das Höchste und zugleich das Schwerste. Nur dem seltenen Künstler gelingt es. Denn anderswo fordert der Rhythmus der Musik zur gleichklingenden Geste, der Charakter der Rolle mehr zur Verstandestätigkeit auf. Aber die Lyrik läßt den Rhythmus erschlaffen, schafft Dehnungen und weist den Künstler darauf, aus seinem inneren Reichtum den Ausdruck und die Ausdrucksgeste zu speisen. Wie wenige Primadonnen haben so viel Künstlertum zu bieten! Und hier nährt doch das Geschlecht den Ausdruck, fördert doch die dem Spiel geneigtere, mimisch und organisch fähigere Weiblichkeit die Geste. Alle Hölzernheit, alles schablonenhafte Armschwingen, alle mimische Unbeweglichkeit, tödliche Verlegenheit des Tenors ist erklärlich und scheint dem Publikum verzeihlich, wenn die Stimme klingt. Man deutet den Ausdruck in sie hinein. Zwischen Flachbildung und Krampfhaftigkeit aber leiden beide, Klang und Ausdruck. Eros ist schwach. Er wird stark in der hellseherischen Persönlichkeit, die Gehirn, Kehle und Glieder blitzhaft verknüpft. Die Reizempfindlichkeit und Ausdrucksgewalt eines Ausnahmetenors bewirken aber heftigere Abspannungen als in der Primadonna. Er folgt als Mensch leicht nur seinem Instinkt, den er ja stillen darf, wird maßlos und zehrt sich auf.
Schon früh hatte Mozart, im Zuge ein neues Sängergeschlecht zu bilden, mit der Steifheit des Tenors und des Kastraten zu kämpfen. In Mailand, bei der Erstaufführung seiner Frühoper »Lucio Silla« übertreibt ein tenorsingender Anfänger die Geste so, daß die Primadonna Gefahr läuft, geohrfeigt zu werden: die vollkommene de Amicis, die dem jungen Mozart wohlwollte. Dahinter aber intrigiert der Kastrat. Dann in München, wo »Idomeneo« in Szene gehen soll, stehen wiederum Halbmann und Tenor nicht weit voneinander. Dem »musico« muß Mozart Note für Note wie einem Kinde eintrichtern, dem Tenor wirft er vor, er singe ohne Geist und Feuer. Das ist Anton Raaff, der berühmteste unter den deutschen Tenören, Schüler Bernacchis, so berühmt, daß selbst ein Mozart früher einmal sagt: »Die aria hat ihm überaus gefallen, mit so einem mann muß man ganz besonders umgehen«. Raaff begleitet ihn auch nach Paris. Aber was hilft's? Mußte er gleich das erste Mal, da er ihn hörte, sich schneuzen, um seine Heiterkeit zu verbergen, so ist er auch mit dem Manne, der gar keine »action« hat, in München höchst unzufrieden. Freilich ist Raaff nun 66 Jahre alt und einer jener Sängergreise geworden, die von ihrem Namen zehren.

Angelica Catalani
Welcher Geist von der »Entführung« an in die Sänger fuhr; wie aus der vergangenen Stegreifkomödiensphäre mit ihrem Ueberfluß an Saufen, Fressen, Prügeln, Liebe, die vielfältige, bezeichnende Alltagsgeste in Singspiel und Oper kamen; wie Buffo und Soubrette in Laune wetteiferten, ist schon angedeutet. Der Tenor ist bei alledem in Nöten, wenn er nicht als Buffo-Pedrillo an der Ausgelassenheit teilnimmt. Wo soll er die Zwanglosigkeit finden, um von erhabener Lyrik zur Alltäglichkeit des Dialogs und zum Seccorecitativ überzugehen! In der Luft der überlegenen Ironie des »Figaro« kann er nicht gedeihen. In »Don Giovanni«, dem Hohenlied der Erotik, ist er der anhängliche, ariensingende Ottavio; in der Märchenschönheit der »Zauberflöte« blüht er trotz dem Hanswurst Papageno als Tamino auf. Aber gerade über seinen ersten ausdrucksarmen Tamino hatte Mozart zu klagen.
Der Meister, der ein neues Geschlecht von Tenören züchtet, ist Rossini. Auch in Italien zwar ist der Tenor in Ausdruck und Geste gebunden. Doch hebt ihn die verschwenderische, dem lockeren Stimmansatz holde Natur über das Durchschnittsmaß des Deutschen empor. Und die Sinnlichkeit einer Musik, die er aus nationalem Geiste geboren fühlt, bahnt sich selbst den Weg zur Wirkung. Man hört von dem Zauber des jüngeren David, der dem Buffone Paccini den Erfolg nicht zu neiden braucht.
Aber wir suchen in dieser durch die Fülle von eitlen,, leeren Genießern, von primadonnenhaften Kastraten gekennzeichneten Menschenklasse den schöpferischen Geist. Da ist er und begnadet die Welt.
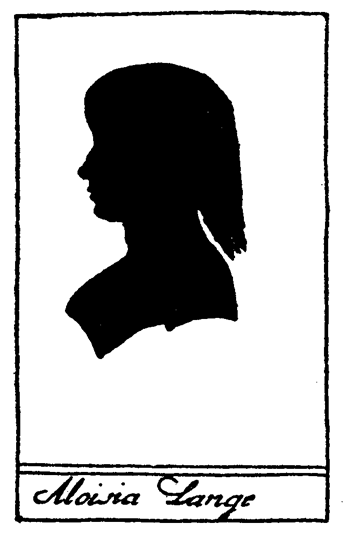
Aloisia Lange (Weber)