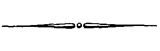|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Nun ich bei Hülsen unter die Zugvögel rechnete, nahm ich diesmal meinen Flug nach London, um beim alten Impresario Colonel Mapleson ein Gastspiel zu absolvieren, das mich beim Publikum in Respekt setzen sollte. Mapleson unterhielt seit Jahrzehnten eine berühmte italienische Opernstagione, erst in Covent Garden, dann im neuen Her Majesty's Theatre, in Haymarket. Er versammelte alljährlich die größten Stars, verstand viel von Kunst, wirtschaftete meist mit Unterbilanz, und obwohl immer in Geldnöten, wußte er sich doch stets mit Geschick aus der Affaire zu ziehen. Er genoß Vertrauen bei Publikum und Künstlern, wenn auch viele so vorsichtig waren, sich ihre Honorare voraus bezahlen zu lassen. Gewöhnlich holte ich mir die meinen am Tage einer Patti-Vorstellung, wartete im Bureau geduldig, bis das Geld an der Tageskasse eingegangen war, und erhielt sie dann prompt ausbezahlt. An geordnete Verhältnisse gewöhnt, schien mir diese Stagionenwirtschaft der englischen Hauptstadt recht unwürdig. Mit ehrlichem Erfolge hatte ich 2 mal Traviata und 2 mal Philine in Mignon gesungen. Die Mignon war zu damaliger Zeit Christine Nilsons beste Rolle; als Margarethe war sie unweiblich, als Elsa benahm sie sich wie ein verkleideter Student. Im zweiten Duett mit Ortrud irrte sie sich, kam ganz heraus, und anstatt sich unauffällig wieder hineinzufinden, lachte sie laut, kehrte dem Publikum den Rücken und sang bis zum Auftritt Lohengrins keinen Ton mehr. Ich konnte Christine Nilson nie mehr sehen, ohne mich ihres unwürdigen Benehmens zu erinnern. – Die einst so herrliche sammetweiche Altstimme der Trebelli war zum reinsten Baß heruntergegangen. Sie sang nur noch kleinere Rollen, wie z. B. den Friedrich in »Mignon«, der bei uns immer vom Tenor gegeben wird. Campanini war nicht nur ausgezeichnet als Lohengrin, Alfredo und Wilhelm Meister, er sang und spielte alles prachtvoll. Galassi, ein guter Bariton, Arditi, ein gewissenhafter, vorzüglicher Dirigent. Diese drei letzten Künstler waren ernst zu nehmen, alles andere nicht immer, obwohl natürlich auch ganz ausgezeichnete Totalvorstellungen vorkamen, über denen ein besonders günstiger Stern waltete. Wenn mein Gastspiel auch nach außen hin strahlte, mir machte es nicht die erwartete Freude. Mapleson, der mir eine große Zukunft prophezeite, bat mich dringend, auszuharren, alljährlich wiederzukommen, weil der Engländer, sobald er sich an einen Künstler erst gewöhnt habe, diesem zeitlebens dankbar bliebe. Wer erst zehn Jahre hintereinander in London gesungen habe, brauche weder Stimme noch sonst etwas, der sei geborgen für alle Zeit. Er hielt mich für die einzig Prädestinierte, in die Fußtapfen der von England und ihm vergötterten Tietjens zu treten, und beschwor mich schon jetzt, Fidelio, Norma, Donna Anna und Valentine zu singen. Da ich aber fühlte, daß ich solchen Aufgaben noch nicht gewachsen, mußten wir beide die Zeit meiner Vervollkommnung abwarten.
Prinzessin Friedrich Karl hatte mir persönlich ein Handschreiben an ihre Tochter, die Herzogin von Connaught mitgegeben, Lord Ampthill und Graf Perponcher, wohl ein Dutzend an einflußreiche Persönlichkeiten. Die Herzogin empfing mich voller Liebenswürdigkeit im Buckinghampalast; Graf Münster, unser damaliger Botschafter, reagierte jedoch gar nicht, und alle andern Schreiben gab ich überhaupt nicht ab, weil Mapleson es für London – wo nur Gewohnheit regiert – für unnütz erklärte. »Gut singen« sei die beste Empfehlung.
Mama und ich wohnten in St. James Street, in einem kleinen französischen Hotel: Dieudonné. Wir hatten einen schönen Salon mit Balkon und ein Schlafzimmer im 1. Stock, schliefen in einem echt englischen Riesenbett zusammen, das uns beiden unbehaglich war. Lagen wir abends nebeneinander und falteten unsere Hände, so glichen wir auf ein Haar steinernen Ehegatten auf einem Sarkophage. Erst als wir uns einzelne Decken geben ließen, klärte sich die Situation. Vor uns hatte Anton Rubinstein das Appartement bewohnt, seine Zigaretten lagen noch darin. Saint-Saëns wohnte neben, ein spanischer Chansonettensänger, Pagans, über uns. Fast die ganze Comédie française aus Paris, die seit mehreren Wochen schon Vorstellungen gab, war im Hause einlogiert, und weiter einige französische Maler, darunter Mr. Poilpot, der sich aller verkommenen Hunde annahm und damit unser Herz gewann.
Madame Dieudonné, eine sehr heitere Witwe, wußte im Verein mit ihren Geschwistern ihren Gästen das Haus angenehm zu machen, das für uns nur manchmal zu lärmend war. Wie man sich denken kann, wurde viel Musik und oft auf Treppen und Gängen bis 2 Uhr nachts Konversation gemacht, obwohl laut polizeilicher Vorschrift das Haus punkt 11 Uhr geschlossen, die Eßräume verdunkelt werden mußten. Kamen wir nach Mitternacht aus der Oper, und die Schauspieler aus der Comédie, so aßen wir alle zusammen bei sorgfältig verschlossenen Läden, und nicht ein lautes Wort durfte gesprochen werden. An Tagen aber, wo kein Theater war, blieben wir nach dem Diner im winzigen Parlour beisammen, wo es dann laut und sehr lustig herging. Der übermütigste von allen war Saint-Saëns, der mich lebhaft an Hans von Bülow erinnerte, der ebenso ausgelassen sein konnte. Saint-Saëns fistelte die Arie der Rosine mit den verrücktesten Fiorituren und Trillern, daß man sich kugeln mochte. Er ahmte sie großartig nach, die »Rosinen« und ihre »Strakochonerien«, wie Rossini einst der jungen Patti bemerkt haben soll, als sie ihm seine Arie mit tausend Änderungen von ihrem Schwager Strakosch vorsang. – Pagans hatte eine ausgeleierte Stimme, doch interessierte mich die Art und Weise, wie dieser Spanier sang, aufs lebhafteste; die melancholischen Weisen erwärmten mich, in denen das in ¼ Tönen gezogene Glissando dem Ohre eigentümlich reizvoll sich einschmeichelte, das wohl einzig den Spaniern eigen ist. – Die Franzosen trugen Szenen vor, und auch ich beteiligte mich mit deutschen Liedern, die mir Saint-Saëns begleitete.
London war mir nicht fremd. Shakespeare hatte mich jeden Stein und Fleck, jedes Haus, jede Straße darin kennen gelehrt von Jugend auf. Shakespeare! Durch ihn kannte ich London, begrüßte es wie einen Freund, wie altes Erinnern. Mit Zärtlichkeit hing ich daran – nein, an Shakespeare hing ich und an allem, was er uns je gegeben. In Museen und Galerien bereicherte ich mein Wissen; tagelang bewunderte ich einzelnes, prägte anderes meinen Gedanken ein. Dann wieder liefen wir viele Stunden lang durch Richmond, Windsor, Virginia-Water usw. durch köstliche Gärten und herrliche Parks. London ist schön bei gutem Wetter und ernst. Was die Sechsmillionenstadt an Schrecklichem hervorbringt, widerte mich hier niemals in dem Maße an wie das, was ich in Paris sah. Die Gleichgiltigkeit des Engländers beruhigt und ermöglicht es, in der enormen Stadt »zu leben«. Dazu gehört persönlicher Wert und Mut, wenngleich der einzelne dort vielleicht noch weniger gilt als an anderen Orten. – Aber die Nebel, die Nebel! die legen sich um Kopf und Herz, sie ersticken jede Freude. Selbst jetzt, im Juni, wälzten sich mittags manchmal dunkle oder gelbe schwefelmassige Wolken ins Zimmer, in dem man selbst bei Licht nichts zu arbeiten vermochte. Die Saison war darum auf die Sommermonate verlegt, weil die Nebel im März und April noch viel intensiver sind. Zu der Zeit kann ein Gastgeber gewärtig sein, 50-100 Gäste nachts in seinem Hause behalten zu müssen, weil sich keiner – weder zu Fuß noch zu Wagen – auf den Straßen zurecht zu finden weiß. Man steht vor seinem Hause und findet den Eingang nicht! – Die furchtbaren Nebel trieben uns denn auch fort, wir sehnten uns nach blauem Himmel, deutschem Boden, deutschen Verhältnissen.
Dennoch kam ich Maplesons Einladung im Mai 1881 wieder nach und sollte nach den bereits gesungenen Rollen auch noch die Aïda singen. Um Mamas Erkältung zu kurieren, zogen wir auf acht Tage nach Brighton, wo ihr Husten nur noch schlechter wurde. Nun ließ ich zum Entsetzen Maplesons London und Aïda laufen, um Mama nach Marienbad zu bringen, wonach sie sich sehnte. Vorher mußte ich aber noch in einem Monstre-Künstlerkonzert in Albert Hall mitsingen zum Benefize Maplesons, das ihm alljährlich eine Riesensumme einbrachte, bei dem alle Künstler unentgeltlich mitwirkten. Diesmal sangen: Patti, Nilson, Gerster, Trebelli, meine Wenigkeit und Frl. Tremelli, recte Tremel, eine Wienerin, die mich frug, ob ich die Halle kenne? Wenn nicht, so sollte ich vor meiner Piece einmal hineinschauen, sonst fiele ich um! – Ich wußte, daß 8000 Menschen drinnen waren, sah nicht vorher hinein und fiel auch nicht um, sang aber meinen Walzer, so gut ich konnte. – Vor unserer Abreise hatten wir auch noch die Freude, meinen alten Onkel Pauli aus Kassel in London zu begrüßen, der zum Besuch seines verheirateten Sohnes dort weilte, und dem wir in der Riesenstadt ganz zufällig beim Tower begegneten, trotzdem er in Canonbury und wir am andern Ende der Welt wohnten.
Riezl, die mich während meines Urlaubs vertreten hatte, war jetzt auch nach London gekommen, und nun brachten wir Mama nach Marienbad. Mir war der Aufenthalt in Bädern immer schrecklich gewesen; so folgten Riezl und ich einer plötzlichen Eingebung und fuhren direkt auf acht Tage nach Rom. Dort genossen wir, was Rom einzig zu bieten vermag. Was aber sind acht Tage für Rom? Wir waren nicht planmäßig vorbereitet und auch nicht reif genug dafür. Heute, wo ich es wäre, diesen unerschöpflichen Genuß in Ruhe durchzuleben, fürchte ich mich vor dem Tierelend Italiens, was jeden Sehnsuchtsgedanken dorthin in mir zuschanden macht. Dies Paradies bleibt mir verschlossen; im Erinnern aber wirken damals Erschautes und Erlebtes vielleicht noch mächtiger auf mich als die moderne römische Wirklichkeit von heute.
Riezls Urlaub war zu Ende, wir mußten uns losreißen von Rom. Ein kleiner Betteljunge mit großen schwarzen Augen stand auf dem Perron, der uns stumm die Hand ans Kupeefenster ausstreckte, während er mit der andern frische Mandeln in den Mund steckte. Eine kleine Münze, die ich ihm hinwarf, verschwand in dem mit Flicken besäten und wieder durchlöcherten Jäckchen und blieb unauffindbar darin versunken. Immer noch sehe ich die schönen Augen, die stumm graziöse Bewegung des kleinen römischen Bettlers, den letzten römischen Eindruck.
Wolkenbrüche hielten uns in Franzensfeste gefangen. Niemand konnte oder wollte den Reisenden Auskunft geben, wie lange der unfreiwillige Aufenthalt dauern würde. Es spielten sich die komischsten Szenen ab. Ein Sachse z. B. wollte sich »ä bißchen die Gägend besähen«, ein anderer partout einen Zug ausfindig gemacht haben, der uns auf einer andern Strecke heimführen sollte, während allenthalben die Schienen unterspült in der Luft hingen. Wir suchten, um nicht im Wartezimmer unter den vielen Menschen zu nächtigen, durch die Gunst eines jungen Beamten ein I. Klasse-Kupee zu gewinnen, worin wir nachts, von Ungeziefer gepeinigt, fast verrückt wurden. In Franzensfeste war alles ratzekahl aufgegessen, da eine Menge Züge eingelaufen waren und alles hier zusammengepfercht blieb. Als wir nach fast 36 Stunden mit Umgehen der zerstörten Strecke weiter befördert wurden, machten die hungrigen Reisenden einen Ausfall auf Stertzing und stürmten das Buffet. Irgendein Mitleidiger gab uns ein Stück von seinem erbeuteten Braten und Brot ab; den schönen Durst stillten wir erst in München mit bestem Eberlbräu.
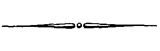
Der Winter 1880 brachte mir eine ersehnte Aufgabe: die Venus im Tannhäuser. Wie lange hatte man mich darauf warten lassen. Lange Jahre war sie in unmöglichen, dann in unzulänglichen Händen. Wußte man denn gar nicht, was man dieser Rolle schuldig war? Wo blieb die geistige Kraft? wo das göttliche Schwelgen in Schönheit, Liebesreichtum und üppigem, verschwenderischem »Sichhingeben«? Man merkte nichts von Triumph, Glück, Verzweiflung oder Zorn. Nichts hörte man als eine Handvoll Noten und sah im besten Falle – eine geschminkte Puppe! Das war doch anders, als Albert Niemann und ich die Szene spielten und sangen! –
Nur wenige Tage später ging Rubinsteins »Nero« mit Niemann, Betz, Mallinger und mir als Poppäa in Szene, eine schwierige aber dankbare Aufgabe für mich, die auch anerkannt wurde, doch sich leider nicht lohnte, weil die Oper nur sechsmal gegeben wurde. – Februar 81 brachte die Neueinstudierung von Mozarts »Idomeneo« mit Niemann, Betz, Brandt, Voggenhuber und mir; eine großartige Vorstellung von seiten meiner Kollegen. »Der Widerspenstigen Zähmung« von Götz kam am 18. März zur Erstaufführung, in der ich Katharina war, und besonders Fricke als Baptista eine mit Humor gewürzte, feinste Leistung bot. Die Oper verblieb auf dem Spielplan. – Man sollte meinen, daß ich mich weder über zu geringe Beschäftigung, noch über schlechte Rollen zu beklagen gehabt hätte. Dennoch hatte ich Ursache dazu, denn man spielte mit mir wie mit einer zweiten Kraft. Die meisten guten Rollen erhielt ich doch nur dann erst, wenn sie andere nicht singen konnten oder aus andern Gründen ablehnten; und plötzlich kam es zwischen Hülsen und mir zu einem offenen Bruch.
Betz hätte gerne schon lange den Hoëel in Meyerbeers »Dinorah« gesungen und bat mich, Hülsen die Oper mit mir, als Dinorah, vorzuschlagen. Das hatte ich auch getan, Hülsen mir aber geantwortet, daß er den D… nicht geben würde. Es war nicht mehr die Rede davon gewesen, als ich eines Tages las, daß die königl. Oper Meyerbeers »Dinorah« einzustudieren gedächte. Sobald ich Hülsen besuchte, sprach ich ihm meine Freude darüber aus, worauf er bemerkte, daß nicht ich, sondern Frl. Em. T. die Rolle singen würde. Mich erhebend, sagte ich kurz: »Dann Exzellenz, erlauben Sie wohl, daß ich meine Entlassung fordere«, worauf er: »Tun Sie, was Sie glauben tun zu müssen«, antwortete. Em. T. war ein schönes junges Mädchen, italienischer Herkunft, für Minni Hauck engagiert, uns von Wien überkommen, wo man sie als Sängerin nicht gebrauchen konnte. Die dortigen Kapellmeister hatten verschiedentlich auf den Proben gesagt: »Jetzt kommt der Triller, den Frl. T. erst lernen wird« und anderes mehr. Ich muß vorausschicken, daß sie nicht nur schön, sondern auch ein liebes Mädchen war, was aber nicht verhinderte, daß die kleine Stimme wie zerbrochenes Glas klang, und daß sie weder gesanglich noch schauspielerisch den geringsten Anspruch auf Künstlerschaft machen konnte, vielleicht gar nicht selber machte, denn sie war bescheiden. Schon bevor sie ihr Engagement antrat, hatte man mir Blondchen, Despina usw. genommen, ohne eine Ahnung zu haben, ob E. T. sie überhaupt würde singen können. Und sie, die mir künstlerisch so untergeordnet, sollte nun die Dinorah singen, die Oper, die man eben noch als D… bezeichnet hatte! Sofort erbat ich bei Sr. Majestät dem Kaiser meine Entlassung, indem ich ihm die Gründe auseinandersetzte, bat Hülsen, durch dessen Hände mein Brief zu gehen hatte, mein Gesuch zu überreichen und mir das Resultat so schnell als möglich bekanntzugeben. Indessen vergingen viele Wochen, ohne daß mir eine Antwort in einer oder der andern Form zuteil geworden wäre. Da mir das Schweigen endlich peinlich ward, ich mich gern mit jemand ruhig und objektiv besprechen wollte, bat ich unsern alten Kollegen Fricke, ob er mich in einer für mich dringenden Angelegenheit besuchen möchte. Andern Tags trug ich ihm alles vor und bat ihn um seinen Rat. Fricke antwortete mir mit den sehr merkwürdigen Worten: »Ja, wissen Sie denn nicht, was über Sie in der Zeitung steht?« – »In welcher Zeitung?« – »Nun, im …« und nannte den Namen. »Was?« frug ich. »Ja, das kann ich Ihnen nicht gut sagen; besorgen Sie sich das Blatt von dem und dem Tag ungefähr.« – Fricke ging und ich stürzte – obwohl es Sonntag war – ins Bureau des Blattes am Gendarmenmarkt. Den Besitzer kannte ich aus Gesellschaften. Im Bureau war nur ein Diener anwesend, der mir auf meinen Wunsch einen ganzen Stoß Zeitungen vorlegte. Ich griff aufs ungefähr hinein, und schon hatte ich die Notiz in Händen. Sie lautete: »Betreffs des Entlassungsgesuchs des Fräulein Lilli Lehmann ist vom Kaiser noch keine Entscheidung gefällt. Wir glauben übrigens erwähnen zu sollen, daß es allem Anscheine nach hauptsächlich Personalverhältnisse sind, welche diesem Entlassungsgesuch zugrunde liegen, und welchem die Frage einer Rollenbesetzung der Hauptsache nach nur zum Vorwande diente; Fräulein Lehmann fühlt sich recht leidend und sieht sich gezwungen, der Bühne eine Reihe von Monaten hindurch fernzubleiben; sie wird dann ohne Frage wieder in der Lage sein, zur Bühne zurückzukehren. Sie hat vielleicht unrecht getan, das Entlassungsgesuch einzureichen, da man ihr den notwendigen Urlaub, wie die Dinge liegen, ja doch nicht verweigern konnte. Daß das Entlassungsgesuch abschläglich beschieden werden wird, haben wir schon erwähnt.« – Am ganzen Körper zitternd, lief ich sofort damit zu Justizrat Laue, ihn um Rat zu fragen. Laue antwortete mir, nachdem er gelesen: »Da können Sie gar nichts tun; es steht absolut nichts darin, wobei man ihn fassen könnte; zwischen den Zeilen kann man natürlich lesen, was man will.« – »Was soll ich dann tun? ihn hauen?« – »O, das werden Sie nicht!« – »Gewiß werde ich das, Herr Justizrat, denn wie soll ich mir Gerechtigkeit verschaffen, wenn ich den Verleumder nicht verklagen kann?« – Der Justizrat lächelte, konnte mir aber nicht helfen. So ging ich schweren Herzens nach Hause und teilte meiner Mutter alles mit, die natürlich außer sich war.
Andern Tags ging ich wieder auf die Redaktion, der Chefredakteur und Besitzer war nicht anwesend; am nächsten Tage ebensowenig. Auch am dritten Tage wurde mir derselbe Bescheid, worauf ich ganz empört fragte: »Der Herr ist wohl nie zu treffen?« Man zuckte die Achsel, und ich mußte wiederum unverrichteter Sache heimgehen. Am vierten Tage wollte ich eben nochmals mein Glück versuchen, als mir beim Fortgehen ein junger Hofschauspieler, Stockhausen, gemeldet wird, den ich abweisen ließ. Herr Stockhausen bat nochmals dringend, vorgelassen zu werden. Ich ließ ihn also eintreten und bitten, sich kurz zu fassen, da ich fortmüsse. Herr Stockhausen, den ich nur von der Theaterloge kannte, machte mir im Begriff, Berlin zu verlassen, – ich weiß eigentlich nicht warum – einen Abschiedsbesuch. Die Zeit drängte, ich ging mit Stockhausen die Treppe hinunter, und er begleitete mich ein paar Schritte. Dabei sagte ich ihm schließlich von meinen mißglückten Versuchen, den Herrn des Blattes zu treffen, und wie ich eben wieder im Begriffe sei, ihn von neuem aufzusuchen. Herr Stockhausen bittet, mich begleiten zu dürfen, ich lehne dankend ab. Wie er aber in mich dringt und meint, daß es doch besser wäre, unter männlichem Schutz den Weg zu unternehmen, gebe ich endlich nach und nehme seine Begleitung an. Diesmal hatte ich mehr Glück. Als ich an der Ecke des Gendarmenmarkt die Gegend überblicke, sehe ich den Herrn Chefredakteur vor mir im Bürohause verschwinden. Ich laufe ihm nach, erwische ihn auf der Treppe, stelle ihn und sage: »Ich habe mit Ihnen zu reden!« Da er an eine Flucht nicht mehr denken konnte, bat er mich, hinaufzukommen, nachdem ich Herrn Stockhausen ihm vorgestellt. Die Herren im Büro machten lange Gesichter und mochten wohl ahnen, daß sie sich auf etwas Besonderes gefaßt machen durften. Als wir in der Stube des Chefredakteurs und Besitzers Platz genommen, begann ich die Inquisition:
»Hier, diese Notiz ist in Ihrem Blatte erschienen!«
»Ja, es tut mir furchtbar leid, daß dieselbe Aufnahme gefunden hat.«
»Von wem ist sie geschrieben?«
»Das weiß ich nicht.«
»Wer ist der verantwortliche Redakteur?«
»Ich.«
»Wie kommt die Notiz ohne Ihr Wissen in das Blatt?«
»Das weiß ich nicht.«
»Da Sie der verantwortliche Redakteur sind, mußten Sie sie doch gelesen haben?«
»Wollen Sie die Sache widerrufen?«
»Gewiß, aber –«
»Wollen Sie die Notiz widerrufen, frage ich, und auch in allen anderen Zeitungen, in welche sie übergegangen ist?«
»Erlauben Sie, dieser Ton –«
»Sie haben gar nichts zu sagen, als ob Sie widerrufen wollen oder nicht; der Ton ist, wie er auf Ihre Notiz gehört. Wollen Sie also?«
»Aber –«
und da konnte ich nicht mehr an mich halten und ohrfeigte den Elenden für die bodenlose Gemeinheit, die er mir und meinem Stande angetan, glaubte antun zu dürfen, ohne sich verantworten zu müssen. Mich umdrehend, fühle ich – nur einen Augenblick – eine Hand an meinem Halse, gleich darauf höre ich etwas krachen. Ohne mich umzusehen, schritt ich hocherhobenen Hauptes, ohne Wort, ohne Gruß durch das Nebenzimmer. Auf der Straße angelangt, brach ich in einem Weinkrampf zusammen. Herr Stockhausen führte mich an eine Droschke, erzählte mir noch, daß der Unwürdige Hand an mich legen wollte, er ihn aber von hinten gepackt, auf ein Sofa niedergeschleudert habe. So war es doch gut, daß ich männlichen Schutz bei mir hatte, und pries den Zufall, der es so günstig gefügt.
Weinend kam ich zu Hause an und konnte nur schluchzend meiner Mutter zurufen: »Er hat sie!« »Um Gottes willen, Lilli, der wird sich an Dir rächen,« rief Mama. »Das wird er bleiben lassen,« erwiderte ich ihr und atmete erleichtert auf im Vollgefühl, eine gute Tat vollbracht zu haben.
Als ich mich abends von dem Schlage erholt hatte, ging ich ins Theater und erzählte es Niemann und Betz, die mich gleich umarmten. Auch in die Redaktion eines anständigen Blattes ging ich, um genauen Bericht aufnehmen zu lassen, damit keine Entstellungen in den Zeitungen erschienen. Bei Siechens wurde es zuerst bekannt, und wie ein Lauffeuer verbreitete sich das Gerücht durch die ganze Stadt. Andern Abends wurden im Büro des »interessanten« Blattes alle Fenster eingeschlagen und dem Chefredakteur eine Katzenmusik gebracht. Ganz Berlin war in Aufruhr. Hülsen ließ mich um meinen Besuch bitten, um mir im Auftrage des Kaisers zu sagen, wie sehr sich derselbe – ohne die Ohrfeige geradezu sanktionieren zu können – über meinen Mut gefreut habe. Hülsen bat mich dringend, mein Entlassungsgesuch zurückzunehmen, er wolle allen meinen Wünschen gerecht werden, ich solle nur bleiben. Ich überlegte mir's zu Hause und stellte meine Bedingungen dahin, daß mir wirklich ein dreimonatlicher Extra-Urlaub bewilligt wurde, den ich zu einem langen Gastspiel in Wien gebrauchte, den man mir nebst andern kleineren Nebenbedingungen gewährte. Das Entlassungsgesuch zog ich zurück, doch war der diesbezügliche Brief nicht aufzufinden und keinesfalls in die Hände des Kaisers gelangt.
Nun regnete es Briefe und Blumen in den nächsten Tagen. Aus allen Gauen Deutschlands erhielt ich Telegramme. Vereine, Studentenverbindungen bedankten sich für die »Heldentat«. Der Herr Chefredakteur hatte viel auf dem Kerbholz. Seit Jahren schon hatte er sich erfrecht, nicht mißzuverstehende Notizen und »interessante« Andeutungen in seinem Blatte zu bringen. Keine, selbst noch so hochstehende, der Öffentlichkeit angehörende Dame, kein junges Mädchen der Aristokratie, Gesellschaft, des Theaters war vor seinen Verleumdungen sicher, und nicht selten war er dafür bedroht worden, aber leider nur bedroht; darum trieb er sein Unwesen ganz gewissenlos weiter, bis er in mir seinen Richter fand. Man war tatsächlich von einem Alp befreit, das merkte ich an den Tausenden von Dankesbriefen und Aufmerksamkeiten, die mir von allen Seiten zuteil wurden.
Wenige Tage darauf war in der Oper: »Der Widerspenstigen Zähmung« das Theater ausverkauft, ich in der Zwischenzeit nicht aufgetreten; das Publikum hatte sich alles aufgespart zu diesem Abend. Frl. Driese, die beim Aufziehen des Vorhangs als Bianca auf der Bühne saß, wurde statt meiner schon empfangen, ein Irrtum, dessen man bald inneward, als ich die Bühne als Katharina betrat. Nun brach er los, der Sturm! Applaus, Geschrei, nicht endenwollendes Blumen- und Kränzewerfen, bis ich vor Rührung und Erregung laut schluchzte und nur mit furchtbarer Energie meiner Aufregung Herr zu werden vermochte. Das Publikum nahm natürlich jede Gelegenheit wahr, Beziehungen zwischen der Affaire und dem Operntext zu entdecken. So brach ein förmlicher Jubel los, als ich Petrucchio anstatt des verlangten Kusses eine kleine Ohrfeige verabreichte. Am Ende des Aktes erhielt ich ein wagenradgroßes Bukett weißer Rosen vom Sportklub mit einer Gerte daran – was nicht nach meinem Geschmack war – das mir den Dank übermitteln sollte für die bis dato ungerächt gebliebenen Angriffe auf aristokratische Kreise. Nach der Oper wünschten Studenten mir die Pferde auszuspannen, doch legte sich die Polizei dagegen ins Mittel. Bei meiner Heimkehr aus der Oper fand ich ein bekränztes Faß Kulmbacher Bier, das mir aus einer Studentenkneipe gesandt ward, deren Besitzer mich um den Handschuh bat, den ich ihm auch sandte, und den er lange unter Glas und Rahmen dort verwahrte.
Wie man sich leicht denken kann, hatte die Sache noch manches Nachspiel; langsam nur beruhigten sich die Gemüter, umso langsamer als alle antisemitischen Blätter gegen meine energischsten Wünsche, die Affäre so recht von Herzen ausnützten. Der Chefredakteur war tot für mich und ganz Berlin. Sein Grab grub er sich selbst.
»Und wenn er nicht gestorben ist
so lebt er heute noch.«