
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Niedergeschrieben um das Jahr 1860 von Frau Ober-Appellgerichtspräsident Amanda von Dall'Armi.
Unser Großvater schrieb seinen Namen: »Löw«.
Onkel Alban Vater von Marie Löw. und seine Töchter schrieben desgleichen: »Löw«.
Unser Vater schrieb: » Loew«. –
Wir Kinder!! malten mit deutschen Buchstaben ihm nach: »Loew«. Komischerweise ist die letzte Schreibart stereotyp geworden.
Die Heidelberger schrieben jedoch immer: »Löw«. –
Unsere vier Urgroßväter hießen:
Nikolaus Loew,
von Traiteur,
Pfister,
de la Condamine.
Ist der Mensch auch allerwärts
Abgestumpft in Kriegeszeiten,
Weil er sieht so viele leiden
Täglich Hunger, Pein und Tod –
Bleibt ihm doch ein warmes Herz
Für eines armen Kindes Not. –
Ich kann die Annalen dieser Geschichte nur bis auf unsere Urgroßväter zurückführen. Von diesen aufwärts zu Adam ist mir nichts bekannt. Demungeachtet unterliegt es keinem Zweifel, daß unsere Vorväter lauter ausgezeichnete Menschen gewesen sind, – wo sollten sonst die herrlichen Enkel herkommen? Aber ihre Verdienste blieben im stillen. – Meine Erzählung beginnt in dem Zeitraum zwischen 1690-1710, und mein erster Blick, obgleich nicht in dieser Stadt meine Geschichte beginnt, fällt auf unsere Vaterstadt Speyer. Wie jammervoll hatten unsere raubgierigen Nachbarn, die Franzosen, die unglückliche, früher so blühende Freireichsstadt zugrunde gerichtet! Nur ein einziges Haus war in dem ganzen Weichbilde unter Dach und Fach geblieben. Es war das Gasthaus zum »Riesen«. Es steht mit seinem Erker in der Maximilianstraße wie ein Denkmal vergangener Zeiten. Alle öffentlichen und alle Wohngebäude waren ein Raub der Flammen geworden, darunter auch die bischöfliche Pfalz. Es war in keinem Falle schön, daß dieses Haus an die Domkirche angebaut war. Man sieht noch jetzt, oder sah wenigstens noch vor 30 Jahren, auf der Westseite des Domes zwei Tore, die noch von der Pfalz herrührten, an der Kirche wie in freier Luft hängen, und ich machte mir als Kind oft Gedanken darüber, zu was denn diese Tore eigentlich da seien, und ob durch sie des Nachts Gespenster zögen. Der Palast selbst soll wunderschön gewesen sein, ein wahres Prachtgebäude. Der Bischof von Speyer hatte jedoch infolge seiner häufigen Streitigkeiten mit der Bürgerschaft seine Pfalz schon in früherer Zeit verlassen und war über den Rhein nach Bruchsal gezogen, woselbst er ein zweites Residenzschloß besaß. In seinem höchsten Glanze war Bruchsal nichts weiter als eben eine kleine bischöfliche Residenzstadt. Das Schloß ist noch erhalten, aber ganz verödet. Der Schloßhof gleicht, oder glich wenigstens als ich ihn sah, einer schlecht gepflegten Wiese, und es lebt und regt sich nichts dann, als eine steife badische Schildwache und die unzähligen Goldfische in den beiden Bassins. Sie erinnern an die Liebhabereien der Rokoko-Zeit.
Im Jahre 1600 und so und so viel, oder 1700 und so und so viel, wo unsere Geschichte zu tagen beginnt, und zwar in der Stadt Bruchsal, sah es in diesem Hofe besser aus. Ist auch die Hofhaltung eines geistlichen Herrn, oder besser gesagt, war auch die Hofhaltung eines geistlichen Herrn nicht das bewegte heitere Bild wie die Umgebung eines weltlichen Herrschers, so war doch damals im Bruchsaler Schloßhof etwas anderes zu sehen als Grasboden und schlammige Fischbehälter. Wohlgenährte Canonici gingen ab und zu, und Bediente in reich gallonierten Livreen folgten ihnen. Es waren die Domherrn von Speyer, welche nach Bruchsal gekommen waren, dem Oberhaupt die Aufwartung zu machen. Diese Herrn gehörten einst dem hohen Adel an und trieben viel Luxus. Sie kamen auch selten zu Fuß von ihrem Absteigquartiere nach dem Schloß. Equipagen wie jetzt gab es freilich damals wenige, allein die nun aus der Mode gekommenen Sänften, in denen es sich recht sanft geschaukelt haben mag, waren zu jener Zeit stark im Gebrauch, besonders bei der hohen Geistlichkeit. Der Bischof selber hatte einen Wagen, eine Staatskarosse. Ich bekam als Kind von einer Deidesheimer Frau Base eine Puppenchaise zum Geschenk, welche in vergangenen Zeiten das Modell des bischöflichen Staatswagens gewesen sein soll. Es war das Fuhrwerk sehr schwerfällig gebaut und hatte eine ähnliche Form wie jetzt ein Omnibus. Das Dach reichte jedoch weit über den Unterbau hinaus, wie an einem Schweizerhause. Auf den vier Ecken des Daches waren schwere, vergoldete Schnitzwerke aufgepflanzt. Der ganze Wagen strotzte von Gold und hatte etwas Unbehagliches. Kutscher und Bediente hatten ungeheuere Perücken aus dem Kopfe und noch größere die beiden Herren, welche in dem Wagen saßen. In jener Zeit war ein Perückenmacher eine wichtige Person, denn, wenn die Herren ihre Köpfe auch noch so hoch getragen, sie trugen die Perücken doch noch höher. Der Bischof hatte viele Hausbeamte und Hofbedienstete, die teils im Schlosse wohnten, teils in der Stadt. So kam es, daß es niemals ganz stille war, weder in noch vor dem Schlosse. Am lebhaftesten aber ging es zu, wenn »Se. bischöflichen Gnaden« ausfuhren. Da blieb ein jeder stehen und sah mit Lust die Laufer an, welche zuerst aus dem Tore kamen, und hernach den reichen Wagen und die Haiducken. Das alles war recht stattlich anzusehen und gar bunt und prächtig.
Bruchsal hatte nicht so viel gelitten wie die Städte in Kurpfalz. Am meisten wurden die Einwohner mit den Truppendurchmärschen gequält. Auch an dem Tag, an welchem mein Bericht beginnt, wurde wieder Einquartierung angesagt. Es waren Österreicher, welche nach der Festung Philippsburg marschierten. Es war im Januar, und die Kälte war grimmig.
Also in Bruchsal in der »Kaffeegaß« ist, wenn man von der Hauptstraße hineingeht, auf der linken Seite ein hübsches Haus. Nah an diesem Hause befindet sich ein Brunnen, geziert durch eine mythologische oder allegorische Figur, so viel ich weiß, ist es ein Knabe mit einem Schwan. Die Bruchsaler nannten diesen Brunnen »Das Schwane-Werthel« oder nannten ihn wenigstens so in den alten Zeiten. In diesem Hause wohnte dazumal ein gutes, altes Ehepaar. Es war der Hofperückenmacher Loew und seine Hausfrau. Hier in diesen: Hause also wurde an einem grimmig kalten Januartage Einquartierung angesagt, und sie traf auch ein. Unwillkommene Gäste bleiben selten aus. Man hatte mit dem Abendessen hinlängliche Vorbereitung getroffen, und die Stube war durch und durch erwärmt. Eines hatten die sogenannten guten alten Zeiten vor den unsrigen wirklich voraus: man brauchte nicht an Holz zu sparen. Es war Abend und der Tisch war gedeckt; eine dünne Unschlittkerze machte die Beleuchtung aus, und eine Unschlittkerze war damals schon ein Luxus. Die Hofbediensteten bekamen diese Lichter als Besoldung. Es waren acht Gedecke auf dem Tische; zwei für den Herrn und die Frau, zwei für die Gehilfen, eines für die Magd und dann noch drei für die drei Mann Kaiserlichen. Es schlug 6 Uhr, das war die Nachtessenszeit, und an die Haustür tat es drei grobe Schläge; das war die Einquartierung. Der Meister, der Herr Perückenmacher, gab dem jüngeren der Gehilfen den Hausschlüssel – in jener Zeit schloß man die Türe früh – die Frau Hofperückenmacher gab der Magd das Licht mit der Weisung, es nicht schief zu halten. Herr und Frau und Gehilfe Nr. 1 saßen in der dunkeln Stube und hörten zu, wie der Schlüssel die Haustüre aufschloß und rasche Männertritte aus die Stubentüre zukamen. Die Türe tat sich auf und herein trat, fast geschoben von zwei folgenden Soldaten, die Magd mit etwas ängstlichem Gesicht, in ihrer Hand das bischöflich speyerische Besoldungslicht. Die Soldaten hatten es entsetzlich eilig, stürzten in die Stube nach, und statt des gewohnten Grußes riefen beide halb bittend, halb befehlend: »Supp', Supp', Supp'!« Man war an dergleichen Artigkeiten bereits gewöhnt und deshalb nicht überrascht. Allein die Überraschung kam nach, als der dritte Kaiserliche in das Zimmer trat. Nebst seiner gewöhnlichen Armatur hatte er noch einen Bündel bei sich, oder einen steifen Klumpen, den er in den Armen trug. Er setzte sich rasch damit an den Ofen und rief dabei wie die anderen: »Supp', Supp', Supp'!«. Man beeilte sich, den ungestümen Gästen zu willfahren, und in wenigen Sekunden stand die große Suppenschüssel dampfend auf dem Tisch. Die Soldaten sprangen auf. Die beiden, die zuerst eingetreten waren, wollten ihrem Kameraden seinen Bündel abnehmen, allein er gab ihn nicht aus den Armen. Die ganze Gesellschaft stellte sich um die Tafel, und der Hausherr sprach das Tischgebet. Der Soldat mit dem Bündel aber nahm keinen Anteil an der Andacht, sondern schöpfte sofort einen großen Löffel Suppe auf seinen Teller. Der Hausherr fiel aus dem andächtigen Ton in einen ärgerlichen, aber nur ein wenig. Es fürchtete sich in jener Zeit jedermann vor der Soldateska, auch vor der befreundeten. Die andern schielten etwas neugierig auf des Soldaten Bündel, besonders die Magd. Die Frau Hofperückenmacherin warf ihrer Americhe einen strafenden Blick zu, allein unwillkürlich spähte auch sie ein wenig auf den Bündel hin, und mit dem letzten Worte des Gebetes rief sie laut aus: »E Kind! e Kind! e Kind!« und alle fielen wie im Chor mit ein: »E Kind! e Kind! e Kind!«. Der gutmütige Österreicher fütterte das Kind mit warmer Suppe und hatte wahrscheinlich gedacht, daß dieser Liebesdienst auch ein Gebet sei. Dieses Kind war ein Knabe von ungefähr zwei Jahren und war unser Urgroßvater. Und unser Urgroßvater ließ sich die Suppe recht gut schmecken. Das Kind war halb erstarrt vor Kälte, und die Suppe war warm. Nach der Suppe kam eine große Portion Blutwürste und ein pikant duftender Krautsalat. Wenn es dazumal in Bruchsal schon Kartoffeln gegeben hätte, so wären auch Kartoffeln gekommen, aber es gab noch keine. Unser Urgroßvater hatte guten Appetit, wie seine Enkel. Er ließ sich auch die Wurst und den Krautsalat schmecken, und die Frau Hofperückenmacherin hatte darob eine große Freude und sprach: »Wenn ich gewußt hätte, daß ein Kind mitkommt, so hätte ich ihm Brei gekocht mit einer guten Schorr!« An diese wohlwollende Bemerkung knüpfte sich ein Gespräch an, durch welches die Leute des Hauses erfuhren, wie die Soldaten zu dem Kinde gekommen waren. Unser Urgroßvater war von den Kaiserlichen auf der Landstraße gefunden worden, wo er halb erfroren auf einem Steinhaufen gesessen war. Die Soldaten hatten aus Mitleid das Kind aufgepackt, obgleich sie gar nicht wußten, was sie jetzt damit beginnen sollten. In die Garnison nach Philippsburg durften sie den Knaben nicht bringen. Man stellte nun Fragen an das Kind, wie es heiße, und wo es her sei. Der Knabe wußte nichts und konnte nur wenige Worte sprechen. Nur die eine Auskunft wußte er zu geben, er heiße Nikolaus.
Über Eltern und Heimat wußte das Kind nichts zu sagen. Der Nikolaus muß übrigens ein liebes Kind gewesen sein und erschien wohl noch mehr so in seiner hilflosen Lage. Nicht nur die rohen Herzen der Soldaten waren weich geworden bei seinem Anblick, sondern auch der Hofperückenmacher, seine Gattin, die beiden Gehilfen und die Americhe. Frau Loewin erbat sich von dem Soldaten, daß er ihr für die Nacht den Knaben überlassen möge. Herr Loew war auch damit einverstanden. Wie die Kaiserlichen auf ihrem Lager waren und schon lange schliefen, da besprach sich das Ehepaar noch gar lange über das Kind. Als am Morgen wieder eine große Schüssel voll Suppe auf dem Tische stand, zum Frühstück – Kaffee wurde damals nur von den Vornehmen getrunken –, da machte der gute Hofperückenmacher seinen Gästen die Eröffnung, daß er mit seinem Weibe übereingekommen sei, daß sie, weil sie keine eigenen Kinder hätten, den Nikolaus behalten und ihn annehmen wollen an Kindesstatt. Die Soldaten waren hocherfreut und weinten alle drei vor Rührung, und die Loewischen weinten mit. Frau Loewin brachte einen großen Krug von ihrem selbstgebauten Wein zum Abschiedstrunk. Die Kaiserlichen taten große Züge und spülten sich die Rührung hinunter und marschierten hierauf gegen Philippsburg. Ich weiß nicht, ob unser Urgroßvater die guten Österreicher jemals wiedergesehen hat, man kam damals so wenig über seine Ortsgemarkung hinaus. Er hat übrigens eine Philippsburgerin zur Frau gehabt, was der Vermutung Raum gibt, daß die benachbarte Festung von ihm besucht worden sei. Da nun unser Urgroßvater bei seinen guten Pflegeeltern den Schauplatz seiner Geschichte betreten hat, so wäre der Anfang gemacht, um recht viel von ihm zu erzählen. Allein es geht mit dieser Biographie, wie es mit dem bischöflich speyerischen Besoldungslicht ergangen sein wird: sie brennt nicht lang. Ich weiß fast gar nichts weiter. Nikolaus erlernte das Gewerbe seines Pflegevaters und wurde ein braver Mann. Nach dem Tode seiner Pflegeeltern erbte Nikolaus deren Haus in der Kaffeegaß und einen schönen Weinberg und wurde auch der Hofperückenmacher. – Wann unsere Urgroßeltern gestorben sind, weiß ich nicht. Sie hinterließen einen einzigen Sohn, welcher Jakob hieß. Dieser Jakob war der Vater unseres Vaters.
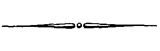
war der Vater unserer Großmutter väterlicherseits. Ich habe, solange ich in der Pfalz war, so wenig über den Adel und seine Rangordnung gewußt, daß ich nicht einmal angeben kann, welcher Klasse unser Urgroßvater angehörte. Es ist mir gesagt worden, die Familie Traiteur sei vor wenigen Jahren in den Grafenstand erhoben worden. In Deidesheim war eine bischöflich speyerische Hofkellerei. Ich habe das Haus noch gesehen, mein Vater hat es mir gezeigt. Hier war, wie ich vermute, unser Urgroßvater angestellt. Ich glaube, sein Titel war: »Hof-Keller«. Es klingt mir noch so etwas in den Ohren. Der Bruder des Urgroßvaters war, soviel ich weiß, am kurpfälzischen Hofe und hatte das Amt des Oberst-Jägermeisters. Meine Erinnerung sieht aber alle diese Verhältnisse nur wie in einem Nebelschleier.
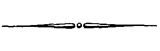
Von dem Vater unseres Großvaters mütterlicherseits weiß ich auch nichts, als daß er fürstlich St. Gallischer Erzieher war. Unsere Vorfahren haben gar viel mit der Geistlichkeit zu tun gehabt – wir hätten dürfen frömmer werden.
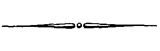
Suchet ja nicht stets das Beste
In den Sälen der Paläste.
Denn das Beste ist hienieden
Süße Eintracht, stiller Frieden.
Und die wohnen selten da,
Wo man Glanz und Reichtum sah.
Wir müssen nun die Rhein-Ebene verlassen und müssen tüchtig Berg steigen, und zwar nicht jetzt, sondern im Jahre 1699. Unsere Reise geht nach Chamberg, an den Hof des Herzogs Victor Amadeus von Savoyen. Hier suchen wir einen Ururgroßvater. Diesmal ist er aber nicht Hofperückenmacher, sondern Hofkavalier. Es ist eine eigentümliche Erscheinung in unserer Familie, daß durch alle Generationen die höchsten und die niedersten Stände darin vertreten waren. Es mag dies vielleicht die Ursache sein, daß wir alle ein mixtum compositum von schlichtem Bürgertum und exaltierter Romantik geworden sind. Alles ist bei uns schon dagewesen – nur kein Geldprotz. – Doch – ich muß ja meinen Urgroßvater suchen. Er hieß de la Condamine. Wer seine Frau war, weiß ich nicht. Sie starb früh und hinterließ ihm einen Sohn. Ich glaube, er hieß Carlo Justino.
Unser Urgroßvater war sehr in Gunst bei dem Herzog und, wahrscheinlich aus diesem Grunde, sehr in Mißgunst bei den Hofleuten. Ein kleiner Herr soll unserem Urgroßvater besonders abgeneigt gewesen sein. Über diesen Herrn spottete einst Condamine, daß er bei seiner kleinen Statur einen so großen Degen trage. Dies führte zu einem Duell. Unser Urgroßvater erstach den Kleinen und mußte Chamberg verlassen. Er ging nach Paris, vermählte sich noch einmal – ich weiß wieder nicht mit wem – und bekam 1701 (1699 war er geflohen) einen zweiten Sohn, den nachherigen berühmten Naturforscher, Chemiker und Reisenden in Südamerika, Charles Marie de la Condamine. Er war der erste, welcher den Chimborasso erstiegen hat. So erzählte mir wenigstens seine Nichte, unsere Großmutter. Dieser Condamine befaßte sich mit allen möglichen Künsten und Wissenschaften. Er erfand auch eine Säemaschine. Die Originalität dieses Mannes scheint seinerzeit viel Aufsehen gemacht zu haben. Da sich nicht jedes die Mühe geben wird, seinen Namen im Konversationslexikon aufzusuchen, will ich die Anekdote, welche dieses Buch von ihm enthält, hier abschreiben: »Von Condamines Wißbegierde erzählt man folgende Anekdote:
Bei der Hinrichtung Domins mischte er sich, um keinen Umstand dieser Todesart unbeachtet zu lassen, unter die dabei beschäftigten Henker. Man wollte ihn zurückweisen, aber der oberste derselben, welcher Condamine kannte, verhinderte es mit den Worten: › Laissez Monsieur, c'est un amateur.‹«
Er starb an den Folgen einer chirurgischen Operation, die er als neu vorgeschlagen und an sich verrichtet haben wollte, um der Akademie darüber Bericht erstatten zu können. So erzählte mir unsere Mutter, und das Konversationslexikon sagt dasselbe. Er ist übrigens doch 73 Jahre alt geworden.
»Seine Hauptwerke sind seine Reisebeschreibungen und seine Schrift über die Gestalt der Erde und über die Vermessung dreier Grade des Meridianes in den Äquatorialgegenden. Außerdem hat er Abhandlungen über die Pockenimpfung geschrieben.« (Konversationslexikon.)
Unser Urgroßvater war viel älter als sein Stiefbruder und wird nicht viel später geheiratet haben, als sein Vater sich mit der zweiten Frau vermählt hat. Unser Urgroßvater wohnte im Marktflecken Gossau im Kanton St. Gallen in der Schweiz. Er baute sich in Gossau ein hübsches Haus mit einem Erker, und an diesem Erker befand sich ein Stein, das Condaminesche Wappen. Ich weiß nicht, warum ich mir früher eingebildet habe, unser Urgroßvater sei Kaufmann gewesen; ich finde jetzt keine Anhaltspunkte mehr für diese Vermutung. Es kann übrigens doch so gewesen sein. Es scheint öfters vorzukommen, daß italienische Adelige sich dem Handelsstande widmen. In der Familie Dall' Armi gibt es ja auch Kaufleute; mein Schwiegervater selbst gehörte diesem Stande an.
Unser Urgroßvater wurde Witwer und schloß, wie sein Vater, eine zweite Ehe. Diese zweite Frau war keine Italienerin, sondern eine Schweizerin.
Unser Urgroßvater hatte aus erster Ehe zwei Töchter, und seine zweite Frau war jünger als diese Töchter erster Ehe.
Unterdessen war Charles Marie de la Condamine, nach Bericht des Konversationslexikons, mit Godin und Bourgner gewählt worden, durch eine in Peru vorzunehmende Vermessung die Gestalt der Erde zu bestimmen. Unser origineller Urgroßvater hatte sich bei dieser Sendung ruhmvoll ausgezeichnet. Als er nach acht Jahren nach Paris zurückgekommen war, hatten seine Eltern das Zeitliche gesegnet, und er sehnte sich darnach, seinen einzigen Bruder wiederzusehen. Er reiste nach der Schweiz, wurde in Gossau bestens aufgenommen und verliebte sich in seine Nichte, eine Tochter aus der ersten Ehe unseres Urgroßvaters. Die Nichte war nicht unempfindlich. Der Onkel reiste nach Rom und holte Dispens, Fazit: der Onkel heiratete die Nichte.
Unser Urgroßvater hatte aus der zweiten Ehe mit der jungen Frau fünf Kinder. Diese Kinder waren von ihren Stiefschwestern im Alter sehr verschieden, und es haben sich dadurch die Verwandtschaftsgrade der späteren Generationen scheinbar verschoben. Unsere Großmutter, Maria Magdalena de la Condamine, war das älteste Kind zweiter Ehe. Hierauf folgten drei Söhne. Der älteste von diesen Söhnen, welcher, wie ich glaube, Sebastian hieß und Ökonom war, heiratete eine ältliche Frau und hatte keine Kinder. Der zweite Sohn hieß Karl Justin und studierte Jus. Der jüngste, welcher Medizin studiert hatte und häufig in Gossau »das Dökterli« hieß, hieß mit seinem Taufnamen auch wieder Karl. Als ich mich verheiratete, lebten die beiden jüngeren Brüder noch. Ob in Gossau jetzt von der Familie Condamine überhaupt noch jemand am Leben ist, ist mir unbekannt. Das fünfte Kind aus der zweiten Ehe unseres Urgroßvaters war ein Mädchen. Als unsere Großmutter heiratete, war diese Schwester noch ein Kind.
Wie lange unser Urgroßvater lebte, weiß ich nicht. Seine junge Frau wurde eine sehr alte Frau; sie starb erst mit 96 Jahren. Die Urgroßmutter kam selbst nach Speyer, um mich aus der Taufe zu heben. Sie muß sehr kräftig gewesen sein, denn was war damals eine Reise von St. Gallen nach Speyer, und noch dazu für eine Frau von 92 Jahren! – In ihren letzten Jahren wurde die arme Frau kindisch. Als unsere Großmutter, ihre Tochter, sie anno 1812 besuchen wollte, erkannte sie dieselbe nicht mehr und versteckte sich vor ihr. – Ich glaube, daß ich hauptsächlich aus diesem Grunde den Namen der Urgroßmutter nicht mehr weiß, weil die Großmutter und Mutter sie in ihren Gesprächen »das Großmütterli« nannten. Ihr jüngster Sohn, »das Dökterli«, ist meines Wissens ein Hagestolz geblieben und war ein großer Löwe in Gossau.
Von dem jüngsten Kinde, dem kleinen Töchterchen, werde ich später mehr erzählen. –
Hiermit schließt der Bericht über unsere Urgroßeltern. –
Unsere Großeltern hießen:
Jakob Loew,
Maria Theresia von Traiteur.
Placidus Joseph Anton Pfister,
Maria Magdalena de la Condamine.
Jakob Loew, geb. in Bruchsal, starb daselbst anno 1783.
Maria Theresia von Traiteur, geb. in Deidesheim, starb in Bruchsal am 30. November 1791.
Placidus Joseph Anton Pfister, geb. in St. Fiden am 22. Oktober 1756, starb in Speyer 1840.
Maria Magdalena de la Condamine, geb. in Gossau anno 1753, starb in Speyer am 2. Februar 1816.
Ich habe von zwei unserer Urgroßväter mehr gesprochen als von den beiden anderen, weil ich von diesen anderen nichts gewußt und mich im Laufe des Lebens überzeugt habe, daß es besser ist, man spricht von dem, was man weiß, als von dem, was man nicht weiß.
Ich will nun meine staubigen, eingerosteten Gedanken mit dem Pinsel der Erinnerung aufzufrischen suchen. Käme die Klarheit meines Kopfes der Innigkeit der Liebe gleich, die ich für die lange heimgegangenen Großeltern noch jetzt im Herzen trage, so müßte meine Erzählung in der herrlichsten Farbenpracht erscheinen.
Ich habe immerdar gefunden,
Daß den Arzt vergessen die Gesunden;
Hat er zur Gesundheit sie geführet,
Wird ihm kaum der Dank, der ihm gebühret –
Und doch gibt's kein edler' Selbstvergessen,
Als sein Beruf dem Arzte zugemessen.
Unser Großvater, Jakob Loew, war der Sohn des Hofperückenmachers Nikolaus Loew. Wir haben uns also wieder nach Bruchsal zu begeben.
Soviel ich weiß, war Jakob das einzige Kind seiner Eltern. Als er geboren wurde, war in der Kaffeegaß alles noch beim alten. Es gab da große und kleine Perücken, welche dressiert, Zöpfe, welche geflochten, Locken, welche gebrannt wurden, und es lag nicht nur auf diesem Haarwerk, sondern auf der ganzen Werkstätte stets ein feiner Schleier von Puder, wie ein dünner Nebel auf der Landschaft liegt. Am Samstag Abend trugen die Gehilfen die Allongeperücken und die anderen in die Residenz, und wie der kleine Jakob größer wurde, durfte er die Gehilfen auf diesem Gange begleiten. Der kleine Jakob ging für sein Leben gern »nach Hof«. Er nahm die Bezeichnung »nach Hof« jedoch in seinem Sinne auf. Er ging nämlich nicht in das Schloß hinein, sondern er blieb im Hof zurück und betrachtete die Goldfischchen. Wie manches Stückchen Brot mag er seiner Mutter abgebettelt haben, um die Fischchen damit zu füttern.
Ich meine, ich sehe ihn an dem Bassin stehen in braunen Pumphöschen, scharlachrotem Jäckchen, blauer Weste und weißer Halskrause. Auch sein Köpfchen ist gepudert, und auf den gestäubten Löckchen sitzt ein kleiner dreieckiger Hut, mit goldenen Borden eingefaßt. Er lehnt sich über die Brüstung des Bassins und wirft den Fischlein kleine Bröckchen Brot hinunter. Das schöne Gesichtchen strahlt von Vergnügen, wenn die Fische herbeischwimmen und nach dem Brote schnappen. Auch die Fischlein sind vergnügt und schlagen mit den glänzenden Schwänzen; sie haben den freundlichen Knaben vielleicht gekannt. Der Großvater soll sehr schön gewesen sein, und das Bild mit dem Tressenrock, welches wir noch besitzen, widerspricht dieser Behauptung nicht.
Es waren aber die Fischbehälter nicht allein, welche des Kindes Interesse erregten. Die Schildwachen an den Schloßtüren und die stattlichen Herren, die da aus- und eingingen, gefielen ihm auch sehr wohl, und dann, wenn ausgefahren wurde! Der große, goldene Wagen, die Laufer, die Bedienten, die Haiducken! Und nun gar die sechs Pferde! ein halbes Dutzend Pferde an einem einzigen Wagen! Der Bischof von Speyer hatte zwar als solcher nur die Befugnis vierspännig zu fahren. Der jetzige Bischof aber war ein Fürst Styrum, und als Fürst war ihm ein Sechsgespann gestattet. Und wieviel hielt man in jener Zeit auf solche Dinge! Der kleine Jakob wird nicht der einzige Bruchsaler gewesen sein, der vor Ehrfurcht und Bewunderung den Atem anhielt, wenn der Hof ausfuhr. Es scheint jedoch, daß Jakobs Entzücken besonders groß war. Das Kind fiel wenigstens dem Fürsten auf, und er ließ sich öfters in ein Gespräch mit ihm ein. Eines Tages fragte der Bischof: »Gefällt es dir bei Hof, Jakob?« In jenen Tagen war man in Titulaturen viel besser bewandert als zu unserer Zeit. Selbst die Kinder wußten in den vielen Residenzstädtchen, welche »Ehre« man einem jeden zu geben hatte. Auch verließ Jakob Loew niemals das väterliche Haus, um »nach Hof« zu gehen, ohne vorher über seine Conduite in Tun und Reden gute Lehren zu bekommen. So antwortete dem Fürsten auf seine Frage der kleine
Jakob: »Ja, Euer Durchlaucht.«
Bischof: »Hättest du Lust, immer bei Hof zu bleiben?«
Jakob: »Ja, wenn Durchlaucht gnädigst gestatten.«
Bischof: »Ich möchte dich behalten, aber du müßtest tüchtig lernen. Willst du lernen, Jakob?«
Jakob: »Ich will Doktor lernen, Durchlaucht.«
Bischof: »Es bleibt dabei, du wirst Doktor.« –
Der Bischof sprach mit den Eltern, und die Eltern waren hocherfreut. Der kleine Jakob wurde Student und studierte Medizin. Als aber der Student Loew auf einer deutschen Universität den Doktorhut errungen hatte, da schickte ihn sein Gönner und Herr, der Fürst Styrum, noch auf ein Jahr nach Paris; gleichsam um seiner Erziehung noch die Krone aufzusetzen. Von seines Vaters Aufenthalt in Paris erzählte unser guter Vater eine Anekdote, welche ganz unwahrscheinlich klingt, von unserem Vater jedoch als verbürgte Tatsache geglaubt wurde.
Der junge Doktor, Jakob Loew, schlenderte eines Tages durch die Straßen von Paris. Es schlenderten noch viele Menschen mit ihm und hinter ihm; dies war nicht auffallend.
Auf einmal bückte sich ein elegant gekleideter Herr, der vor ihm hergeht, und hebt etwas Glänzendes vom Boden auf. Zu gleicher Zeit springt von rückwärts ein anderer Herr vor und ruft: »Halbpart!«
Unwillkürlich bleibt unser Großvater stehen, und der erste Herr wendet sich mit der Frage an ihn: »Sie werden mir bezeugen, mein Herr, daß ich allein dieses Brillantkreuz gefunden habe?«
Loew: »Allerdings.«
Zweiter Herr: »Nicht doch, ich habe das Kreuz im nämlichen Augenblick entdeckt, und Sie müssen mit mir teilen, und nicht nur mit mir, sondern auch mit diesem (er deutete auf unseren Großvater) jungen Herrn da; auch er hat dieses Kreuz ebensowohl gefunden als Sie und ich.«
Unser Großvater fand es sehr freundlich von dem fremden Herrn, daß er es so gut mit ihm meinte. Er blieb ruhig stehen und hörte zu, wie der erste Herr sich noch einige Zeit wehrte, aber am Ende nachgab und den Vorschlag machte, zu einem Juwelier zu gehen und das Kreuz schätzen zu lassen.
Unserem Großvater schien es zu behagen, daß er einige tausend Franken bekommen sollte, wie vom Himmel gefallen. Der erste Herr ging voraus, der junge deutsche Doktor in der Mitte und der zweite Herr hinter ihm drein. Die Herren führten ihn durch allerlei Gassen und Gäßchen, in ein Stadtviertel, in welchem er völlig unbekannt war. Sie traten in ein Haus und stiegen treppauf, treppab, durch allerlei Winkel und Gänge. Endlich hielten sie still und befanden sich in einem eleganten Zimmer. Der eine Herr ging fort, um den Juwelier zu holen, und der andere lud unseren Großvater ein, sich auf einer Ottomane niederzulassen. Sie hatten nicht nötig, lange zu warten. Der erste Herr kam wieder und brachte den Juwelier mit sich; man gab ihm das Kreuz zum Beschauen. Er schätzte es auf 8000 Frks. Die Herren fragten, ob er es um diesen Preis ankaufen wolle. Er erklärte sich dazu bereit, verlangte aber eine Bescheinigung, damit er sich ausweisen könne, im Fall der Eigentümer des Kreuzes sich wiederfinden sollte. Die drei Herren erklärten sich ihrerseits bereit, die Quittung auszustellen. Der Juwelier verschwand auf einige Minuten, kam wieder und zählte die 8000 Frks. auf den Tisch. Ein Herr verteilte das Geld in drei gleiche Teile, und ein jeder strich seinen Anteil ein, unser Großvater auch. Der Juwelier legte einige Bogen Papier auf den Tisch. Auf dem obersten Bogen war der Kopf zu einer Quittung aufgesetzt, und er forderte die Herren auf, zu unterschreiben. Die beiden fremden Herren schrieben ihre Namen rasch hin und gaben unserem Großvater die Feder in die Hand, welcher im guten Glauben ebenfalls unterzeichnete: Jakob Loew, Dr. med. – Das Papier war jedoch Blendwerk der Hölle. Der oberste Bogen ward weggezogen, und der Juwelier eröffnete ihm: »Mein Herr, Sie sind im Dienste der Marine Sr. Majestät des Königs von Großbritannien. Das Handgeld haben Sie bereits eingestrichen.« Als unser Großvater bemerkte, daß er unter Seelenverkäufer geraten war, was geschah ihm da? Ich höre Eure Antwort: Der Verstand stand ihm still. – Aber im Gegenteil! Sein Verstand bewegte sich sehr lebhaft. Er warf ihnen das Geld hin und fing an, ganz fürchterlich zu schimpfen. Die Werber aber lachten ihn aus. Wie unser Großvater sah, daß das Schimpfen nicht helfen würde, griff er die Sache anders an; er drohte, und er drohte nicht ungeschickt. Er sagte: »Glauben Sie ja nicht, daß ich ohne Bekanntschaft bin in Paris. Man wird mich vermissen, man wird mich suchen; ich stehe unter dem Schutze der österreichischen Gesandtschaft.«
Das wirkte. Obgleich die Fremden Lügner waren, sahen sie doch ein, daß unser Großvater die Wahrheit sprach. Sie ließen ihn gehen, nachdem er feierlich versprochen hatte, sie nicht verfolgen zu wollen. – Also hat der Vater den Hergang uns oft erzählt, und der Großvater wird ihn noch öfter erzählt haben, als er in Paris fertig studiert hatte und wieder daheim in Bruchsal war. Ich denke, später war er nicht mehr so schnell bereit, »Halbpart« zu machen.
Seine Durchlaucht, der Fürst Styrum, waren höchlichst zufrieden mit Deren Schützling und stellte ihn an als Hochdero Leibarzt. Unser Großvater soll ein guter Arzt gewesen sein, aber auch ein heiterer, angenehmer Gesellschafter. Der Bischof liebte seinen Umgang über alles, und der Großvater mußte täglich mit ihm speisen. Ob die Urgroßeltern die Freude erlebt haben, ihren Sohn in so hohen Ehren zu sehen, ist mir nicht bekannt. Der Bischof machte jedes Jahr eine Rundreise durch sein Ländchen, um die Firmung vorzunehmen. Auf dieser Reise mußte der Leibarzt natürlich dabei sein. In dem verödeten Speyer hielten sie sich nie lange auf, aber desto länger in Deidesheim; auch hier war ein bischöfliches Schloß. Die Vermutung spricht dafür, daß dieser Zug in der Regel in der Herbstzeit nach Deidesheim gekommen sei, um die Einlieferung des Zehnten zu überwachen. Bei dieser Gelegenheit lernte der Herr Geheimderat – dies war der Titel unseres Großvaters – einen jungen Förster kennen namens Brandner. Dieser Brandner gefiel dem Großvater sehr, und sie scheinen sich gegenseitig gefallen zu haben, denn sie schlossen ein Freundschaftsbündnis; immerhin auffallend zwischen einem Löwen und einem Jäger. Eines Tages kam der Jägermeister Brandner zu Hof zu Sr. bischöflichen Gnaden, und der Geheimderat Loew war hocherfreut, seinen Freund in Bruchsal zu sehen. Er zeigte ihm in dieser Stadt alle Sehenswürdigkeiten. Ob es welche gegeben hat, weiß ich nicht, aber die Vermutung spricht dafür, daß man sie ihm zeigte. Jedenfalls waren die Goldfische da. Bei diesen Gängen durch die Stadt gab Brandner seinem Freunde zu verstehen, daß er einen Stein auf dem Herzen habe. »Ein Stein auf dem Herzen« war für einen Mediziner ein interessanter Fall. Geheimderat Loew versuchte es, diesen Stein chemisch zu untersuchen, und da zeigte es sich, daß der Stein zusammengesetzt war aus Liebe und Ängstlichkeit. Unser Großvater hielt hierauf ein vollständiges Examen mit dem Freunde, und es ergab sich, daß er bis über die Ohren verliebt, der ganze Mensch also nicht in normalem Zustand war. Der Gegenstand von Brandners Brand hieß, wie ich vermute, Klara, es ist wenigstens gewiß, daß sie im klaren waren, und daß es nur an des Vaters Einwilligung fehlte. Der Vater war der bischöfliche Oberamts-Keller von Traiteur in Deidesheim und ein sehr adelsstolzer Mann. Das von der Liebe gejagte Jägerpaar fürchtete also, der hochmütige Vater – wenn es erlaubt ist, also von unserem Urgroßvater zu sprechen – werde seine Einwilligung zu einer Heirat mit einem Bürgerlichen nicht geben.
Dieser Fall machte unserem Großvater, dem Herrn Geheimderat, gar viele Gedanken. Er studierte alle Autoren, um zu ergründen, wie der Forstbrand zu löschen sei, und endlich fand er in der Tat die richtige Arznei für seinen Freund und Patienten. Der Herr Geheimderat verfügten sich zu seinem Freund und Gönner, dem Bischof. Er schilderte des Freundes Liebespein und bat um gütige Verwendung bei dem Vater, dem Tyrannen. Durchlaucht, welche selbst nicht ganz unempfindlich waren gegen das schöne Geschlecht, nahmen sich ihres Försters an. Er schrieb dem Vater einen schönen Brief, wahrscheinlich des Inhalts, daß die Liebe des Mannes für das Weib noch edler sei als selbst die Liebe des Mannes für den Adel; oder auch, daß die Töchter kein Lagerobst wären, und durch langes Aufheben nicht gewännen. Vielleicht ließ der Landesherr auch ein Wort fallen über ein kleines Nadelgeld aus der Kabinettskasse für die Frau und Erhöhung der Holz- und Wildbezüge für den Förster usw.
Unser Urgroßvater wurde weich, und seine Antwort auf das gnädige Handbillet des Landesfürsten war eine Einladung zur Hochzeit seiner Tochter, Klara von Traiteur, mit dem bischöflichen Jägermeister, Friedrich Brandner. Und nicht nur seine bischöfliche Gnaden und Durchlaucht waren eingeladen, sondern auch der ganze Hofstaat, demzufolge auch der Herr Geheimderat, unser Großvater. Der Tag der Trauung war natürlich ganz dem Ermessen des Herrn Bischofs anheimgestellt, und dieser wählte, auch natürlich, die schöne Herbstzeit. Der jugendliche Herr Geheimderat freuten sich gar sehr auf diese Hochzeit; es gab zwar in Bruchsal bei Hof auch allerlei Feste, allein sie waren nicht immer nach dem Geschmack des jungen Herrn. Überdies war unser Großvater dem Waldmenschen Brandner mit großer Zuneigung zugetan und dachte mit Stolz an den Anteil, welchen er hatte an dem Aufbau seines Glückes. Wie alle Tage kommen, die ersehnten und nicht ersehnten, so kam auch dieser Hochzeitstag. Der Bischof machte bei Gelegenheit dieser Reise seine Runde durch den Sprengel und hielt überall einen feierlichen Einzug. Junge Bürger zu Pferde, geschmückt mit Schärpen von des Bischofs Farben, holten ihn an der Ortschaften Gemarkung ab. Die Schulkinder hatten weiße Kleider an, wo die Franzosen eine Glocke gelassen hatten, wurde geläutet, und wo noch so viel Geld geblieben war, um Pulver zu kaufen, wurde geschossen. Die Menschen haben zu allen Zeiten gerne Feste gefeiert. – So kam der Zug nach Deidesheim. Dieses Städtchen hatte sich durch seinen Weinbau von den Drangsalen des Krieges etwas erholt und bot alles auf, die Anwesenheit des Landesherrn und die Hochzeit von des Herrn Oberamtskellers Tochter mit Glanz zu verherrlichen. Alle Häuser waren mit Laubgewinden und Fahnen geschmückt, und der Wein ist nur so geflossen. Alle jungen Damen des Städtchens – damals Fleckens – waren Brautjungfern bei dieser Hochzeit, und sie fanden alle nicht einen einzigen Flecken an der Liebenswürdigkeit des schönen, jungen Geheimderates Dr. Jakob Loew. Wäre es unter solchen Verhältnissen nicht undankbar gewesen von unserem Großvater, wenn er von seiner Seite kalt geblieben wäre? Er tat dies aber auch nicht; er handelte unserer Familie würdig und verliebte sich. In wen? – (Siehe weiter unten.)
Der Amtskeller von Traiteur hatte noch eine zweite Tochter, welche Maria Theresia hieß. In jener Zeit war die Kaiserin Maria Theresia das Entzücken von ganz Deutschland und wird es bleiben in ewige Zeiten. Darum nannte auch der kaiserlich gesinnte Amtskeller seine Tochter Maria Theresia. Ich weiß nicht, ob der gute Urgroßvater gehofft hat, er könne seiner Tochter mit dem Namen auch den großen Verstand, das große Herz und die große Schönheit der Kaiserin verleihen, er probierte es eben, und zum Teil glückte der Versuch. Zwar schön war, glaube ich, unsere Großmutter nicht, allein geistreich und liebenswürdig, und wenn unser Vater von seiner Mutter sprach, kam er jedesmal in Begeisterung.
Seitdem unser Großvater unter die Seelenverkäufer geraten war, hielt er seine Augen sperrangelweit offen, und so erkannte er sehr bald, daß hier ein Schatz für ihn erglänze, und daß Maria Theresia von Traiteur sein Demantkreuz geworden sei. Also in wen verliebte sich unser Großvater? In Maria Theresia von Traiteur, bischöflich speyerische Oberamtskellerstochter in Deidesheim. Unser Großvater hatte es bereits in der Übung, seinem Landesherrn Liebesgeschichten anzuvertrauen, und so vertraute er ihm auch die seinige. Der Bischof seinerseits hatte es in der Übung, den Freiwerber zu machen, und so machte er ihn wieder; und unser Urgroßvater hatte es in der Übung, nachzugeben, und so gab er wieder nach, obgleich auch dieser zweite Schwiegersohn ein »Bürgerlicher« war, und
»als der Großvater die Großmutter nahm,
da war der Großvater Bräutigam.«
In welchem Jahr und an welchem Tag die Hochzeit unserer Großeltern gefeiert wurde, ist mir unbekannt; die Vermutung spricht für die Zeit um 1765 herum, also bald nach dem Ende des siebenjährigen Krieges.
Es ist mir leid, daß ich nicht weiß, was Fürst Styrum zur Aussteuer geschenkt hat; soviel betrachte ich als Tatsache, daß er das Brautpaar, dessen Wohltäter er war, eigenhändig einsegnete und ungefähr folgende Rede hielt:
»Geehrte Versammlung, tugendhaftes Brautpaar! Ich vereinige Ihre Hände mit besonderem Vergnügen, denn Sie sind nicht nur meine Landeskinder, sondern auch meine erklärten Lieblinge. Wir haben vor nicht langer Zeit einen Frieden abschließen sehen; möge sich dieser Friede auch durch Ihr ganzes Leben erstrecken, und dieses recht lange sein. Mein Wohlwollen für Sie wird unverbrüchlich sein und nur mit dem Leben enden!«
Also sprechen kurzsichtige Menschen. Es ist anzunehmen, daß der Bischof seine Rede mit dem besten Herzen gehalten und mit dem besten Wein begossen habe, welchen unser Urgroßvater, der Amtskeller, auftreiben konnte. Aber es ging doch nicht alles so am Friedensschnürchen, wie der Bischof und die ganze Versammlung es an diesem Tage gewünscht und folglich auch gehofft hatten. Im wesentlichen war es sehr gut, unsere Großeltern liebten sich und wären ohne äußere Störungen sehr glücklich gewesen, aber wo bleiben solche Störungen aus?
Bei ihren vielen guten Eigenschaften hatte unsere Großmutter auch eine schlimme: sie war eifersüchtig. Eine eifersüchtige Frau darf aber keinen Arzt heiraten, und am allerwenigsten einen schönen, jungen. Die arme Großmutter war entsetzlich viel allein und hatte dadurch Zeit und Muße, ihrer unglückseligen Leidenschaft nachzuhängen. Das härteste war ihr, daß ihr Mann bei Hofe speisen mußte, besonders da die Frau Bas Goldschmiedin sie oft besuchte und ihr anvertraute, bei Hofe gehe es ziemlich locker her, und bei der Tafel mache man oft ganz unpassende Späße. Der Fürst hatte nämlich verlangt, daß sein Leibarzt auch nach dessen Verehelichung sein täglicher Gast sei; allerdings nicht angenehm für die junge Frau.
Eines Tages war auch die Frau Bas Goldschmiedin – ich habe keine Idee mehr, wie diese Frau mit unseren Großeltern verwandt war, ob sie »Goldschmied« hieß, oder an einen Goldschmied verheiratet war – wieder bei unserer Großmutter. Sie hatten lange die Köpfe zusammengesteckt und fort und fort von dem Bischof gesprochen und seinem leichtfertigen Lebenswandel, da rief plötzlich eine Stimme neben ihnen: »Bei Hof! bei Hof!« Die Frauen fuhren auseinander, und erst als sie ruhig geworden waren, bemerkten sie, daß der Papagei, welchen der Fürst der jungen Frau geschickt hatte, um sie zu divertieren, die oft wiederholte Rede: »bei Hof« aufgefangen und nachgeschwätzt hatte.
Unsere Großeltern wohnten natürlich in dem Hause in der Kaffeegaß. Das Haus und der Weinberg waren von Nikolaus Loew auf Jakob Loew übergegangen. Die Bruchsaler hielten von jeher viel auf ihre Weinberge, obgleich die Trauben darin entsetzlich sauer sind. Die Großmutter, welche die Deidesheimer Trauben gewöhnt war, wird sie ganz besonders so gefunden haben. Allein die Traubensäure wirkte weniger ätzend auf das Herz unserer Großmutter als die Eifersucht. Sie lag dem Großvater gar oft in den Ohren, er solle die fürstliche Tafel aufgeben und sich zuhaus bei ihr mit Hausmannskost begnügen; der Großvater aber versicherte ihr, es wäre undankbar, dem Bischof seine ihm unentbehrlich gewordene Gesellschaft zu entziehen, und es gehe eben einmal nicht. Und es ging auch nicht. Ich glaube, unsere Großmutter war auch ungehalten darüber, daß sie ihre Kochkunst nicht benützen konnte. In jener Zeit hielt man noch viel mehr darauf als heut zutage, daß jede Frau eine Köchin sei. Der Vater sagte, seine Mutter sei obendrein eine besonders geschickte Köchin gewesen und habe hauptsächlich die Bereitung der Käsnudeln sehr gut verstanden.
Obgleich die Frau Bas Goldschmiedin eher dazu beitrug, das Herz der Großmutter zu beunruhigen, als zu beruhigen, so war sie eben doch immer wieder auf die Gesellschaft dieser Frau angewiesen, welche übrigens, wenn auch eine geschwätzige, doch auch wieder eine recht amüsante Frau war, wie aus folgender Anekdote hervorgeht, über welche wir als Kinder so entsetzlich lachen mußten.
Die Großmutter ließ bei einer Unteroffiziersfrau in Philippsburg spinnen, hatte aber mit ihr nicht genau ausgemacht, wieviel für das Pfund Garn bezahlt werden sollte; als das Garn fertig war, brachte es nicht die Frau, sondern ihr Mann, ein Böhme, welcher kein Wort Deutsch verstand. Die Großmutter gab sich alle Mühe, von dem Manne zu erfahren, was sie zu zahlen habe, allein vergeblich. Da sagte die Frau Bas Goldschmiedin: »Lassen Sie nur mich machen, Frau Geheimderätin, ich bring's schon 'raus«. Hierauf stellte sie sich vor den österreichischen Unteroffizier hin und schrie: »Was goschd der Bund zu schbinne?« Der Böhme gab zur Antwort: »Jo, Frau!« Dann schrie die Frau Bas noch ärger: »Was goschd der Bund zu schbinne?« worauf der Böhme erwiderte: »Jo, Frau! jo, Frau!« Unsere Großmutter bekam fast Krämpfe vor lachen, und diese Gewandtheit der Frau Bas Goldschmiedin in fremden Idiomen hat noch Kinder und Kindeskinder in der Loewschen Familie zum Lachen gereizt. Die Großmutter und die Frau Bas Goldschmiedin waren, wie gesagt, kein passendes Paar, denn die Frau Bas Goldschmiedin war eine »Frau Bas« im ganzen Sinne des Wortes, und die Großmutter war eine geistreiche, fein gebildete Dame; allein sie hatte das Bedürfnis einer Ansprache. Später, als vier junge Loewen in der Kaffeegaß eingekehrt waren, wird der Verkehr mit der Frau Bas Goldschmiedin nicht mehr so häufig gewesen sein.
Nun hatte die Großmutter auch Gelegenheit, ihre Kochkunst zu üben und sich mit ihren Kindern zu amüsieren. Der Vater hat mir erzählt, wie die vier Buben ihre Mutter immer gequält hätten, sie solle Käsnudeln backen. Diese Käsnudeln brauchen viel Schmalz, und da die Butter damals noch so billig war, so sollte man nicht denken, daß man so gar sparsam damit umgegangen sei; allein eine wackere Hausfrau war allezeit ökonomisch. Um aber das Drängen ihrer Buben los zu werden, gab ihnen unsere Großmutter die ausweichende Antwort: »Ihr bekommt Käsnudel, sobald der Schwanewerthel Schmalz laufen läßt.« Die Buben hatten nun nichts Eiligeres zu tun als fort und fort an den Brunnen zu laufen und nachzusehen, ob nicht Schmalz statt Wasser komme, und dann getäuscht nach Hause zu gehen, wenn der Schwanewerthel immer wieder Wasser und Wasser schenkte. Als die Buben größer wurden, fehlte es der Großmutter nicht mehr an Gesellschaft, aber es fehlte den Knaben an der väterlichen Aufsicht, und sie machten allerlei lose Streiche. Von einem derselben erinnere ich mich der Erzählung des Vaters: An einem Sonntag nachmittag im Winter erlaubte die Frau Geheimderätin ihren Buben, sich einige Freunde herbeizuholen. Die Kinder spielten eine Komödie aus dem Stegreif, zu der sie sich als Thema die Geschichte der Königin Esther wählten. Unser Vater hatte die Rolle der Esther zu spielen, und sein älterer Bruder, mit dem Beinamen, »Der Schwarz«, gab den Haman. Zum Schluß hängten die Buben den Haman mit einem Handtuch an das Zapfenbrett. Wie der Gehängte so zappelte und die Zunge herausstreckte, mußten die Buben sehr lachen, wie er aber ganz blau im Gesicht wurde, bekamen sie sehr Angst und liefen alle davon. Zum Glück rief ihr Geschrei die Großmutter herbei, welche ihn hinunternahm; es dauerte aber lange, bis er wieder zur Besinnung kam.
Es mochte wohl nach einem solchen Vorfall gewesen sein, daß unsere Großmutter den Großvater aufs neue mit der Bitte bedrängte, die Tafel beim Fürsten aufzugeben, um wenigstens bei Tische die Knaben überwachen zu können. Der Großvater fand die Vorstellungen seiner Frau nur zu sehr begründet und entschloß sich, die Lage der Dinge dem Fürsten vorzustellen und ihm für die Tafel zu danken, an welcher er nur aus Rücksicht für diesen so lange erschienen war. Unser Großvater war ein solider Mann, und die Freuden der Tafel ihm gleichgiltig, so daß er schon seit Jahren viel lieber mit seiner Familie gespeist hätte. Da er aber wußte, daß der Bischof seine Gesellschaft sehr liebte und der Fürst sein Wohltäter war, so fiel es ihm sehr schwer, wegzubleiben, d. h. dem Fürsten diesen Wunsch zu äußern. Unser Großvater ging auf das Schloß zu, und je näher er dem Tore kam, desto höher schlug ihm das Herz, und als er gar vor des Bischofs Kabinettstüre stand, da hatte er fast keinen Atem mehr; doch er bedachte, wie nötig die väterliche Aufsicht seinen Knaben sei, und blieb fest bei seinem Entschlusse; auch hegte er die Hoffnung, der Fürst werde ein Einsehen haben – allein der Fürst hatte kein Einsehen. Er nahm seines Leibarztes Eröffnung nicht nur sehr ungnädig auf, sondern es ist auch nie mehr das alte liebreiche Verhältnis eingetreten.
Es ist eine auffallende Erscheinung des menschlichen Herzens, daß nach jahrelanger Liebe und Güte bei den gutmütigsten Menschen manchmal plötzlich ein Umschlag eintritt, und sie für den Gegenstand ihrer bisherigen Zuneigung von kalter Gleichgiltigkeit ergriffen werden. Es geschieht dies gewöhnlich durch einen wirklichen oder eingebildeten Mißbrauch der bis dahin von ihnen bewiesenen Güte.
Von dieser Zeit an war unseres Großvaters Stellung bei Hofe eine sehr peinliche, und die Großmutter hätte es wahrscheinlich wieder recht gerne selbst übernommen, ihre Buben zu beohrfeigen, wenn das Mißverhältnis dadurch wieder ausgeglichen worden wäre, – aber es wurde noch schlimmer.
Der Fürst hatte ein langwieriges Leiden, und der Großvater schlug öfters eine Operation vor, welche sich aber der Fürst verbat. Die Krankheit nahm zu, der Fürst wurde bewußtlos, und unser Großvater kam mit mehreren Ärzten, welche zu einer Konsultation zusammentraten, überein, daß jene Operation vorgenommen werden müsse. Der Großvater vollzog die Operation; der Fürst genas, haßte aber von da an seinen früheren Liebling und trug diesen Haß später sogar auf dessen Söhne über. Unser Großvater starb jung, unerwartet, und nahm seiner Frau vor seinem Ende das Versprechen ab, keinen seiner Söhne Arzt werden zu lassen.
Unsere Großmutter war furchtbar ergriffen von dem Tod ihres Mannes. Es war ihr so schmerzlich, daß sie selbst mit die Ursache gewesen war, ihres Mannes letzte Lebenszeit weniger angenehm gemacht zu haben, und doch war ja wirklich der Beistand des Vaters bei der Erziehung der Knaben so nötig gewesen. Doch die Großmutter war eine verständige und starke Frau. Sie wußte, daß sie ihren Kindern schuldig sei, sich zu fassen, und daß sie das Andenken ihres Mannes am würdigsten ehre, wenn sie seine Söhne zu braven Männern erziehe. Allein, dies war keine kleine Aufgabe, besonders da Fürst Styrum seine Hand von ihnen abgezogen hatte. Sie brachte es jedoch auch ohne fremden Beistand so weit, daß sie ihren Söhnen eine anständige Erziehung gab, so daß jeder von ihnen ein gebildeter Mann war und sich sein Brod verdienen konnte, wenn auch nicht verschwiegen werden kann, daß der älteste ihr viel Kummer machte.
Die vier Knaben hießen: Joseph Adam – genannt »Der Schwarz«; Hans, Alban und Jakob.
Bei des Vaters Tod war der älteste 15, der jüngste erst 4 Jahre alt.
Man könnte nicht sagen, daß »Joseph Adam« ein romantischer Name gewesen; der Träger dieses Namens aber hatte eine große Neigung zur Romantik. Er machte auch gerne Verse, aber gut waren sie, scheint es, nicht; denn als aufgeschossener Jüngling – was man in Bamberg einen Geier nennt – als eine Schauspielergesellschaft nach Bruchsal kam, vergaffte er sich in die Heldin, welche eine kleine Blondine war und Sachs hieß. Dieser überschickte er folgendes Epigramm:
Die Mamsell Sachs
Hat Häärle wie Flachs
Und Händle wie Wachs
Und Füßle wie e Dachs.
Ob er seinen schönen Namen »Joseph Adam« darunter geschrieben hat, weiß ich nicht; ebenso weiß ich nicht, warum er in der Familie nur »Der Schwarz« hieß. Vielleicht hat er auch solche schwarze Löckchen gehabt wie unser Vater. Sie sind noch auf dem Bilde zu sehen, welches unser Bruder Jakob von ihm besitzt. Von einem anderen poetischen Ergusse unseres Onkels erinnere ich mich, daß er bei dem Tode der Kaiserin Maria Theresia, welcher ihn besonders schmerzlich berührt zu haben scheint, seinen Gefühlen in einem Carmen folgende Worte lieh, dessen Schlußstrophen den gleichen Refrain hatten: »Wien, Wien, Wien! – Es fehlt die Heldin.«
Diesen Sohn bestimmte die Großmutter, oder auch vielleicht noch sein Vater, dem Handelsstande. Sie mochten Gelegenheit haben, ihn in Deidesheim bei einem Weingeschäfte unterzubringen, wenigstens hatte er in einer Weinhandlung seine Studien gemacht. Leider hat sich diese Wahl nicht als eine glückliche bewährt; »Der Schwarz« hatte mehr Lust, den Wein zu trinken, als ihn zu verkaufen, was seiner Mutter schwere Sorgen machte.
Desto mehr Freude erlebte sie an ihrem zweiten Sohne Hans. Unser lieber, lieber unvergeßlicher Vater war der Stolz und das höchste Glück seiner Mutter. Den 10. Oktober 1771 geboren, war er zwölf Jahre alt, als sein Vater starb. Er war ein Kind voll der herrlichsten Geistesanlagen, und hatte ein Gemüt, so weich und lieb, daß ihn seine eigene Mutter ihre »Freundin« nannte. Mit der Poesie befaßte sich unser Vater nicht sehr viel, aber desto mehr mit ernsten Wissenschaften. Er machte große Fortschritte, und seine Mutter entschloß sich, ihn die Rechte studieren zu lassen. Unser Vater soll auch sehr hübsch gewesen sein, was man ihm freilich in späteren Jahren nicht mehr ansah, besonders wegen seiner geringen Sorgfalt für eine gewählte Toilette. Sein Gesicht hatte jedoch für das ganze Leben den Ausdruck hohen Verstandes und unendlicher Güte und Freundlichkeit. Jedermann, der mit ihm verkehrte, schätzte und liebte ihn. Nachdem er das Gymnasium absolviert hatte, bezog er in Gesellschaft von drei Freunden die Universität Erlangen. Einer von diesen Freunden hieß auch Loew und war von Bruchsal, war aber nicht mit ihm verwandt; der zweite war Joseph Brandner, der Sohn des Jägermeisters, und Will aus Philippsburg war der dritte. Wenn diese vier Männer später zusammentrafen, was manchmal bei uns in Speyer zu geschehen pflegte, und von ihren Universitätsstreichen erzählten, wie dieses alte Herren so gerne tun, da kamen sie auch auf eine Partie zu sprechen, welche sie nach einer katholischen Stadt gemacht hatten, um daselbst die Frohnleichnamsprozession anzusehen. Wie junge Leute leicht zum Lachen gereizt werden, mußten auch diese lachen, weil eine heilige Veronika ein Schweißtuch hatte so groß wie ein Tischtuch. Sie zogen sich aber durch dieses Lachen eine Tracht Prügel zu, ich meine, sie sagten von Gärtnern. Ich habe schon daran gedacht, ob ihnen die Prügelsuppe vielleicht in Bamberg serviert worden sei, allein die heilige Veronika spielt hier keine Rolle, und es ist eher anzunehmen, daß es in dem Erlangen näher gelegenen Forchheim gewesen sei. Unserem Vater muß es bei Prügeleien schlimm ergangen sein, denn er war groß und dabei etwas ungelenk, wahrscheinlich daher auch sein Spitzname, »Der Bock«. Ebenso scheint er ein schlechter Reiter gewesen zu sein, denn er mußte einmal eine Masse Töpferwaren bezahlen, in welche sein Pferd auf dem Markte gegen des Reiters Willen hineingeraten war. In jener Zeit war der Spitzname »Nürnberger Sandhaase« im Schwunge, und da man damals noch beim Einreiten in jede Stadt nach seinem Namen gefragt wurde, so hatten sich die Freunde bei einem Ritte nach Nürnberg dahin verabredet, daß der erste sich als »Nürn«, der zweite als »Berger«, der dritte als »Sand« und der vierte als »Haase« nannte, was dem Torwächter einen solchen Zorn machte, daß er den Schlagbaum niederließ, um sie zu fangen; sie wollen aber alle glücklich entwischt, ja sogar über den Schlagbaum gesetzt sein, was doch schon eine Art reiterliche Bravour voraussetzt.
Unser Vater war auch auf der Universität sehr beliebt, und namentlich hatte ihn auch ein Professor sehr in Affektion genommen, an welchem auch der Vater seinerseits mit großer Verehrung hing. Leider habe ich seinen Namen vergessen, er griff später noch einmal in des Vaters Leben ein.
Als unser lieber Vater in den Ferien 1789 zu seiner Mutter nach Bruchsal kam, um daselbst die Ferien zu verbringen, waren in den rheinischen Landen alle Köpfe in Gärung. In Paris war die Revolution losgebrochen, die Bastille erstürmt worden, und man fühlte schon bis über den Rhein Schwingungen dieser Bewegung.
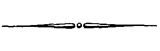
Der dritte Sohn ist ebenfalls Kaufmann geworden; er hieß Alban. »Alban« ist ein hübscher Name, und ich wundere mich, daß er nie in der Familie wiederholt worden ist. Alban war auch ein hübscher Bursche und sehr liebenswürdig, aber wieder ganz anderer Weise als unser Vater. Er hatte nicht dessen hervorragenden Scharfsinn, allein er war doch ein geweckter Kopf, von der Natur mit einer Menge kleiner Talente ausgestattet, welche ihn zu einem äußerst liebenswürdigen Gesellschafter machten. Er hatte viel Anlage für Musik, besonders eine schöne Stimme, und hätte wohl am besten zum Künstler getaugt; allein die Wahl eines solchen Lebensberufes würde damals als unverzeihlicher Leichtsinn betrachtet worden sein. Er wurde, wie gesagt, ebenfalls Kaufmann. Onkel Alban hatte eine sehr humoristische Art, etwas zu erzählen. Ich erinnere mich mit Vergnügen an eine Schilderung, welche er uns gemacht von dem Anzug, mit dem er ausstaffiert worden war, als er in Bruchsal zur ersten Kommunion ging. Er bekam, weil er ein großer breiter Junge war, einen scharlachroten Frack von seinem verstorbenen Vater, und seine Mutter behauptete, er sitze ihm vortrefflich, obgleich er ihm überall zu »völlig« war.
Jakob, der vierte Sohn, war als echter Benjamin der Liebling der ganzen Familie. Unser Vater hing mit der innigsten Liebe an diesem jüngsten Bruder. Bei Nennung seines Namens traten ihm noch in späteren Jahren die Tränen in die Augen; er vermied es deshalb gern, von ihm zu sprechen. Jakob wäre gern Mediziner geworden, allein seine Mutter gab es nicht zu, weil ihr Mann es verboten hatte; er sollte Jurist werden wie sein Bruder Hans. Auch Jakob soll hübsch gewesen sein; es scheint, daß in unserer Familie die Schönheit mit jeder Generation heruntergekommen ist.
Wenn unser Vater nach Bruchsal kam, ergötzte er sich an den Kapuzinerpredigten. Noch nach langen Jahren erinnerte er sich daran und teilte uns Bruchstücke aus denselben mit. Z. B.: »Verschließet euer Ohr dem unsinnigen Ruf nach Freiheit und Gleichheit. Was würdet ihr sagen, in Christo dem Herrn Geliebte, wenn euer Rindvieh, euere Hunde, euere Schweine behaupten wollten, sie seien gleich euch?!!«
Ein andermal: »Wer sich diesen gottlosen Neuerungen hingibt, ist dasjenige Tier, welches wir Deutsche mit dem lateinischen Worte » asinus« zu bezeichnen pflegen.«
Es muß eine ganz eigentümliche Zeit gewesen sein. Unser Vater erzählte, es sei ihm damals so zumute gewesen, als hätte er Sprungfedern unter den Füßen. Die erste Begeisterung für Freiheit und Gleichheit muß etwas Berauschendes gehabt haben, und es mag gar mancher Kopf aus dem Geleise gekommen sein. In Anbetracht dieser Verhältnisse war es fast noch ein Glück zu nennen, daß nur einer von den vier Söhnen der Großmutter die Haltung verloren hat.
Unser Vater und sein Bruder Jakob, welcher damals in Bruchsal auf dem Gymnasium war, waren Muster von solidem Lebenswandel. Alban war zwar ein wenig romantisch und unüberlegt, aber doch ein sehr wohlgeratener, braver junger Mensch. Hans wurde, obgleich nicht der älteste, von den drei anderen Brüdern wie ein Vater betrachtet. Die Großmutter tat nichts, ohne sich vorher mit ihrem Sohne Hans zu beraten, sie korrespondierte mit ihm über alles, und der Vater sagte oft, sie habe ganz wunderschöne Briefe geschrieben. Als nach Schluß der Ferien anno 1791 der Vater Abschied nahm, um das letzte Semester auf der Universität Mainz zuzubringen, da war die Großmutter durch die schlimmen Zeitläufte sehr ängstlich geworden. Sie warnte ihren Sohn vor jeder Teilnahme an Klubs und anderen Demonstrationen und weinte bitterlich. Der Vater versprach seiner Mutter unbedingte Erfüllung dieser Wünsche, und in Mainz angelangt, schrieb er gleich an sie und wiederholte seine Versprechungen.
Jetzt kam die Belagerung von Mainz; es durften keine Briefe in die Stadt, und so kam es, daß unser Vater monatelang keine Nachricht von Bruchsal bekam, und als im Frühling 1792 die Tore der Stadt geöffnet wurden, welche Botschaft wurde da unserem armen Vater zuteil? – Seine Mutter war tot, sie war schon am 30. November 1791 gestorben. Unser Vater machte sich sofort auf den Weg, um sich nach seinen Brüdern umzusehen – allein er sah sie noch lange nicht. Infolge der Aufregungen bekam er ein Nervenfieber und blieb in diesem Zustande bei seiner Tante Brandner in Deidesheim, welche als Witwe daselbst wohnte. Die Tante rief mehrere Ärzte, welche sich über den Zustand ihres Neffen berieten. Der eine dieser Herren war der später durch seine Zerstreutheit berühmte Dr. Lederle. Dieser sagte in des Kranken Gegenwart: » Febrim hecticum habet«, über welche Bemerkung zu lachen der Patient Humor genug hatte. Es scheint, daß der Vater damals durch einen fabelhaften Appetit gerettet wurde, denn er erzählte uns, daß er 14 (!) Milchbrötchen zum Frühstück verzehrte – etwas kostspielig für die Tante Brandner. Bis der Vater gesund war, war es Herbst geworden, und er brachte dann selbst seinen Bruder Jakob auf die Universität nach Erlangen und rekommandierte ihn dem Professor, seinem Gönner, von welchem schon früher die Rede war. Unser Vater ging hierauf nach Bruchsal zurück, erbat sich Audienz beim Fürsten Styrum und bot ihm seine Dienste an. Der Vater sagte, er wünsche sich dem Fürsten dankbar zu bezeigen und seiner Vaterstadt zu nützen, aber der Fürst wies ihn schnöde ab. Er ging hierauf nach Paris, arbeitete bei einem Advokaten, und mit dem Gelde, welches er verdiente, unterstützte er seinen Bruder Jakob. Später, vielleicht nach des Fürsten Tod, war er Stadtschreiber in Deidesheim.
Ich muß nun noch einmal auf Jakob zurückkommen. Dieser hatte natürlich in Bruchsal Bekannte; unter diesen war ein junges Mädchen, welches sich sehr lebhaft für ihn interessierte, und welchem er zum Abschied einen Vogel schenkte. Es scheint, das Interesse war gegenseitig. Was ich nun erzählen will, hörte ich aus dem Munde eben dieses Mädchens, und zwar im Jahre 1833, wo es bereits eine alte Frau und die Gattin des oben genannten zerstreuten Dr. Lederle in Neustadt war. Als sie es mir erzählte, war auch ich bereits verheiratet. Ich will Frau Lederle selber reden lassen; sie sprach zu mir: »Ihr Herr Vater war nach Bruchsal gekommen, um seiner Mutter einen Grabstein setzen zu lassen, und besuchte uns; ich zeigte ihm den Vogel, welchen sein Bruder mir geschenkt hatte, und er neckte mich. Dies war abends; gegen Morgen höre ich im Käfig ein Flattern – ich springe auf – es flattert nicht mehr, mein Vogel liegt tot im Käfig. Ein furchtbarer Schmerz kommt über mich. Sobald es angeht, lasse ich Ihren Herrn Vater rufen und erkläre ihm, der Vogel ist tot, und ich fühle es an meiner Aufregung, daß sein Bruder auch tot sei. Ihr Vater lachte über meine Verzweiflung. Nach einigen Tagen kommt ein Brief von seinem Professor mit der Nachricht, Jakob Loew sei ganz schnell am Nervenfieber gestorben, und zwar zur selben Stunde, wie auch mein Vögelchen gestorben war.«
Frau Lederle weinte bitterlich, als sie mir unseres Vaters Schmerz und den ihrigen schilderte. Ich fragte sie, ob sie denn nicht wisse, wie es denn bei dem Tode meines Onkels eigentlich zugegangen sei, und erzählte ihr nun meinerseits auf ihre Verneinung: »Mein Vater glaubte, wie Sie, sein Bruder sei an Nervenfieber gestorben; als er aber mit meinem Bruder Titus i. J. 1830 nach Nürnberg gegangen war, um denselben daselbst auf die polytechnische Schule zu bringen, erfuhr er, daß es anders war. Der Vater traf im Gasthaus einen Universitätsbekannten, erfuhr von diesem, daß sein Freund, der alte Professor, noch lebe, und wollte nach Erlangen gehen, um ihn und das Grab seines Bruders zu besuchen. Unser Vater freute sich sehr, den alten Freund wiederzusehen und sagte es seinem Bekannten. »Ach ja, gehen Sie hin,« sagte ihm dieser. »Es hat dem Professor so leid getan, wie damals Ihr Bruder erstochen wurde.« Erst jetzt, nach 30 Jahren, erfuhr mein Vater, daß sein Bruder im Duell geblieben war, und diese Mitteilung erschütterte ihn so sehr, daß er sich nicht entschließen konnte, nach Erlangen zu gehen. Um sie zu zerstreuen, teilte ich der Frau Lederle noch mit, was damals auch der Vater in Nürnberg erfahren hatte, daß nämlich in der Nacht, während welcher mehrere Studenten bei der Leiche Wache hielten, eine verschleierte Dame in das Zimmer eingetreten sei, den Toten geküßt und ihm einen Blumenstrauß in die Hand gegeben habe. Die Dame habe sich wieder entfernt ohne zu sprechen und sei so tief verschleiert gewesen, daß keiner der Anwesenden sie erkannt habe. – Ich hatte aber mein Zerstreuungsmittel schlecht gewählt, denn Frau Lederle ward sofort von heftiger Eifersucht ergriffen und apostrophierte die verschleierte Dame nicht eben mit schmeichelhafter Benennung.
Nun ruht auch sie längst im Grabe und wird es ihrer Nebenbuhlerin verziehen haben, daß auch sie einst den Studenten Jakob Loew aus Bruchsal liebenswürdig gefunden hat.
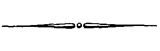
NB. Der Vater war von 1789-92 auf den Universitäten Erlangen und Mainz. Am 1. Oktober 1797 wurde er Aktuar des Amtes Eichtersheim, welches dem unmittelbaren Adel
Greffier d'un baillage de la Noblesse
immédiate de l'empire germanique
gehörte. 1798 im April quittierte er diesen Platz und wurde Syndikus der Gemeinde Deidesheim, welches Amt durch die bald darauf erfolgte französische Organisation überflüssig wurde. Bis zu seiner Ernennung zum Advokaten, 1803 /: 23. germinal XI:/ war der Vater ohne Amt. Dies ist authentisch. Zwischen 1798 bis 1803 arbeitete unser Vater, 6-10 Monate, bei einem Advokaten in Paris.
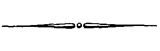
Wer unter dem Schutze der Alpen geboren,
Hat nie in der Fremde das Heimweh verloren;
Und doch ziehen Söhne der Alpen so gern,
Als Soldaten und Krämer in weiteste Fern'! –
Unsere Großmutter mütterlicherseits war um drei Jahre älter als ihr Mann, es ist daher nach dem Altervorzugsrecht schicklich, daß ich von ihr zuerst erzähle.
Magdalena Condamine war ein wunderschönes Mädchen und voll Leben und Feuer. Es fanden sich für sie viele Bewerber, allein sie wies alle ab, weil sie eine heimliche Neigung hatte. Schon mit 15 Jahren hatte sie ihr Herz an einen Mann verschenkt, welcher zwar ein Mann von Herz und Verstand war, aber nicht die Mittel besaß, eine Familie zu ernähren. Mit 15 Jahren findet man solche Hindernisse geringfügig, und sie ging mit Künzle ein Liebesbündnis ein, beständig hoffend, es werde sich etwas finden. Das Verhältnis hatte aber bereits sieben Jahre bestanden, und es hatte sich noch immer nichts gefunden. Eltern und Brüder machten der jungen Magdalena Vorstellungen und drangen in sie, ihren geliebten Künzle aufzugeben; aber sie ließ nicht von ihm, und es muß auch ein prächtiger Mann gewesen sein – ich werde später zu seiner Charakteristik noch einiges mitteilen.
Sieben lange Jahre also hatten die beiden Liebenden gehofft und geharrt, als eine unerwartete Krisis eintrat. Es war das Kirchweihfest in Gossau, und ein großes Tanzvergnügen wurde auf dem Zollhaus gefeiert. An diesem Tanzvergnügen nahmen auch die Beamten des gefürsteten Abtes von St. Gallen mit ihren Familien teil, und unter diesen war auch der blondgelockte, blauäugige, 19jährige Sohn des fürstlichen Erziehers Pfister. Dieser junge Mann war ganz bezaubert von der Großmutter; diese aber hatte kein Auge für ihn, weil sie sich in größter Aufregung befand. Es kam ihr nämlich so vor, als fände Künzle an einem anwesenden Mädchen zu viel Wohlgefallen, worüber sie die peinlichste Eifersucht empfand. Des anderen Tags stellte sie Künzle deshalb zur Rede, und er verteidigt sich nicht so, wie sie es gewünscht hatte, so daß das Liebespaar schmollend auseinander geht. In diesem Augenblick erhält Magdalena einen Brief; es ist ein Heiratsantrag des jungen Pfister, welcher ein Beamter des Abtes von St. Gallen und keine üble Partie ist. Magdalena weiß, daß dieser Mann ihren Verwandten sehr erwünscht wäre; sie betrachtet sich als eine von ihrem Geliebten Verlassene, Betrogene – setzt sich sofort nieder und schreibt eine bejahende Antwort an Placidus Pfister. Als Künzle davon hörte, war er trostlos, und selbst die alten Condamines erschraken. Am trostlosesten mag die Großmutter selbst gewesen sein. Geändert aber wurde nichts mehr, und Magdalena heiratete den Placidus Pfister im Jahre 1775. Das junge Paar zog nach St. Jörgen, ganz nahe bei St. Gallen, woselbst der Großvater seine Anstellung hatte. Von einer Ehe, welche unter so schlimmen Auspizien geschlossen worden, hätte man die schlimmsten Erfolge erwarten können; allein es kam doch, Gott sei Dank, so gar arg nicht. Das Schlimmste war des Großvaters Jugend.
Künzle entfernte sich aus der Gegend, was sehr zweckmäßig war. In St. Jörgen war es sehr hübsch, und die Großmutter mit ihrem Lose ziemlich ausgesöhnt, besonders als sie nach einigen Jahren einen Sohn und eine Tochter hatte. Der Knabe hieß Pepi und war ein paar Jahre älter als unsere Mutter, welche am 2. Juli 1782 geboren war. Man trug das Kind den steilen Berg herunter in die Klosterkirche, woselbst sie Maria Klementina getauft wurde. Gerufen wurde sie »Klämens«. Ihre Taufpaten waren: der Bruder ihrer Mutter, Sebastian Condamine, und dessen Gattin Rosa.
Großvater Pfister war ebenfalls verpflichtet, bei seinem geistlichen Herrn zu speisen, wie unser Großvater Loew, hatte aber überhaupt keine Freude an seinem Posten und wäre für sein Leben gern Soldat gewesen; er war so unvorsichtig, diesen Wunsch auch in Gegenwart des Abtes auszusprechen. Der Abt, Beda Ahngern hieß er, war ein sehr braver Mann und in seinem Territorium sehr beliebt; allein er wurde ärgerlich über unsern Großvater, was man ihm nicht verdenken kann. Ein Dritter, der gern des Großvaters Stelle gehabt hatte, schürte an dem Abte, und unglücklicherweise wurde damals gerade für spanische Dienste ein Regiment in der Schweiz angeworben. Eines Tages kommt unser Großvater zur Tafel, und wie er die Serviette vom Teller nimmt, erblickt er ein Papier – es ist ein Leutnantspatent für Placidus Pfister, in dem Regimente, welches nach Spanien marschiert; seine nächste Garnison ist Barcelona. Man gratuliert unserem verblüfften Großvater höhnisch lachend, und in jugendlichem Vergnügen lacht er zuletzt selbst mit. Die Großmutter aber lachte nicht, sondern weinte recht sehr über ihres Mannes Unverstand, zum Glück hatte sie sich bereits gewöhnt, in Unvermeidliches zu fügen. Sie richtete daher in Andacht ihr Gemüt auf, packte ihre sieben Sachen zusammen, sagte ihrer Heimat Lebewohl und folgte ihrem Manne mit dem Pepi und der Klemens nach Barcelona. Ein Umstand mochte der Großmutter den Abschied erleichtert haben; Künzle war nämlich wieder heimgekommen. Seine Verhältnisse hatten sich zum Vorteile verändert, er war jetzt ein Mann von Vermögen und Ansehen, er war Landammann von Appenzell. Künzle wollte jetzt auch heiraten und heiratete, wen? das kleine Schwesterchen der Großmutter, welches unterdessen eine Schwester geworden war. Unsere Großmutter aber zog gegen Barcelona und wurde spanisch. Diese Reise muß entsetzlich beschwerlich gewesen sein; unsere Mutter, die damals freilich erst sechs Jahre alt war, wußte nichts mehr davon zu erzählen, ebensowenig von der späteren Rückreise nach Gossau. Sie kannte bei ihrer Rückkehr kein deutsches Wort mehr, allein später war ihr auch jedes spanische entfallen. Es war überhaupt nicht viel Spanisches an ihr hängen geblieben, als daß sie sich gerne Öl auf das Brot strich und eine rohe Zwiebel dazu aß. Diese Delikatesse blieb jedoch ihr Leibgericht bis an das Ende ihres Lebens, und wenn wir sahen, daß die Mutter sich diesen Leckerbissen herrichtete, so wußten wir, daß sie besonders guter Laune war. Einmal hatte sich die Klemens in Barcelona verirrt und war austrompetet worden; Nonnen hatten die Pforten des Klosters geöffnet und das Kind, welches von einem Gewitter überrascht worden war, hereingeholt, um es vor dem herabströmenden Regen zu schützen.

Frau Landammann Künzle.
Unsere Großeltern waren nicht sehr lange in Barcelona. Der Großvater wurde Hauptmann und Kommandant der kleinen Festung Mahon auf der Insel Minorka. Es soll diese die fruchtbarste der balearischen Inseln sein, und der Aufenthalt in Mahon war vielleicht romantisch, aber in jener Zeit sehr unsicher. Die afrikanischen Raubstaaten waren noch nicht gedemütigt, und ihre Korsarenschiffe trieben ein freches Unwesen auf dem Mittelmeere. Zu landen und schnell an Vieh und selbst Kindern und Erwachsenen wegzufangen, was sie erwischen konnten, das waren ihre Hauptstreiche, die sie zudem meistens zu Nacht auszuführen suchten und dadurch jedesmal die Besatzung alarmierten. Zum Glück hatten sie Boote, welche durch ihre besondere Bauart schon von weitem in die Augen fielen; sobald man eines solchen Bootes ansichtig wurde, zog man die Sturmglocke und traf Vorbereitungen. Dadurch wurde Mahon ein recht ungemütlicher Aufenthalt. Unterdessen waren wieder drei Schwesterchen unserer Mutter auf die Welt gekommen; nämlich: Amanda, Margeritta Antonitta und Romana Sydra. Es gefiel unseren Großeltern nicht in Mahon, und nachdem das eine Kind, die Margeritta Antonitta gestorben war, befiel die Großmutter ein arges Heimweh nach Gossau. Der Großvater entschloß sich, sie ziehen zu lassen, und so schied sie mit ihren drei Töchtern: Klemens, Amanda und Sydra; den Pepi ließ sie als Kadetten beim Großvater zurück.
Diese beiden hatten nun keine Unterhaltung mehr als einen kleinen Garten, in welchem sie Obst an Spalieren zogen. Der Großvater erzählte uns oft von Mahon, von den großen Mauerkröten, welche die Spaliere hinaufkrabbelten, und von den nächtlichen Überfällen der »Mohren«, und ich weiß nicht, ob ich mich mehr vor den Seeräubern oder mehr vor den Kröten fürchtete, welche fast tellergroß sein sollen.
Bis Barcelona machte die Großmutter die Reise zu Schiff, von dort trat sie die mühselige Landreise an. Es war eine schwere Aufgabe, in jener Zeit mit drei kleinen Kindern zu reisen, und in dem weglosen Spanien zu reisen. Es kam ihr aber jedermann freundlich entgegen, woran wohl hauptsächlich die Teilnahme für die Kinder und vielleicht auch der Großmutter Schönheit schuld gewesen sein mag. Allein noch ehe sie die spanische Grenze überschritten hatte, traf sie ein harter Schlag. In einem Städtchen in den Pyrenäen starb plötzlich ihre kleinste Tochter Sydra. Es fehlte ihr jedoch nicht an Teilnahme bei diesem Verlust; nicht nur die Wirtsleute, bei denen sie eingekehrt war, sondern das ganze Städtchen bezeigte Anteil daran – freilich mitunter aus wenig heimische Art. Sie zwangen die Großmutter, die kleine Leiche der Sitte gemäß drei Tage und drei Nächte lang auf der Straße auszustellen; wer vorbei ging, tanzte um den Sarg, kniete dann nieder, um sich von dem Geistlichen, welcher bei der kleinen Sydra Wache hielt, den Segen geben zu lassen. Jede herbeigekommene Person bestreute die Leiche mit Blumen und besuchte hierauf die Mutter, um ihr zu gratulieren, daß sie nun dem Himmel einen Engel geschenkt habe; auch legte jeder Besuch für die Leidtragende ein Geldstück auf den Tisch, welches sie, ohne Verletzung dortigen Herkommens, nicht hätte zurückweisen dürfen. Sie ließen der Großmutter nicht einen Augenblick Ruhe, so daß diese tief betrübt und zum Tode ermüdet endlich ihres Weges zog, nachdem das Kind mit großem Pomp begraben worden war. Von dem Leichenzug ihres Schwesterchens erinnerte sich die Mutter noch dunkel.

Landammann Künzle.
Endlich, nach 5 jähriger Abwesenheit, kamen sie in Gossau wieder an. Es scheint, daß damals unser Urgroßvater noch am Leben war, und daß die Großmutter mit ihren Kindern zu ihren Eltern gezogen ist. Künzle und ihre Schwester waren schon ein gesetztes Ehepaar und hatten eine Tochter, Anna Maria. Ihre beiden jüngeren Brüder waren aus der Universität, und der ältere Bruder lebte noch immer in kinderloser Ehe. Wahrscheinlich geschah es aus diesem Grunde, und weil vielleicht der Großmutter Einkommen nicht glänzend gewesen ist, daß unsere Mutter zu diesem Onkel als Pflegekind kam. Sie blieb bei ihnen von ihrem 7. bis zu ihrem 17. Jahre, und sowohl der Onkel als auch die Tante Ros' haben wie die liebevollsten Eltern an ihr gehandelt. Die kleine Amanda Pfister soll eine herzige Spaniolin gewesen sein, das Entzücken von ganz Gossau. Von ihr stammt auch der in unserer Familie öfter wiederholte Name Amanda. Leider starb das Kind mit sechs Jahren.
Die Großmutter wollte ihrem Bruder die Klemens nicht wieder nehmen, weil er und seine Frau mit der innigsten Liebe an dem Kinde hingen. Da sie aber diese Einsamkeit nicht ertragen konnte, so schnürte sie ihr Bündel und suchte Mann und Sohn in Spanien wieder auf. Der Sohn war unterdessen Offizier geworden. Ehe jedoch unsere Großmutter nach Spanien zurückging, führte sie in Gossau noch eine Heldentat aus. Der Abt von St. Gallen hatte eine Verordnung erlassen, welche seinen Untertanen nicht gefiel, und diese, im Zusammenhange mit den inzwischen durch die französische Revolution in Schwung gekommenen Ansichten, sehr aufregte. Die Männer von Gossau und der Umgegend wiegelten sich auf, die Großmutter bildete ein Bataillon und stellte sich an die Spitze; ihre Mittel erlaubten ihr das, denn sie war ja die Frau eines Kapitäns. Man rückte bis an eine Brücke vor, worauf der Abt, ohne es auf weiteres ankommen zu lassen, nachgab. Unter derselben Brücke hatte sich Klemens mit einem Laib Brot versteckt. Ich denke, es war der Großmutter ganz leid, daß es nicht zum Kampf gekommen ist, denn sie hatte den Abt noch von früher her auf der Muck.
Die Reise von Mahon nach Gossau hatte die Großmutter mit ihren drei Töchterchen angetreten; ich denke es mir daher als sehr betrübend, wie sie so ganz allein nach Spanien zurückkehrte. Zum Glück befand sich der Großvater dann nicht mehr auf der Insel Minorka, sondern in dem herrlichen Sevilla. Seine und Onkel Pepis Briefe waren überströmend von dem Lobe Andalusiens, und der Großvater kam noch in seinen alten Tagen in Aufregung, wenn er sich der Herrlichkeit von Sevilla, Cordova oder Granada erinnerte oder die wunderbar schöne Alhambra schilderte. Ich dummes, gedankenloses Ding merkte aber nicht auf seine Schilderungen, mich interessierten nur die Granatäpfel; ich hatte recht viel lernen können, wie ich jung war, wenn ich nicht so zerstreut gewesen wäre. Der Großvater hatte eine unbeschreibliche Freude, als seine Frau wieder zu ihm kam, denn er hatte sie außerordentlich gern; daß sie ohne die drei Töchterchen kam, wird wohl auch das Wiedersehen getrübt haben; aber die Großmutter hatte jetzt doch auch wieder ihren Sohn, und so hatte ihr Herz auch wieder einen Stützpunkt gefunden. Wie mag der lebhaften Frau mit ihrem empfänglichen Gemüt und ihrer reichen Phantasie der Aufenthalt in dem herrlichen Sevilla erquickend gewesen sein; die andalusische Luft muß ihr neues Leben eingehaucht haben. Wahrscheinlich wohnten unsere Großeltern nicht
»In Sevilla, in Sevilla,
Wo die großen Prachtgebäude
An den breiten Straßen steh'n,
Aus den Fenstern reicher Leute
Schön geputzte Damen seh'n« –
sondern:
»In Sevilla, in Sevilla,
Wo die letzten Hauser steh'n.
Sich die Nachbarn freundlich grüßen,
Mädchen aus den Fenstern seh'n,
Ihre Blumen zu begießen« usw.
Ich denke mir aber das Leben hier fast noch schöner als dort. Obgleich ich erst sechs Jahre alt war, als die Großmutter starb, so weiß ich doch noch, daß sie mir von Granada und der Alhambra erzählte und dabei so schöne, glänzende, schmelzende Augen gemacht hat; ich weiß auch noch, daß sie und der Großvater, wenn sie von den Mauren sprachen, sagten: »die Mohren«. Dies wurde mir aber erst später klar; denn damals hatte ich nur einen verwirrten Begriff von Gold und Juwelen, Perlen, Mohren und Granatäpfeln. Über letztere hatte ich in noch späterer Zeit die Anschauung, die Kerne dieser Äpfel seien die Granatsteine, welche man als Schmuck trägt, und als der Großvater von Mosaikböden erzählte, so fragte ich, ob die der Moses gemacht habe.
Wenn ich an dieser Geschichte schreibe, ist es mir aber wahrhaftig selbst so, als verfertige ich ein Stück Mosaik. Aus allen möglichen kleinen Strichen suche ich ein Bild zusammenzustellen, und es will mir gar so oft nicht gelingen, die richtige Farbe zu finden.
Ich weiß nicht wie lange unser Großvater in spanischen Diensten, gewesen ist; ich denke von 1783-1798. Wahrscheinlich wurden die Schweizer Truppen entlassen, denn er kam um diese Zeit in die Schweiz zurück und lebte mit Frau und Sohn in St. Fiden. Der Großvater und Onkel Pepi hatten in Spanien mehrere Feldzüge (2) mitgemacht; einmal waren sie in Gibraltar, und einmal in dem gegenüberliegenden Teil von Marokko; ich bitte aber, mir alles Detail aus Gründen zu erlassen. Was die geschichtlichen Momente betrifft, da hapert es am allermeisten mit meiner Mosaik. So viel ich weiß, sind beide Feldzüge mißlungen, woran aber unser Großvater gewiß nicht schuld war, denn er war ein tapferer Soldat, obwohl er uns oft mit großem Lachen erzählt hat, daß er bei dem ersten feindlichen Schuß, den er gehört habe, in einen Graben gesprungen sei. Der Großvater und Onkel Pepi beschäftigten sich in St. Fiden damit, schweizerische Rekruten einzuüben; aber entweder hat ihnen dieses Geschäft nicht lange gefallen, oder sie hatten kein gehöriges Einkommen, kurz, sie ließen sich wieder anwerben, und zwar in französische Dienste; der Großvater wieder als Hauptmann, und der Onkel als Leutnant. Während all dieser Zeit war die Klemens bei Onkel und Tante gesessen, wie der Vogel im Hanfsamen. Wenn unsere Mutter von der Bescherung bei der Tante Ros' erzählte, da gingen uns Kindern vom Zuhören die Augen über. Es bescherte aber in Gossau nicht das Christkind, sondern der Nikolaus, doch machte auch dieser würdige Mann seine Sache recht gut. An seinem Namenstage – 6. Dezember – kam er in Person und fragte, ob die »Chlämens Condamine und die Marie Chünzle bravi Kinder seient?« Auffallenderweise sprach der alte Bischof, welcher im Himmel doch der feinsten Bildung hätte teilhaftig werden sollen, ein ganz gutes Stockschweizerisch. Marie Künzle und Klementine Pfister, die Geschwisterkinder, waren sehr dicke Freundinnen, und der heilige Nikolaus bescherte ihnen gemeinschaftlich. Es war auch ein kleiner Herr Künzle da, welcher vielleicht jetzt noch als Kaufmann in Heidelberg lebt; er muß aber viel jünger gewesen sein als seine Schwester. Wenn der heilige Nikolaus an seinem Namenstage seine Aufwartung machte, die Tante Ros' die Kinder nach Verdienst bei dem heiligen Mann gelobt und getadelt hatte, was dieselben mit gefalteten Händen anhören mußten, dann verteilte er die Geschenke und fragte: »Wollt ihr auch meine Chnächte sehen?« Auf das erfolgte »Ja« der Kinder verschwand der Bischof, und mit Schnauben und Kettengerassel drangen die Knechte ins Zimmer. Es waren diese Knechte Männer mit rußigen Gesichtern, in große Mäntel gehüllt und entsetzlich anzusehen. Sie hatten große Säcke mit Äpfeln und Nüssen, welche sie auf den Stubenboden hinleerten. Wenn nun die Kinder sich auf diese Beute losstürzen wollten, schlugen sie die Knechte mit Ruten auf die Finger; diese Ruten, welche mit Bändern verziert waren, taten natürlich nicht sehr weh, was die Furcht der Kinder ins Abnehmen brachte, bis sie zuletzt so keck wurden, daß sie die Ruten zu erhaschen suchten, um damit die Knechte zur Tür hinauszujagen; der heilige Nikolaus hatte sich, wie gesagt, schon vorher französisch empfohlen. Es war in Gossau freilich nicht alle Tage Nikolaustag, aber es erging der Klemens an jedem Tage gut; es war daher hart für Onkel und Tante, daß die Eltern, als sie von Spanien zurückgekehrt waren und sich in St. Fiden niedergelassen hatten, ihr Kind zurückverlangten. Es war aber auch hart für die Eltern, daß die einzige Tochter ihnen ganz entfremdet war. Es scheint allerlei aufgeregte Szenen gegeben zu haben, bis es dahin entschieden wurde, daß Klemens zu ihren Eltern komme. Für unsere Mutter selbst war es wohl am peinlichsten, daß sie zwischen Eltern und Wohltätern stand. Als die Familie Pfister in St. Fiden vereinigt war, scheint keine rechte Eintracht in ihr geherrscht zu haben; man kann sich zwar auf der Mutter Schilderungen – und ich kenne sie nur durch diese – nicht so ganz verlassen, weil die Mutter die ganze Welt durch eine schwarze Brille betrachtete; aber sie erzählte unter anderem, daß der Großvater sehr heftig gegen ihren Bruder gewesen sei, und dieser seinen Vater auch mal gefragt habe: »Sprechen Sie als Hauptmann oder als Vater mit mir?« Vielleicht war dies von beiden Seiten gar nicht so bös gemeint; der Sohn liebte die Eltern offenbar weit mehr, als dies bei der Tochter der Fall war. Wie wäre dies aber auch anders möglich gewesen, die Tochter kannte ja die Eltern kaum. Als die Großmutter die Bekanntschaft mit ihrer Tochter erneuert hatte, fand sie, daß es ihr an geselligem Schliff fehle, und daß sie noch französisch lernen solle. Die Gelegenheit zu dieser höheren Ausbildung fand sich, als der Großvater wieder Dienste genommen hatte und nach Landau in Garnison kam. Er hatte da viel Gutes gehört von dem Pensionat der Mademoiselle Carry, später Madame Graf, und er schrieb an die Großmutter, sie solle ihm die Klemens schicken.
Die gute Tante Ros' besorgte die Ausstattung ihres Pflegekindes und ließ ihr Kleider und Wäsche nagelneu machen, damit, wie sie meinte, die »Chlämens in dem fremden Lande sich könne sehen lassen«. Die Mutter wußte noch jedes Kleid und jedes Stück Wäsche zu beschreiben, als sie schon alt war, was deshalb zu verwundern, weil … wie du gleich erfahren wirst.
Es war im Sommer 1799. Es ging mit dem Reisen damals nicht so leicht wie heutzutage, besonders für ein junges Mädchen. Man mußte warten, bis sich eine Gelegenheit fand – endlich fand sich diese. Zwei anständige Kaufleute, welche die Messe in Frankfurt bezogen, nahmen sie mit bis in diese Stadt, und dorthin kam ihr Vater von Landau und holte sie ab. Die schönen neuen Sachen wurden in einen Koffer gepackt und auf den größeren, welcher den beiden Herren gehörte, auf die Kutsche hinten aufgebunden. Der Abschied war schwer, die Großmutter abermals ganz allein, die Reisenden fuhren von dannen.
An einem Regentage im November, in einer einsamen Gegend des Schwarzwaldes, hörten sie auf einmal verdächtiges Pfeifen. Der Kutscher blickte angstvoll in den Wagen und meinte, es müßten Räuber sein, im Schwarzwald gebe es davon immer. Die Herren spannten ihre Pistolen und befahlen dem Kutscher, zu fahren, was das Zeug hielt, was sich der Schwager nicht zweimal sagen ließ und dermaßen seine Pferde antrieb, als ob diese die Räuber wären, und so erreichten sie glücklich den nächsten Ort, d. h. glücklich insofern, als den Reisenden nichts an Leib und Leben geschehen war, aber! der Koffer unserer Mutter, welcher deren ganze Ausstattung enthielt, war abgeschnitten worden und kam » niemals nicht mehr« zum Vorschein. Man mache sich einen Begriff von dem Jammer eines 18jährigen Mädchens, welches seine ganze Garderobe verloren hat! Aber was half der Jammer? Der Koffer war fort mit allen neuen Kleidern, und die Mutter kam in Landau an, wie sie ging und stand. Einen Vorteil hatte zwar dieser herbe Verlust für unsere Mutter, ja sogar deren zwei; erstens war sie wegen ihres Mißgeschickes gleich mit erhöhter Teilnahme in Landau aufgenommen, und zweitens bekam die neue Garderobe Nr. 2 einen moderneren Zuschnitt als die frühere. Sie meinte wenigstens, daß die Kleider, welche in Gossau gemacht worden waren, ein wenig altfränkisch gewesen seien. In Landau aber hatte man von jeher viel auf die Kleider und den Anzug gehalten. Nur ein Stück der verlorenen Garderobe konnte die Mutter niemals ganz verschmerzen, es war eine schwarzseidene Schürze mit Spitzenbretellen.
Unsere Mutter war ein schönes Mädchen, doch nicht so hervorragend wie ihre Mutter; von ihren Nachkommen hat ihre Namensschwester, die Klemi von Hans, am meisten Ähnlichkeit mit unserer Mutter; der Charakter in seinen Hauptzügen ist ganz und gar in unserer Schwester Rosa wiederholt. Den französischen Offizieren in Landau scheint die Mutter sehr gut gefallen zu haben; sie nannten sie nur:« la belle Suisse». Unsere Mutter lernte nun französisch und hieß nicht mehr Klemens, sondern Clementine. Neben ihren Studien besuchte sie auch die Landauer Bälle und fand dort einen Verehrer, welcher sehr schlecht tanzte, und den sie nicht leiden konnte. Eines Tages ließ sie bei einer Bekannten die Bemerkung über ihn fallen:« On dirait qu'il a appris à danser dans la fossée de Berne». Dem plumpen Tänzer wurde dieses hinterbracht, und auf dem nächsten Maskenballe kam er als Bär maskiert und überreichte der Mutter ein Gedicht des Inhaltes: er hoffe, ihr nun besser zu gefallen, als Landsmann. In späteren Jahren hatte diese Spottrede der Mutter nicht mehr ähnlich gesehen, sie befaßte sich gar nicht mit Witzeleien; im Übermut der Jugend mußte dies anders gewesen sein. Die Mutter hatte sich in Landau mehrere Freundinnen erworben; obenan stand Mademoiselle Heiligenthal, welche sich später an den bekannten französischen Finanzminister Humann – einen Elsässer – verheiratete, und zwar einigermaßen auf Zureden unserer Mutter, welcher sie ihn durch eine Glastür mit den Worten zeigte: »Schweizer'n, soll ich ihn nehmen?« – »Ja« war die Antwort. – Unser Großvater hatte die Freude nicht, seine Tochter als gefeierte Tänzerin in Landau zu sehen; denn Klemens war kaum bei Mademoiselle Carry untergebracht, als des Großvaters Regiment nach Bordeaux marschieren mußte. Trotz dieser Entfernung ihres Vaters dachte unsere Mutter an kein Heimweh; ich glaube, im Gegenteil, daß es der belle Suisse sehr leid war, als sie nach zwei Jahren in die belle Suisse zurückkehren mußte. Sie kam, 20 Jahre alt, wieder zu ihrer Mutter nach St. Fiden und langweilte sich daselbst von Herzen – so vermute ich wenigstens. Die Großmutter war zwar nichts weniger als langweilig, im Gegenteil, sehr unterhaltend, aber weil sich Mutter und Tochter so fremd gewesen sind, war das Verhältnis nicht innig genug, um die heiteren Bilder von Landau durch die Freude des Wiedersehens zu verwischen. Vielleicht war auch das Verhältnis zu den Pflegeeltern ein etwas gespanntes und drückte auf der Mutter Gemüt. Sie hat mir dieses zwar niemals gesagt, allein sie sprach stets mit Unbehagen von dieser Zeitperiode, und so ist mir der eben geschilderte Eindruck geblieben. Wie aber doch jede Zeit ihre Freuden hat, so war auch dieser Episode im Leben unserer Mutter ein hoher Reiz verliehen durch die Besuche ihrer Kusine, Marie Künzle. Diese war ein eigentümliches, interessantes Mädchen; Idas Erscheinung erinnerte mich an sie. Sie war ein wenig phantastisch und kleidete sich nicht nach der Mode, sondern nach persönlichem Geschmack, und unsere Mutter, welche gar nicht phantastisch war, ließ sich manchmal auch zu romantischen Streichen von ihr verleiten; so ließ sie sich auch in einem von M. Künzles Kostümen malen; es ist ein Aquarellbild in Medaillonform, welches Rosa besitzt. Marie Künzle hatte auch eine poetische Ader und hinterließ ganze Bande von Gedichten. Sie litt etwas am Gehör und ward deshalb in das Bad nach Lenk geschickt. Das Kurhaus war sehr besetzt, und so mußte Marie in einem kleinen Stübchen nach rückwärts wohnen, was ihr sehr langweilig war. Es war damals noch Mode, seinen Namen an die Wand zu schreiben, und so schrieb sie zu vielen anderen auch den ihren hin: Anna Maria Künzle aus Gostau und schrieb noch ein Gedicht dazu.
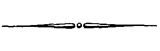
Nun schlafen sie in süßer Ruh',
Und Gottes Liebe deckt sie zu.
Er führte sie zu diesem Leben,
Wird ihnen dort ein andres geben;
Dahin zu diesen lieben beiden,
Wird er auch uns dereinst bescheiden.
Komm Männel, jetzt gehen wir miteinander nach Deidesheim und sehen, was unser lieber Vater dort macht.« – Was wird er treiben? Er kauert auf dem Boden, hat eine lange, irdene, sogenannte Köllnerpfeife in der Hand und stopft sie voll Tabak aus einem großen steinernen Hafen. Unser Vater war ein unbeschreiblich gemütlicher Mann. Sein Vater, der Geheimrat, war ein arger Schnupfer gewesen und hatte seine Söhne oft gewarnt, sich dieser Untugend ja nicht hinzugeben. Diesem Rate war unser Vater pünktlich nachgekommen, allein er war dafür ein leidenschaftlicher Raucher geworden. Später hielt unser Vater wieder seinen Söhnen seinerseits Ermahnungen, daß sie sich der Untugend des Tabakrauchens nicht hingeben sollten, und siehe da, meine lieben Brüder rauchen und schnupfen fast gar nicht, teils außerordentlich selten. Die Pfeife paßte aber auch so gut zu unserem Vater und seinem beschaulichen Leben, daß es gar nicht anders möglich war, als daß er auf das stille Akkompagnement seiner Gedanken hingeführt wurde; wäre er eine Frau gewesen, so hätte er ganz gewiß viel gestrickt.
Es gab in Deidesheim auch Maskenbälle, und der zerstreute Dr. Lederle erzählte mir einmal davon, erwähnend, eine Maske habe sich 17 mal metamorphisiert, immer wieder in die nämliche Gestalt. (Mir hat er einmal 15 Tropfen (?) verordnet, und dem Max erzählte er von Zwillingsbrüdern, wovon der eine 40 und der andere 44 Jahre alt war.) An diesen Deidesheimer Maskenbällen wird unser Vater wohl keinen Anteil genommen haben, er war wenigstens ganz gewiß nicht maskiert. Schöne Mädchen hat er übrigens recht gerne gesehen, nur durften sie nicht mager sein; er schätzte die Schönheit hauptsächlich nach der Korpulenz. Gar viel hat sich aber der Vater um die Frauenwelt nicht gekümmert; ich glaube, er war nie vorher verliebt gewesen, ehe er unsere Mutter kennen lernte; er hat wenigstens nie davon gesprochen, und er war nicht verschlossen, im Gegenteil, sehr mitteilsam, wenn niemand Fremder um den Weg war.
Die Zeit, von welcher ich jetzt rede, sind die Jahre zwischen 1798 und 1805. Der Vater war also noch Stadtschreiber in Deidesheim, aber schon damals ein gelehrter Mann. (In späterer Zeit sagte Max zu mir: »Wenn man bei Deinem Vater ist, braucht man kein Lexikon, er weiß alles!«)
Wahrscheinlich, weil er das Geld zum Doktorexamen nicht hatte, wurde er Lizentiat. Das linke Rheinufer war ja jetzt französisch geworden, und es fügte sich alles dem französischen Zuschnitt. Es kam jetzt die Zeit, wo Napoleon mit seinen Feldzügen innehielt und allerlei Verordnungen erließ, die innere Lage des Reiches zu verbessern. Unter anderem wurden auch Preisfragen aufgestellt; darunter auch eine aus der Jurisprudenz. Unser Vater machte sich daran, diese Frage zu bearbeiten – im großen Frankreich hatte er gewiß manchen tüchtigen Mitbewerber – er schickte seine Arbeit ein, und sie wurde als die beste erkannt. Er erhielt den versprochenen Preis, aber nicht in klingender Münze, sondern in Assignaten, lautend auf 3000 Franks.
Mit dem Überschicken des Geldes ward ihm eine Advokatenstelle angeboten. Die Ernennung zum Advokaten in Speier ist datiert am 23. Germinal XI. 1803 und unterzeichnet von Napoleon und Regnier.
Unser Vater griff nicht gleich zu, sein Herz war voll Pietät; er erinnerte sich, daß der greise Fürst Styrum noch lebe, welcher vor Zeiten seines Vaters Wohltäter gewesen war, und daß ihm zuerst seine Dienste gebührten. Auch zog es ihn mächtig nach dem Teile seines spezifischen Vaterländchens, welches deutsch geblieben war; denn auf dem rechten Rheinufer blieb nach dem Frieden von Campo Formio alles beim alten. So kam er nach langer Zeit wieder nach Bruchsal; er hatte noch entfernte Verwandte dort: »Bäschen«. Wer aber diese Bäschen waren, weiß ich nicht. Er machte seine Aufwartung bei dem Fürsten, sagte ihm, daß er sich Kenntnisse erworben habe, und zeigte ihm die Belege hierüber. Er bot dem Fürsten Styrum seine Dienste an, aber dieser lehnte sie ab, indem er erklärte, er werde nie ein Kind von Jakob Loew in seiner Nähe dulden. Styrum hatte sich in den Eigensinn hineingelebt, welcher hohen Alter ebenso eigen zu sein pflegt wie den Kinderjahren. Unser Vater ging mit einem Seufzer an den Goldfischen vorüber und drehte für immer Bruchsal den Rücken. So kam es, daß Hans Loew Advokat am Bezirksgericht in Speyer und französischer Untertan geworden ist. Er mietete sich ein Zimmer bei Kaufmann Hetzel auf der Domstraße und einen Garten vor dem Wormser Tore. Das »Gürteln« gewährte ihm stets großes Vergnügen. Aber in welchem Aufzuge ging er in diesen Garten? Antwort: Mit der Gießkanne in der Hand ging er jeden Abend von seiner Wohnung bei Hetzels durch die Straßen bis vor das Tor in seinen Garten und also auch wieder zurück. Freilich war die Stadt Speyer so ganz still und ausgestorben, daß er auf seinem Wege nicht sehr vielen Leuten begegnete, aber immerhin sah man ihn auch von den Fenstern aus. Mir ist im Leben nie mehr jemand vorgekommen, dem alles was Form des Anzuges anbelangt – auf seine Leibwäsche und täglich frische weiße Halsbinde hielt er – so ganz gleichgiltig war wie unserem Vater; daß er dadurch auffallen könne, fiel ihm gar nicht ein. Wir Töchter hatten deshalb später oft unsere Not mit ihm; aber ich glaube, es geht meinen Töchtern mit mir auch nicht besser; denn ich habe Zeiten, wo mich der kleinste gesellschaftliche Zwang anwidert, und doch weiß ich recht gut, daß es von einer Frau ein großer Fehler ist, sich der Konvenienz nicht fügen zu wollen; ein Mann darf sich eher etwas der Art erlauben. Unser Vater war ein Philosoph, und unser Bruder Titus hat außerordentlich viel Ähnlichkeit mit ihm, sowie auch in der anspruchslosen Zufriedenheit, welche durch unseres Vaters ganzes Wesen ging. Ich will hier zwei Anekdoten einfließen lassen, wie sie der Vater, öfter durch seine vernachlässigte Erscheinung hervorgerufen hat.
1. Der Vater war als Regierungsrat in Geschäften in Zweibrücken und wollte seinen Bekannten, den Appellrat Siegel besuchen, fand ihn aber nicht zuhause und hinterließ, daß er im »Hirsch« logiere. Herr Siegel kommt nach Hause und verfügt sich in den »Hirsch«. Er frägt nach Regierungsrat Loew und erhält die Antwort, daß niemand solcher da sei, worauf er aber behauptete, derselbe müsse da sein. Da sagte eines von den Wirtsleuten: »Ach das is am End' der alt Handwerksborschd; wir haben ihn im dritten Stock eing'schlosse', damit er nit fortgeht, ohne die Zech' zu bezahle!«
2. Der Vater kam auf einer Visitationsreise auch nach Kirch-Heim-Bolanden, um das dortige Landkommissariat zu visitieren. In dem Wirtshause, in welchem er abgestiegen war, aßen auch zwei Schreiber vom Landkommissariat zu Mittag, hielten ihn für einen Schneider, äußerten dahin zielende Anzüglichkeiten und meckerten: »Mäh, mäh, mäh!« Zu ihrem großen Erstaunen sahen sie nachmittags den angemeckerten Schneider als visitierenden Regierungsrat eintreten, und der Vater verhehlte ihnen nicht, wie ihr Betragen unter allen Umständen ein ungezogenes war.
Wenn unser Vater in seinen Garten hinausspazierte, kam er an einem Haus vorbei, welches ihm sehr wohl gefiel, und da er nun schon mehrere Jahre Advokat war und eine gute Praxis hatte, so kaufte er dieses Haus am Weidenberg, weiß angestrichen und mit grünen Läden. Es war sehr hübsch und heimlich in diesem Hause, ich kann es gar nicht sagen, wie sehr; besonders später, als das Haus und ich Bekanntschaft miteinander machten, da war schon das schöne Plätzl angelegt. Sechs Stufen führten aus dem Hof in den Garten, welcher um so viel höher am Weinberg lag. Im Garten gab es sehr viele Trauben und anderes Obst und auch eine Masse Spargel. Im Hof waren zwei Ställe, ein Holzschuppen, ein Brunnen mit großem Trog und ein Maulbeerbaum; aus dem Hof ging ein großes Tor auf die Straße. Das schönste war aber ein Plätzl an der Seite des Hauses, welches der Vater einebnen, mit einem grünen Geländer umgeben und mit einigen Bäumen und Sträuchern bepflanzen ließ. Nachdem das Haus hergerichtet und möbliert war, zog der Vater 1805 hinein, hatte viele Freude an seiner neuen Besitzung und war immer guter Dinge. Da bekam er einen Brief von seinem Bruder Alban aus Heidelberg, welcher ihn zur Taufe seiner Erstgeborenen, einlud, die am 25. April 1805 geboren war. Unser Vater, von jedermann als Hagestolz angesehen, obwohl erst 34 Jahre alt, fuhr nach Heidelberg, um der Taufe seiner erstgeborenen Nichte, Emilie Loew, beizuwohnen.
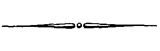
Ich kann keine Auskunft geben, wo sich des Vaters Brüder, der Alban und »der Schwarz«, während der letzten 15 Jahre aufgehalten haben. Im Jahre 1803 finde ich den ersteren in Heidelberg, wo er sich mit Hilfe unseres Vaters, welcher seinen letzten Heller für seine Brüder hergegeben hätte, als Kaufmann etabliert hatte. Vorher war Alban – ich weiß nicht, ob als Patient oder als Handlungsreisender – auch im Bade Lenk gewesen. Das Kurhaus war auch dieses Mal sehr mit Gästen angefüllt, und Alban mußte in dem nämlichen kleinen Zimmer sein Quartier nehmen, in welchem Marie Künzle gewohnt hatte. Er las die Inschriften an den Wänden und darunter auch das Gedicht der A. Marie Künzle aus Gossau, welches ihm besonders gefiel. Als er nun von den Leuten hörte, daß die Verfasserin ein sehr schönes, liebenswürdiges Mädchen, die Tochter des Landammannes von Appenzell sei, beschloß er, sich auf den Weg zu machen und sie aufzusuchen.
Im Jahre 1803, an einem schönen Sommerabend, saß der Landammann Künzle nebst Frau und Tochter vor seinem Haus, da kam des Weges daher ein freundlicher, angenehmer junger Herr, der sprach, er sei in Lenk gewesen und habe viele Grüße von dort auszurichten. Er wurde gastfreundlich von unserem Großoheim aufgenommen, die Tochter gefiel ihm, und er gefiel hinwieder der Tochter, und in wenig Tagen waren sie Braut und Bräutigam. Wie erstaunte Klementine Pfister, als sie von der Verlobung ihrer Kusine Nachricht erhielt; sie hätte sich, wie sie mir sagte, schier zu Tode geweint. Unsere Mutter nahm alles sehr schwer, so wie unsere Schwester Rosa. Nach einiger Zeit ging die Hochzeit vor sich, bei welcher unsere Mutter natürlich als Brautjungfer beteiligt war. Die jungen Leute zogen von dannen, unsere arme Mutter aber erkrankte am Gallenfieber; zu ihrer Erholung durfte sie eine Reise nach Heidelberg machen, und sie reiste hin – aber nicht mehr her. – Und nun ist der Rückblick vorüber, und unser lieber Vater wieder auf dem Wege nach Heidelberg zur Kindtaufe. Er bestieg in Speyer einen Nachen, fuhr hinab nach Ketsch, schlenderte ein wenig im Schwetzinger Schloßgarten umher, nahm ein frugales Mittagsmahl ein und fuhr dann in einem Einspänner auf der zwei Stunden langen, schnurgeraden Chaussee nach Heidelberg.
Ich weiß nicht, ob die Taufe noch am nämlichen Tage war, oder am folgenden; die Vermutung spricht für den nämlichen, weil unser Vater nicht gerne Zeit verlor. Bei der Taufe wurde ihm die Gevatterin: »das Bäsel« vorgestellt. Dasselbe war hübsch und hieß Klementine Pfister. Der Vater hatte immer großes Interesse für Kinder, aber bei dieser Taufe scheint ihn das Bäsel mehr interessiert zu haben als der Täufling, denn als nach der Kindstaufe ein Spaziergang auf das Schloß gemacht wurde, da sprach der Vater: »Bäsel, wollen Sie mich heiraten?« Und das Bäsel sagte wenigstens nicht »Nein«. Am andern Tag, ehe er wieder nach Speyer zurückkehrte, fragte er noch einmal: »Nun Bäsel, ist es Ihr Ernst, wollen Sie mich heiraten?« Und das Bäsel sagte »Ja«, es sei ihr Ernst. »Nun so schreiben Sie an Ihre Eltern um deren Einwilligung, sowie um Ihre Papiere; für alles übrige will ich sorgen.«
Onkel Alban und Tante Marie waren hocherfreut über diese Verlobung, obgleich ihnen dadurch ein Erbonkel entzogen wurde, und das Bäsel schrieb an seine Eltern. Wo aber diese sich aufhielten, davon habe ich keine Ahnung; vielleicht war die Großmutter bei ihrem Manne in Bordeaux. In diese Zeit fällt ein sehr trauriges Ereignis, nämlich die Gefangennahme des Onkels Pepi, einzigen Bruders unserer Mutter, welcher das Unglück hatte, sich beim Korps des Generals Dupont zu befinden, das dieser feiger oder verräterischer Weise an die Spanier überlieferte.
An ihre Eltern also schrieb die Mutter um die Erlaubnis, den Vater heiraten zu dürfen, und es mag nun die Erlaubnis hergekommen sein aus Süd, Nord, Ost oder West – hergekommen ist sie und wurde nebst den übrigen Papieren von der Mutter selbst, in Begleitung ihrer Verwandten nach Speyer überbracht.
Am 18. Juli 1805 wurden unsere Eltern zuerst im Rathause zu Speyer von dem Bürgermeister – maire – dann in der Jesuitenkirche – jetzigen Reitschule neben dem Dom – im Beisein des Bezirksgerichtspräsidenten Dick, des Advokaten Heddäus, des Gerichtsschreibers Boll, und des Schreibers unseres Vaters, Ilgen, getraut und lebten in dieser Ehe bis zum 22. Oktober 1833, also 28 Jahre, 3 Monate und 4 Tage. – Die größte Sorge hatte die Mutter wegen des Vaters Gesundheit; sie selbst war, obgleich sie das, weiß Gott, nicht beneidenswerte Schicksal hatte, 17 Wochenbetten durchmachen zu müssen, immer gesund geblieben, solange der Vater lebte. Erst nach seinem Tode, welcher ihre geistige Kraft brach, verloren sich auch ihre körperlichen Kräfte überraschend schnell, und ihr Lebensquell versiegte. Und sie sollte nicht einmal auf dem nämlichen Kirchhof begraben werden wie der Vater. Der Vater liegt mit den Großeltern und sieben seiner Kinder auf dem nun verlassenen Kirchhof zu Speyer. Die Mutter aber, welche am 30. Mai 1837 starb, liegt begraben auf dem außerhalb Berghausen gelegenen Kirchhofe. Um das Grab des Vaters und um jenes der Mutter haben wir zwar Geländer machen lassen, aber unsere Entfernung und die Wogen der Zeit haben längst jede Bezeichnung dieser Gräber verwischt. In unserer unverlöschlich dankbaren Erinnerung aber blühen die schönsten Blumen für unsere geliebten Toten, deren Andenken von Jahr zu Jahr von uns nur noch höher verehrt und inniger gepflegt wird, je mehr wir erkennen, was wir in ihnen verloren. Der größte Schmerz, welcher unseren Eltern gemeinschaftlich beschieden war, ist der Tod ihrer drei erstgeborenen Kinder und später noch zwei jüngerer gewesen. Ich glaube, der Vater hätte ohnehin am liebsten alle 16 Kinder beieinander gehabt. Er bedauerte oft, daß ihnen keine Zwillinge beschieden waren, was ihm gut gefallen hätte.
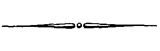
Folgende waren und sind die Loewschen Kinder in chronologischer Folge:
1. Kamillus Leonidas, geb. zu Speyer im August 1806, gest. daselbst im Juni 1807.
2. Marie Rosa Klementine, geb. am 10. Oktober 1807, gest., 4 Jahre alt.
3. Gustav Alban, geb. im Dezember 1808, gest., 4 Jahre alt.
4. Johanna Amanda, geb. am 28. Januar 1810 (Patin Urgroßmutter) gest. zu Bamberg am 13. März 1884. War verheiratet an Ober-Appellgerichtspräsident Max von Dall'Armi.
5. Maria Magdalena Amalia, geb. zu Speyer am 24. Februar 1811, heiratete den Fürsten Karl Theodor Wrede.
6. Johann Josef, geb. und gest. zu Speyer im Jahre 1812. Wurde 7 Monate alt.
7. Friedrich, geb. und gest. zu Speyer im Jahre 1813.
8. Titus Johann, geb. zu Speyer am 6. Januar 1815.
9. Anton Georg Wilhelm Ludwig, geb. zu Worms am 4. April 1816, gest. zu Speyer am 2. März 1838.
10. Johann Klemens, geb. zu Speyer am 21. März 1817. Pate der Großvater.
11. Guido, geb. zu Speyer am 18. Mai 1813. Pate der Großvater.
12. Jakob, geb. zu Berghausen, 13. August 1819.
13. Rosina Franziska Josepha, geb. zu Berghausen, 30. November 1821.
14. Eugen Georg Franz, geb. am 14. März 1823 zu Berghausen.
15. Klementine Amanda Amalia Rosa, geb. zu Speyer am 8. Januar 1828, gest. daselbst am 4. November 1837.
NB. Im Jahre 1818 wurde ihnen noch ein fremdes Kind vor die Tür gelegt, das sie als eigenes annahmen und nach dem Fundort: Katharina Weidenberg nannten. –
Der Rest des Jahres 1805 ging für unsere Eltern in stillem, häuslichem Frieden vorüber. Die einzigen unangenehmen Tage waren die, wenn sie Einquartierung hatten, und diese fürchterliche Last hörte damals selten auf. Es war in unserem Hause obenauf ein eigenes großes Zimmer eingerichtet, »die grüne Stub'«, für die Offiziere, die wir ins Quartier nehmen mußten; die Bedienten trieben im unteren Stockwerk ihr Wesen. Sonst hatte die Politik keine so große Aufregung mehr für die Rheinlande, die letzten zwanzig Jahre hatten mit allen, vertraut gemacht. Der Vater brachte alle freie Zeit im Garten zu und legte viele Spargelbeete an; die Mutter füllte ihre Mußestunden mit Spinnen aus, und sie spann sehr schön und sehr fleißig; sie spann aber nicht am Spinnrad, sondern an der Spindel. Ich glaube, unsere Eltern hatten gar keinen geselligen Verkehr und kamen fast gar nicht aus dem Hause. Nur wenn Komödianten dagewesen sind, da ist die Mutter gewiß öfters ins Theater gegangen; sie sah für ihr Leben gern Komödie spielen, gerade wie ihre Kinder. Einen Kummer hatte aber die Mutter immer noch, nämlich den ewigen Hader mit der Theres, der von früher her im Hause befindlichen ehemaligen Haushälterin des Vaters. Die Großmutter spann noch schöner als die Mutter, unter anderem auch Nesseltuch für unseren Vater zu einem Hemde; das Hemd hatte ein Spitzenjabot, und der Vater trug es bei festlichen Gelegenheiten. In späteren Jahren, als die Rheinpfalz schon wieder bayrisch war, gewann die Mutter einmal bei einem landwirtschaftlichen Feste den ersten Preis im Spinnen; es war ein silberner Gedenktaler in einen, roten Etui.
Im Laufe dieses Jahres gelang es der Mutter, die Theres los zu werden, und ich bin überzeugt, daß sie dieses mehr interessierte, als daß am 6. August Kaiser Franz die deutsche Kaiserkrone niederlegte – es war am Ende für sie auch wichtiger. Im August kam unser Bruder Kamill auf die Welt, und wie man ihm den Mund auswaschen wollte, bemerkte man, daß das Kind bereits einen Zahn habe. Zur Taufe kamen die »Heidelberger« herüber, auch die kleine Emilie. Es machten aber Onkel Alban und Tante Marie unsern Eltern Eröffnungen, welche diese sehr betrübten. Es hatte nämlich der Onkel, weil die Tante sich in Heidelberg gar nicht eingewöhnen konnte, seine Handlung daselbst verpachtet und war im Begriff, nach Gossau zu ziehen, um dort ein neues Geschäft anzufangen, und sie zogen auch wirklich fort. Unsere Mutter hatte auch immer Heimweh, und dieses verbitterte ihr wahrhaft das Leben und dem Vater wahrscheinlich mit; denn er hätte für sein Leben gern die Mutter immer vergnügt gesehen. Aber wie konnte auch einer Schweizerin Speyer gefallen? Wir Kinder haben uns geärgert, wenn die Mutter ewig über Heimweh klagte, und wie fand ich ihre Sehnsucht gerechtfertigt, als ich zum erstenmal ein Stück von den Alpen sah! Der Vater war der rücksichtsvollste, aufmerksamste und liebenswürdigste Ehemann, den man sich denken kann, und was war er für ein zärtlicher Vater! Ich kann ihn ewig sehen und hören, wie er seine kleinen Kinder herumgeschleppt und ihnen vorgesungen hat. Aber der Vater arbeitete den ganzen Tag, und so war die Mutter viel allein und hatte Zeit, ihrer Sehnsucht nach der Heimat nachzuhängen; sie hatte das unglückliche Gemüt der Rosa – wenn sie nicht stets von außen angeregt wurde, verfiel sie in innerliches Brüten. Der kleine Kamill wird gewiß einen erheiternden Einfluß auf die Mutter ausgeübt haben. Der Vater hatte das unschätzbare Glück, immer heiteren Humors zu sein. Er selbst hatte fast gar keine Bedürfnisse, war immer zufrieden und gab der Mutter alles, was sie nur wollte. Der Vater war so einfach, wie ich niemanden sonst gekannt habe, und brauchte auch keine Bedienung. Im Sommer stand er oft um 2 Uhr, im Winter um 4 Uhr auf, um zu arbeiten; er machte dann selbst Feuer in dem Ofen und kochte sich seinen Kaffee. Die Mutter dagegen liebte es, soweit ich zurückdenken kann, morgens lange im Bett zu bleiben und im Bett ihren Kaffee zu trinken. Wenn die Köchin das Frühstück bereitet hatte, so richtete der Vater die Portion für die Mutter auf einem Servierbrett her, trug es in ihr Zimmer und rief: »Das Marktschiff kommt!« worauf die Mutter sich im Bett aufrichtete, um ihren Kaffee zu trinken, nachdem ihr der Vater noch vorher die Kissen aufgeschüttelt hatte.
Unseres Vaters jüngerer Bruder Alban war also jetzt in Gossau, und wo war »der Schwarz«? Leider finden wir ihn in herabgekommenen Zustand im Hause seines Bruders, d. i. bei unserem Vater wieder, – er war ein Trunkenbold geworden. Da man ihn nicht wohl mehr in einer Handlung unterbringen konnte, so verwendete ihn der Vater, der eine große Praxis hatte, als Schreiber bei sich. Es war gut, daß der Vater soviel Geld verdiente, denn er hatte sehr viel Familienlast. »Der Schwarz« kam übrigens sehr gut mit der Mutter aus und redete ihr immer von seinen guten Vorsätzen vor, und wenn er dann wieder getrunken hatte, dann weinte er wie ein Kind. Unter anderen: vertrank er auch des Vaters Uhr und gab vor, daß er sie aus Versehen in den Abtritt fallen ließ. Dieser Verlust wurde Veranlassung, daß die Mutter dann dem Vater jene goldene Repetieruhr zum Geschenk machte, welche der Vater bei seinem Tode als Andenken dem Eugen hinterließ. Im Juni 1807 starb unser kleiner Kamill, und auf unseres Vaters Geburtstag, am 10. Oktober, kam unsere Schwester auf die Welt; sie war das Entzücken unseres Vaters, wie er denn überhaupt eine Vorliebe für die Mädchen hatte und ein sehr galanter Mann war.
Es muß ungefähr um diese Zeit gewesen sein, daß unsere Mutter den Wunsch aussprach, eine Kuh zu besitzen; sofort kaufte ihr der Vater eine, dann zwei und zuletzt gar drei. Die Mutter fing einen kleinen Milchhandel an und hatte daran ungeheuere Freude, es war eine kleine Schweizerei.
Ich denke, es muß in diesem Jahre gewesen sein, daß die Albanschen wieder nach Heidelberg zurückgekommen sind; sie hatten in Gossau schlechte Geschäfte gemacht und die Handlung in Heidelberg wieder aufgenommen. Der Vater gab auch hier wieder seine Beisteuer. Im Dezember kam unser Bruder Gustel auf die Welt. Die Albans hatten auch wieder 2 Kinder mehr zurückgebracht und hatten jetzt drei Töchter: Emilie, Marie und Lilli; letztere wurde am 29. Februar 1808 geboren. Wenn die Heidelberger mit ihren drei Mädeln zu uns kamen, war ein großer Spektakel im Hause, und »der Schwarz« und Vaters Sekretär, Herr Ilgen, hatten sehr viel zu tun, die Kinder in der Reihe zu halten.
Im Jahre 1809 kam zwar kein Kind auf die Welt, aber es kam doch eine neue und liebe Hausgenossin dazu, unsere liebe, interessante Großmutter. Wie es gekommen ist, daß die Großeltern sich wieder getrennt haben, weiß ich nicht; vermutlich machte es der unter Kaiser Napoleon unaufhörliche Garnisonswechsel den Offiziersfamilien unmöglich, dem Familienhaupt überallhin zu folgen. Die Großmutter hatte natürlich auch ihre unaussprechliche Freude mit ihren Enkeln. 1809 war das Christkindl schon sehr brillant, die kleine Ros' bekam aus der Schweiz viele schöne Sachen geschickt.
Für dieses Jahr muß ich mir eine frische Feder schneiden lassen, denn es kommt ein Knalleffekt. Am 28. Januar, abends 10 Uhr kam ein Mägdlein auf die Welt, welches durch seinen großen Mund und seine schwarze Haut zu den schönsten Erwartungen berechtigte. Da dieses Mädchen »Amanda« getauft wurde, so verbietet mir die Bescheidenheit, zu bemerken, daß sie hinter den kühnsten Erwartungen zurückgeblieben ist. Es mag sein, daß ich recht erschrocken bin, weil der Nachtwächter in dem Augenblicke blies, als ich auf die Welt kam, und daß ich mich deshalb mein ganzes Leben lang vor dem Nachtwächter gefürchtet habe. Die Urgroßmutter war aus der Schweiz hergereist, um mich aus der Taufe zu heben, und wahrscheinlich geschah es auf ihren Wunsch, daß ich den Namen ihrer verstorbenen Enkelin Amanda erhielt. Bei der Taufe hielt mich Urgroßmutter auf den Armen, und die kleine Ros' hielt eine Kerze. Auf dem Tische stand ein Kruzifix, welches nur einen Arm hatte, so daß Ros' den Herrn Pfarrer fragte: »Was ist denn das? Ist das der Storch?« Das Jahr 1810 hatte genug geleistet, als es mich zur Welt brachte, und man konnte ihm nicht mehr zumuten.
Das Jahr 1811 brachte nicht nur den großen Kometen, es brachte auch guten Wein und unsere gute Schwester Amalie, als Kind »Male« genannt. Wir 4 Kinder: die Ros', der Gustl, die Male und ich, wir machten unseren 4 Kindsmägden, der Großmutter, der Mutter, dem »Schwarz« und Herrn Ilgen viel Plage; auch der Vater wurde in seinen freien Stunden beigezogen. Er ging mit uns im Zimmer auf und ab und sprach: »Äpfel und Biere, mit langem Stiele, Wendum!« oder er zog dem Buben den Kopf zwischen den Beinen durch und ließ ihn einen Purzelbaum machen; oder er spielte Papiermüller mit uns: »Holleho! Wer ist do? Der Papiermüller. Was macht er? Papier. Wie macht er's? So!« Und mit welcher Herzenslust klopften wir da auf den Tisch! Aber wenn wir ungezogen waren, wie erschraken wir auch, wenn uns der Vater zurief: »Wart, ich will euch den Kopf zwischen die Ohren stecken!« – Gustl, welcher sich einmal an heißen Fleischkücheln den Mund verbrannt hatte, nannte diese fortan »Beißmichnicht«, welchen Namen sie im Loewschen Hause auch behielten. Ros' war, wie auch leicht begreiflich, der entschiedene Liebling des Vaters und Gustl der der Mutter; die Großmutter hing sich mit ganzer Seele an ihr kleines Patchen, an die Male, so daß ich leer ausging. Es müßte nur sein, daß der »Schwarz« und Herr Ilgen sich in mich geteilt hatten, wovon ich aber niemals etwas gehört habe. Der Vater zeigte mir auch den großen Kometen und konnte seinerzeit nicht begreifen, daß ich mich (10 Jahre später) nicht mehr daran erinnerte. Am 2. April 1811 wurde der Vater Juge suppléant in Speyer.
Das Jahr 1812, welches so viele Menschen unglücklich gemacht hat, war auch eines der unglücklichsten im Leben unserer Eltern. Im Anfange des Jahres bekamen sie einen Sohn, den Hänsel, nach 7 Monaten starb er, und 8 Tage nach ihm starb auch Gustl; Ros' war einige Wochen vor diesen beiden gestorben. Von diesen drei Geschwistern weiß ich aus eigener Erinnerung gar nichts mehr, als daß ich den Gustl als Leiche gesehen habe. Als Ros' und Gustl starben, setzte sich der Vater in den Kopf, sie hätten sich vergiftet. Es war nämlich in unserem Garten auch Sauerampfer gepflanzt, von welchem wir Kinder immer aßen, wenn wir in den Garten kamen. Inmitten dieses Sauerampfers fand man nun auch eine Schierlingpflanze, und dieses gab Veranlassung zu obiger Annahme. Meine Wenigkeit erkrankte auch, ganz mit den nämlichen Symptomen, mit welchen die anderen erkrankt waren; aber es zeigte sich, daß ich den Scharlach hatte. Ich war 9 Wochen lang krank und dabei unaussprechlich ungezogen; zwang dadurch auch eine Magd, sich zu mir ins Bett zu legen, auf welche ich mich als glühender Balken querüber legte. Ich kam, Gott sei Dank, mit dem Leben davon, und da sie dann niemand mehr hatten, als die Male und mich, so werde ich nach meiner Krankheit besser in Ansehen gestanden sein als vorher; Male blieb vom Scharlach befreit. Nun waren von 6 Kindern nur noch 2 übrig, und die Mutter war am Schluß des Jahres auch noch unglücklich, wahrscheinlich infolge des vielen Schreckens, den sie durchzumachen hatte. Es wäre hinreichend gewesen, um schwer gebeugt zu sein, wenn auch nur das Unglück mit den Kindern allein gekommen wäre, aber es kam noch mehr. Als das französische Heer nach Rußland zog, kam der Großvater auf dem Durchmarsche zu uns; wir hatten ihn noch nicht gesehen und saßen eines Mittags bei Tisch, als ein hagerer blasser Mann in einer roten Uniform ins Zimmer schwankte, so leise, daß ihm kaum jemand hörte. Die Großmutter blickte von ihrem Teller auf und stieß einen durchdringenden Schrei aus. Es war der Onkel Pepi, ihr Sohn, ihr durch die Gefangenschaft zugrunde gerichteter Sohn. Pepi hat sich in diesem Zustande des Elends malen lassen, und wir alle kennen das traurige, bleiche Bild. Am 23. Juli 1808 war nämlich die Kapitulation von Baylen abgeschlossen worden, und Onkel Pepi, der sich beim Korps des General Dupont befand, wurde jenen zugeteilt, die nach Cabrera kamen, wo sie die Engländer fast alle verhungern ließen. Die Gefangenen waren auf Cabrera ganz entsetzlich schlecht behandelt worden, nur im Anfang hatte man sie notdürftig mit Nahrung versehen, aber später waren sie ganz vergessen worden. Sie hatten nicht einmal alle Obdach, und außer einigem halbwilden Vieh gab es nichts Eßbares auf der Insel. Der größte Teil der Gefangenen ist buchstäblich verhungert; Pepi sagte, es sei im letzten Jahre ein einziges Schiff an der Insel gelandet. Viele der Armen ertränkten sich, und auch unser Onkel sprang mit dieser Absicht mehrmals ins Meer; aber da er schwimmen konnte, so leitete ihn der Erhaltungstrieb immer wieder ans Ufer. Als man sich der armen Kriegsgefangenen nach 3 Jahren erinnerte, waren von den 300 Mann, welche die Engländer nach Cabrera gebracht hatten, noch 29 am Leben. Diese hatten sich in einem alten Turm eingenistet, dem einzigen Gebäude, welches sich auf der Insel befand. (Die Franzosen haben die Knochen in einen ungeheuren Haufen jetzt zusammengetan und ein Monument errichtet.) So hatte unser armer Onkel zwar seine Freiheit wieder, aber seine Gesundheit war unwiederbringlich verloren, er litt in hohem Grade an Epilepsie, alle Heilungsversuche scheiterten.
Der Großvater befand sich mit der großen Armee auf dem Marsche nach Rußland in Magdeburg und hatte Gelegenheit, eine gute Tat zu verrichten, welche ihm reiche Früchte trug. Er ging nämlich in einem Walde, nicht fern von der Landstraße, spazieren und hörte schreien wie Hilferufe, ging sogleich auf den Ort zu, woher dies kam, und fand einen umgeworfenen Reisewagen und eine Dame, welche jammernd daneben stand. Der Kutscher lag gebunden am Boden, und 3 Kerls waren beschäftigt, den Wagen auszuräumen. Der Großvater zog den Degen und stürzte auf sie los, so daß diese nach kurzer Gegenwehr die Flucht ergriffen. Er löste dann die Bande des Kutschers, half ihm den Wagen aufrichten und wieder packen, hob die Dame hinein und begleitete sie noch ein Stück Weges, bis sie ganz in Sicherheit war. Die Dame war natürlich voller Freude und Dankbarkeit.
In Speyer herrschte indessen große Betrübnis wegen Pepis traurigem Zustande, und dadurch verdoppelte sich die Angst und Besorgnis um den Großvater, der auch schon 58 Jahre alt war. Um nun diesem Jammer abzuhelfen, entschloß sich unser Vater, der immer lieb- und hilfreiche, dem Großvater nachzureisen und ihn womöglich zurückzubringen. Der Großvater war unendlich gerührt, als der Vater bei ihm eintraf.
Ich muß hier einschalten, daß der Großvater sein ganzes Leben lang, d. h. den ganzen Rest seines Lebens, von der innigsten Liebe und Dankbarkeit für den Vater erfüllt war. Er verehrte ihn so sehr, daß diese Verehrung an Anbetung grenzte. Wenn die Mutter den Vater manchmal ein wenig quälte, war der Großvater ganz entrüstet. Die Mutter quälte aber den Vater nur deshalb, weil er sie zu sehr verwöhnt hatte. Wenn die Mutter weinte, suchte der Vater alles mögliche auf, sie zu beruhigen. Sie hatte einmal ausgesprochen, es gefalle ihr so gut in Baden-Baden, und nun ließ er sie jedes Jahr einen Aufenthalt dort nehmen. Sie durfte alles tun, was sie wollte, und der Vater wurde nur dann ungeduldig, wenn sie ihn in seiner Studierhöhle störte. Ich denke, der armen Mutter Nerven waren recht angegriffen durch die vielen Wochenbetten und den Kinderlärm. Der Großvater nannte den Vater immer »Herr Sohn«, und dieses »Herr Sohn« sprach er in einem Tone, welcher an Andacht grenzte.
Doch wir dürfen unsere beiden Herren nicht gar so lange in dem staubigen Magdeburg sitzen lassen. Der Großvater war nach fast 36 Dienstjahren nicht mehr sehr darauf versessen, den Feldzug nach Rußland mitzumachen, allein er zweifelte, ob er seinen Abschied bekommen werde. Der Vater verfügte sich zum Kommandanten, dieser aber wollte nichts von Abschied hören, so daß Vater und Großvater bereits alle Hoffnung aufgegeben hatten und in nicht sehr gehobener Stimmung einen Spaziergang auf dem Walle machten. Hier begegneten sie einem Herrn und einer Dame und erkannten in ersterem den Kommandanten, während letztere zu gleicher Zeit in dem Großvater ihren Retter aus Räuberhand erkannte und auf die lebhafteste Weise die Freude zu erkennen gab, ihn wiederzufinden. Jetzt kam auch dem Herrn General die Einsicht, daß der Großvater seine Pension wohl verdient habe. Er versprach, ihm dieselbe zu verschaffen, und erwirkte auch, daß der Großvater sogleich austreten und mit dem Vater heimreisen durfte. Der Großvater bekam zwar seine Pension niemals, aber er hat es gewiß nie zu fühlen gehabt, daß unser Vater sein Erhalter war. So hatte der Vater nicht nur seine Frau und Kinder im Hause, sondern auch die Schwiegereltern und den Schwager. Ein anderes Glied der Familie war leider während seiner Abwesenheit verschwunden, nämlich sein Bruder »der Schwarz«. Er war wieder betrunken gewesen, schämte sich sehr, weinte der Mutter einen ganzen Tag vor und war am anderen Morgen verschwunden, ohne jemals wieder zum Vorschein zu kommen. Der Vater gab sich alle erdenkliche Mühe, um seines Bruders wieder habhaft zu werden. Allein er hörte nichts mehr von ihm als ein dunkles Gerücht, er habe sich in Frankfurt engagieren lassen; wahrscheinlich liegt er bei den Hunderttausenden, welche in Rußland den Tod fanden. Wir Kinder warteten fort und fort auf die Wiederkehr des »Schwarz« und machten uns über sein Schicksal die abenteuerlichsten Illusionen.
Unser Vater muß als Advokat sehr viel Geld verdient haben, sonst wäre es nicht möglich gewesen, diesen kostspieligen Haushalt durchzuführen und doch noch etwas zu erübrigen, wie dieses ja geschah. Er kaufte jetzt ein kleines Anwesen in Berghausen bei Speyer, ein Stück Land von 15 Morgen, ließ das daraus stehende Bauernhaus einreißen und ein anderes einfaches Häuschen nach seinem Geschmacke ausbauen. Berghausen hat eine gesündere Lage als Speyer, und der Vater bestimmte dieses Häuschen für die Großeltern und deren unglücklichen Sohn Pepi. Er hoffte, auf dem Lande werde er sich doch vielleicht erholen können. Allein seine liebevollen Bestrebungen sollten erfolglos bleiben; die Anfälle, denen der arme Onkel unterworfen war, wurden immer heftiger. Auf eigenen Wunsch des Patienten und auf Zureden der Eltern entschloß sich der Vater endlich, den Unglücklichen in das Militärspital nach Chârendon zu bringen. Als französischer Offizier hatte er das Recht, die Pflege daselbst zu verlangen. Wenige Monate später ist der Arme dort am Blutsturz gestorben; er war erst 33 Jahre alt.
Der Vater hatte mit den Heidelbergern auch wieder Sorgen. Albans gaben ihren Laden zum zweitenmal auf und zogen wieder nach Gossau. Zu Ende dieses Jahres bekam die Mutter einen Knaben, das Fritzel, welcher am 9. Tage schon starb. Während dieser ganzen Zeit hatte es immer Einquartierung gegeben, allein was geniert das Kinder? Male und ich hatten immer die größte Freude, wenn wir wieder neue Einquartierung bekamen. Unter anderem war auch einmal der spätere bayrische Rittmeister Koller bei uns im Quartier und setzte einmal mit seinem Pferde über das grüne Geländer, welches das Plätzl umgab, als andringende Russen gemeldet wurden. Dieser spätere Rittmeister Koller wollte mich, als ich 15 Jahre alt war, heiraten und meinte, ich solle einen Fußfall vor dem König tun, damit er uns ohne Kaution heiraten lasse; ich hatte aber weder zu einem noch zu dem anderen Lust. Ich erinnere mich noch dunkel, wie sehr unsere Eltern und Großeltern in Aufregung waren, als die Schlacht bei Leipzig geschlagen wurde, hatte aber natürlich damals keine Idee von dem, was vorging.
Es kamen die Retirade der französischen Armee und dann die ihr folgenden Heere der Alliierten. Ich erinnere mich noch des Einzugs der Kosaken mit ihren langen Spießen, sowie des verheerenden Auftretens des Typhus in jener Zeit. Die Leichen wurden auf Leiterwagen nach dem Kirchhof gefahren. Arme und Beine hingen zu den Leitern heraus. Einmal konnte man sie abends nicht mehr einscharren, von einzelnen Gräbern konnte natürlich keine Rede sein, sondern man warf sie zusammen in eine große Grube, und als am andern Morgen der Totengräber auf den Kirchhof kam, um die Leichen mit Erde zu bedecken, war einer davon wieder zu sich gekommen und saß am Tor. Unser Arzt, Dr. Dukar, der unserem Hause nahe befreundet war, erzählte uns dieses und war zwei Tage darauf selbst eine Leiche.
Es gab in jener Zeit ganz entsetzliche Ereignisse und Einquartierung zum Überdruß. Am zuwidersten waren uns die unflätigen Russen, welche uns immer küssen wollten. Uns Kinder interessierten aber wenig diese Retirade, dieser Typhus usw., wohl aber beschäftigte sich mein Kopf mit der Kontroverse, ob es einen Osterhasen gebe. Male verklagte mich wegen dieser Gotteslästerung bei Herrn Ilgen. Dieser verstand es prächtig, auf die Ideen der Kinder einzugehen; er rief uns eines Morgens in den Garten und sagte zu mir: »Da sieh einmal, Amanda, der arme Osterhas'!« Ein Hase steckte im Buchs, welcher sich scheinbar mit einem Spahn gespießt hatte, und da noch einige Eier hinter ihm lagen, so waren meine Zweifel vollständig widerlegt, und Male und ich weinten bitterlich, weil der Osterhase nunmehr gestorben war.
Der Großvater und die Großmutter hatten den ganzen Sommer in Berghausen gewohnt und die Male auch mit hinausgenommen; es war aber sehr traurig für mich, meine Gesellschafterin zu verlieren, und vermehrte noch mein träumerisches Wesen. Glückselige Tage waren die, wenn ich mit der Mutter nach Berghausen durfte und wir dann bei der Großmutter grüne oder Kässpätzle aßen. Manchmal kochte auch der Großvater. Er war in seinem bewegten Leben oft in die Lage gekommen, es praktisch üben zu müssen. Brod zur Suppe oder die Nieren recht fein schneiden, das waren ohnedies seine beständigen Aufgaben. Ein Gericht von übrigem Fleisch, Weck und Eiern bereitet, nannte er und wir ihm nach: »Katzeng'schrei«. Im Herbst kamen die Großeltern wieder in die Stadt. In diesem Jahr kam auch der Anfang eines langen, langen Kummers für uns alle. Der Vater hatte ein Gichtleiden im Fuß, was ihm der Arzt ungeschickterweise vertrieb, so daß sich der Krankheitsstoff auf die Brust warf. Unser lieber, guter Vater wurde brustleidend und blieb es sein Leben lang. Noch jetzt, wenn ich manchmal recht zerstreut bin, glaube ich den Vater husten zu hören, und es rieselt mir kalt über den Rücken. Wenn unser Vater nicht so regelmäßig und einfach gelebt hätte, hätte er nicht 62 Jahre alt werden können.
Jeden Abend saßen Male und ich in der oberen Kinderstube auf 2 kleinen Kinderstühlen und hatten zwei Teller Brei vor uns. Wir ließen den Brei stets eine Weile stehen, damit er eine Haut ziehe, und es war jeden Abend ein Gegenstand hohen Interesses, zu untersuchen, wer eine dickere Breihaut habe. Am Abend des 6. Januar 1815 mit einer solchen Vermessung beschäftigt, brachte uns die Großmutter die Nachricht: »Ihr habt e Brüderle kriegt«. Welches Erstaunen und welche Freude. Die Großmutter führte uns hinunter in die »braune Stub'«, wo das Brüderle eben gewaschen wurde. Male und ich waren ganz verklärt von Glück, besonders als das Brüderle wieder gewickelt war und wir es ein wenig auf den Arm nehmen durften. Das Brüderle wurde »Titus« getauft. – In diesem Winter lehrte mich der Großvater heimlich lesen und schreiben, und wir überraschten den Vater mit meinen errungenen Kenntnissen, welcher mich aus Freude darüber in einen Buchladen führte und mir Raffs Naturgeschichte kaufte. An dem ersten Kinde finden die Eltern alles wunderbar.
Infolge der Kriegsereignisse kam ein Teil der deutschen Lande auf dem linken Rheinufer von Frankreich wieder an Deutschland; darunter war der spätere bayrische Rheinkreis. Hiervon war eine Folge, daß man sich um landeskundige tüchtige Männer umsah, welche die entfernten französischen Verwaltungsbeamten ersetzen sollten, und man machte auch unserem Vater Anträge, in die provisorische gemeinschaftliche Landesadministration als Rat einzutreten. Da die Anstrengung des öffentlichen Redens für das Brustleiden des Vaters bedenklich erschien, so nahm er die angebotene Stelle als Rat an, obwohl sie lukrativ weit hinter seiner Anwaltspraxis zurückblieb. Am 8. April 1815 erhielt er seine Berufung zur Kriegsschulen-Liquidationskommission, welche ihren Sitz zuerst in Kreuznach hatte, und am 1. Mai 1816 als Rat bei der Landesadministration, zuerst in Worms, dann in Speyer etabliert, wo die Herren Kurz, Boyé, Siegel und Fliesen seine Kollegen waren. Vermutlich war es dem Vater zweifelhaft, ob der Sitz der Administration in Worms bleiben werde, denn er nahm nicht gleich seine ganze Familie, sondern – um nicht ganz allein zu sein – nur mich mit nach Worms. Am Tage, an dem ich 5 Jahre alt wurde, befand ich mich mit dem Vater ganz allein in Worms, und er schenkte mir einen Dukaten. Zuerst wohnten wir bei Dabry auf dem Markte und dann in der Wallergaß bei einem Musikanten, welcher Alfutt hieß. Wir fuhren recht oft nach Speyer und besuchten die Mutter und in Berghausen die Großeltern; wir hatten damals 3 Haushaltungen: in Berghausen der Großvater, die Großmutter und die Male; in Speyer die Mutter mit dem Titus und seiner Bäwel, und in Worms der Vater und ich. Herr Ilgen war auch in Speyer und ordnete des Vaters Papiere.
Der Weg von Speyer nach Worms war mir immer sehr interessant, aber auch sehr schauerlich wegen des großen Waldes zwischen Speyer und der Rehhütte; namentlich war das Knoblaucheck ein gefürchteter Punkt, wo auch Regierungsrat Fliesen einmal von Schinderhannes angepackt worden sein soll.
Ich weiß nicht, ob ich im Jahre 1816 wieder mit dem Vater in Speyer war; jedenfalls war ich zu der Zeit dort anwesend, als die Großmutter erkrankte, welche im Winter in die Stadt gekommen war. Sie starb nach ganz kurzer Krankheit infolge des Genusses von Schnecken am 2. Februar 1816. Infolge dieses unglücklichen Ereignisses durfte von da an in unserem elterlichen Hause nie mehr dieses Gericht zubereitet werden, welches bekanntlich ein Lieblingsgericht der Alemannen ist. Während die Großmutter krank war, waren wir bei unserem Nachbarn, Friedensrichter Ziegenhain, in Kost und Wohnung. Bei der Beerdigung fuhr die Mutter mit uns Kindern nach Heiligenstein, wo wir in einem Wirtshaus abstiegen und Kaffee tranken. Wir hörten aber doch das Grabgeläute, und als die Mutter weinte, weinten wir mit, ohne eigentlich zu wissen warum; denn wir hatten noch keinen Begriff vom Tode.
Etwas später wohnten wir alle in Worms, mit Ausnahme des Großvaters und des Herrn Ilgen, welche das Haus in Speyer hüteten. Wir bezogen in Worms eine größere Wohnung, in welcher es so viele Ratten gab, daß wir sie nur das Rattennest nannten. Lange wohnten wir nicht in diesem Rattenloche, denn schon im März wohnten wir in einem anderen hübschen, an die Stadtmauer angebauten Hause. In diesem wurde am 4. April unser lieber, unvergeßlicher Anton geboren. Es war eben Messe in Worms, und wie uns der Vater das Brüderlein zeigte, da sagte die Mutter: »Es ist mir nur leid, daß ich nicht mehr zum 10 Batzen-Mann gekommen bin; der hatte so hübsche Sachen.« Da erwiderte der Vater: »Sei nur ruhig, Alte, ich hole Dir etwas beim 10 Batzen-Mann« und ging und kaufte ihr die »Löwentasse«, welche ich noch habe. Der Vater bat die ganze Liquidationskommission, nämlich die oben genannten 4 Herren nebst ihren Frauen zu Gevatter.
Jetzt sind bereits alle tot: Vater, Mutter, Kind, die 8 Gevattersleute und die alte Bäwel, die treubewährte Amme. Nur die Tasse mit dem Löwen existiert noch, aber sie ist jetzt auch eine Ruine. In München wurde das Plättchen zerbrochen, und ich ließ nach den Scherben in der Porzellanfabrik ein neues dazufertigen, und nun hat auch die Bärentasse selbst einen Sprung. Sie hat diesen Sprung zwar bekommen, als die berühmte Frau von Buliowsky Tee daraus trank, allein es ist halt doch ein Sprung.
Es wurde eine große Kindtaufe veranstaltet, allein Male und ich durften nicht dabei zugegen sein, sondern wurden zu einer Frau gebracht, welche hinter dem Dome wohnte und eine Strickschule hatte. Kaum wendete diese Frau den Rücken, so liefen wir nach Hause, um die Kindtaufe zu sehen. Im Vorzimmer stand ein Osterlamm von Zucker in einem Gebüsch von Rosinenzweigen. Es war das herrlichste, was eines Kindes Auge sehen konnte; wir blieben wie versteinert vor dem Lämmchen stehen. Da kam der Vater, schenkte jeder von uns einen Sechser und sagte: »Kauft euch etwas auf der Messe und bleibt dann in der Strickschule bis heute abend.« Wir liefen vergnügt davon und kauften uns rot lackierte Gießkännchen. Im Laufe der Zeit verzehrten wir das ganze Zuckerlamm; sein Wohlgeschmack war aber bei weitem nicht so groß, als sein Anblick schön gewesen war. Wir waren nun nicht mehr lange in Worms, denn der Vater wurde noch im Jahre 1816 Regierungsrat in Speyer.

Amanda von Dall' Armi mit ihrer Tochter.
Onkel Alban war jetzt abermals nach Heidelberg gezogen und hatte eine vierte Tochter: »Julchen« mitgebracht. Er gab dann aber den Laden, der gegenüber dem Schäferschen Kaffeehause lag, auf, den Louis Künzle, der Tante jüngerer Bruder, übernahm und der vielleicht noch in seinem Besitz ist.
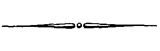
Hier schließt Tante Amanda von Dall'Armi's Erzählung.