
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Sonne! Ihre zackigen, in Blech geschnitzten, altgoldglänzenden Strahlen zierten den Giebel eines uralten, viereckigen, gänzlich freistehenden Hauses, an dessen einer Seite die Pleiße lustig eine Mühle trieb. Einstöckig, mit Mansardenräumen darüber, stand es am Ranstädter Steinweg in Klein-Paris, das seine Leute bildet. Eben dazu war auch ich hingegangen; ich wollte lernen. In der Mansardenwohnung hielt eine in Künstlerkreisen berühmte Familie Berl, halb aus künstlerischen, halb aus ökonomischen Interessen, eine Pension für Künstler, die sich bei den viellieben Menschen ungemein wohl fühlten. Merkwürdigerweise hatte meine Mutter ihrerzeit im selben Hause gewohnt, wenn auch nicht bei Berls; Richard Kahle und Mutter wohnten dort, und nun kam auch ich dahin und hatte es nicht besser treffen können. Die älteste Tochter, Toni, war Heroine in Darmstadt; die zweite, Anna, lebte bei ihr, und die dritte, Angeli, war die gute Fee des Hauses. Sie konnte alles: vor allen Dingen mit Menschen umgehen. Mutter Berl, eine noch hübsche, wenn auch schon ein bißchen wacklige Dame, hielt in ihren Speiseschränken Fläschchen, aus denen sie zuweilen selber gerne naschte, mit der scherzhaften Etikette: »Gift für Kinder!« Vater Berl war nicht von Asbest und war nicht reinlich, aber gleich seiner Gattin eine gemütliche alte Seele, der Vater vom Ganzen. Man hatte mir zwei Puppenzimmer, d. h. Wohn- und Schlafstübchen, eingeräumt mit tafelförmigem Klavier und altmodischen Möbeln, was ich sehr gemütlich fand. Puppenfenster und Gardinen vervollständigten die Behaglichkeit, und ein eiserner schmaler Ofen heizte beide Räume gleichzeitig. Sobald er glühte – was er immer tat, sobald man heizte –, wurde es unerträglich warm; sobald das Feuer aus war, fror das Wasser auf dem Waschtisch. Dafür hatte die Wohnung noch den Vorteil, daß man im Sommer die Wirkung der Bleidächer unentgeltlich kennen lernte, ohne nach Venedig reisen zu müssen, was nicht leichter zu ertragen war als die Rheumatismus erzeugende Kälte des Winters, wo es in den Dachräumen unbändig zog. Mit prächtigen Blumen und Pflanzen war alles ausgeschmückt worden durch meiner Schwester Verlobten, Herrn Fritz Helbig, den ich jetzt kennen lernte, und war nun vorbereitet auf alles, was da kommen konnte.
Schnell hatte ich mich – von allen Seiten aufs freudigste begrüßt – in die Leipziger Theaterverhältnisse hineingelebt. Schon den Wechsel des uralten, unheizbaren Danziger Theaters mit dem prachtvollen bequemen großen Opernhaus empfand ich als unendliche Wohltat. Eine »große Zeit« war es aber – wenn ich darauf zurückblicke – nicht zu nennen. Zwar wurde viel Ausgezeichnetes mit Umsicht und Verständnis vorbereitet und ausgeführt, aber nichts von all den Einzelleistungen ist mir als etwas besonders Wertvolles in der Erinnerung haften geblieben, was ich mir daraus erkläre, daß keiner der Sangeskünstler eine interessante oder künstlerische Persönlichkeit gewesen sein kann. Nur die als Mignon gastierende Frau Bertha Ehnn von der Wiener Hofoper blieb mir unvergeßlich.
Frau Peschka-Leutner, eine ausgezeichnete Koloratursängerin, wenig hervorragend als Schauspielerin, wurde mit Recht von Publikum und Presse auf den Händen getragen; für sie war ich engagiert worden, weil sie nach Dresden wollte, sich dann aber eines besseren besann. Eine ganze Weile waren wir einander unbequem, da sie alle Koloraturpartien innehatte, und ich als junge Kraft auch wieder Eigenschaften ins Ensemble brachte, die ihr mangelten. Die Spannung löste sich aber später in Hochachtung und herzlichster Kollegialität glücklich auf. Das Ensemble war immer gut, Chor und Orchester ausgezeichnet. Kapellmeister Schmidt, wie bereits berichtet, erst sehr eklig, dann äußerst liebenswürdig. Er hielt täglich von 9 Uhr ab Klavierproben, zu denen er regelmäßig eine halbe Stunde zu spät kam. Von den abgespieltesten Opern hielt er sie, übersprang keinen Takt, und nachträglich hörte ich, daß er sich selbst vor jeder Oper geängstigt hätte. Vorbilder fand ich in Leipzig nicht, wohl aber Zucht und Ordnung und außer Gustav Schmidt in Heinrich Seidl einen ganz ausgezeichneten Regisseur, der sich in feinster Weise meines Talents annahm und dem ich viel verdanke. Ging er doch alle Rollen mit mir durch, die ihm nicht ausgearbeitet genug schienen, was mir einen weiten Blick auf das Arbeitsfeld meines Berufes gewährte.
Als ich in Leipzig festen Fuß gefaßt hatte, wurde ich auch zu vielen Gewandhauskonzerten herangezogen, was damals zu den höchsten musikalischen Ehren rechnete. Meister David, der als erster Geiger die Konzerte spielte, schenkte mir nach Aufführung der Athalia von Mendelssohn den Klavierauszug mit Widmung. Dr. Carl Reinecke leitete die Konzerte. Ich stand mich gut mit ihm, und er kam mir wirklich lieb und gütig entgegen; auch später noch, wenn ich von Berlin aus zu Gewandhauskonzerten geladen war. Nur einmal hatte er, als ich Robert Franz-Lieder sang – dem er nicht grün war und die er begleiten sollte –, »einen schlimmen Finger«, und Professor Reinhold Hermann, mein steter Begleiter, mußte darum von Berlin geholt werden. Um so besser, da mir nichts fataler sein konnte als das einmalige Herunterleiern von Gesängen. War ich doch gewöhnt, durch langes Vorstudium eins zu sein mit dem Begleiter, um dem Publikum ein Ganzes zu geben; und das wäre bei aller Kunst Reineckes mit einer Probe unmöglich gewesen.
Schon in Prag sangen wir Robert Franzsche Lieder, die uns Riezl aus Leipzig gesandt. Ihr Verlobter, Fritz Helbig, war mit R. Franz intim befreundet, trug viel dazu bei, dem Ehrenfonds, der R. Franz 1873 überreicht wurde, weit möglichste Ausdehnung zu verschaffen, und verwaltete sein Vermögen bis zu seinem Tode oder auch noch darüber hinaus für dessen Kinder. Helbig hinterließ mehrere Kisten voll R. Franzscher Briefe, die freilich meist geschäftlichen Charakters sind, wohl aber auch manches Interessante enthalten, das hoffentlich einmal das Licht der Welt erblickt. Fritz Helbig war sehr musikalisch, sang ausgezeichnet und war sowohl mit dem bekannten Konzeptsänger Robert Wiedemann – der heute im 84. Lebensjahr steht – als auch mit allen andern Leipziger Künstlern eng befreundet. Kein Wunder, daß in Helbigs Haus unaufhörlich Propaganda für R. Franzsche Musik gemacht wurde, und so kamen auch wir dazu, mehr als sonst jemand, seine Lieder zu singen. Daß ich mich heute noch, nach 43 Jahren, für seine Lieder so mit voller Seele einzusetzen vermag, daran ist das innige Gefühl wohl schuld, das ich seinen kostbaren Liederperlen, nachdem ich sie zu meinem Eigentum gemacht habe, unverändert entgegenbringe; und die ich so gerne in eine neue Generation für Künstler hinüberretten möchte aus dem Bombast von Unnatur und unmusikalischem Durcheinander, das ich, ohne mich zu empören, gar nicht anzuhören vermag.
Leider kannte ich Robert Franz nicht persönlich. Was ich von seinen englischen Liedern sage, daß sie mit Originaltext gesungen fast noch besser mit der Musik zusammenpassen als mit den deutschen Worten, das hat er, wie ich später las, selber ausgesprochen. Ihrem Schöpfer konnte ich meine Dankbarkeit nicht mehr in Tönen darbringen; nur meinen Zuhörern und seinen Kindern darin auszusprechen, was ich für seine Werke empfinde, ist mir zu meiner größten Freude noch vergönnt.
Etwas sehr Merkwürdiges leistete sich David im »Fidelio«, den er ebenfalls in der Oper mitspielte, indem er zu den Violinpassagen der großen Leonorenouverture – die, wie immer gegen mein besseres Gefühl, auch hier im Zwischenakt gemacht wurde – aufstand, um die Violinen anzuführen, worauf das ganze Publikum seine Aufmerksamkeit vom Tonstück ab- und auf Herrn David lenkte. Es war unerhört und scheint mir heute fast unglaublich, daß es in Klein-Paris geduldet wurde.
Weniger lehrreich waren meine Konzertausflüge, nach Pegau z. B., wo ich fürs Konzert nur 25 Taler erhielt und mir davon auch noch den Wagen, der mich dorthin fuhr, bezahlen mußte, der 5 Taler alleine kostete. Besser und viel einträglicher dagegen diejenigen nach Cöthen, Zwickau, Plauen, Reichenbach usw., wo ich aber im Winter, in großer Toilette sehr oft im offenen Schlitten zum Konzert und aus demselben zu fahren gezwungen war, wenn der Schnee so hoch lag, daß Wagen unmöglich bergab und -auf verkehren konnten. – In dem Verein Euterpe wurden Werke von Nils-Gade, Schumanns Mignon, Requiem und Faust mit mir und Max Stägemann gemacht, der damals in schönster Blüte Konzert- und Theaterpublikum entzückte. Leider sang Stägemann nicht lang. Als ich ihn um die Ursache frug, meinte er: er habe über die ewigen Katarrhe nicht hinwegkommen können und darum dem Sängerberuf Valet gesagt. Hier haben wir einen jener vielen traurigen Fälle, wie ein als Sänger und Schauspieler gleich bedeutend großer Künstler durch Unkenntnis der technischen Mittel, Störungen der Organtätigkeit zu beheben, gezwungen wird, seiner Kunst zu entsagen. Wie schädigen solche Künstler diese weihevolle Kunst dadurch, die doch einzig auf große Talente angewiesen ist, und deren höchstes Bestreben gerade darin gipfeln müßte, sich ihr so lange als möglich zu erhalten, um andere zu lehren und dem Publikum sowohl als der Kritik einen Maßstab für Kunstleistungen zu bieten, der ja leider nicht anders erhalten werden kann. Katarrhalischen Perioden sind alle Menschen, und Sänger besonders, ausgesetzt, weil sie ihre Sprech- und Atmungsorgane, die durch vielen Gebrauch subtiler, empfindsamer sind, mehr erhitzen als andere Menschen und darum auch leichter zu Erkältungen geneigt sind. Man kann aber die Kunst, ihrer Herr zu werden, Gott sei Dank durch bewußte Technik erlernen, wenn man sich die Mühe nicht verdrießen läßt und genügend Geduld zum unermüdlichen Studium mitbringt.
Mit Heinrich Laube stand ich mich vorzüglich, wie ich mich denn von je mit allen ernst arbeitenden Geistern stand, sie mochten noch so rauhe Schalen haben. In ihrer Rauheit sah ich nichts weiter als die richtige Erkenntnis der unumgänglich notwendigen allerersten Bedingung der Kunst gegenüber, die sie von jedem, der mit oder unter ihnen schaffen wollte oder sollte, verlangen mußten: den heiligsten Ernst und vollständige Hingabe aller ihrer Kräfte. Alles andere ist Zeit- und unnütze Kraftverschwendung, deren sich so viele schuldig machen. Laube nahm großes Interesse an meinem Talent, belobte mich gar oft in neuen oder alten Rollen und war von meiner schauspielerischen Arbeit besonders befriedigt, in der ich mich ernstlich zu vervollkommnen trachtete und worin mir Operndirektor Heinrich Behr und Regisseur Seidl hilfreich zur Seite standen. Ich darf hierbei Frau Günther-Bachmann nicht vergessen, die einst zu Mamachens Leipziger Zeiten eine berühmte Soubrette gewesen und nun als komische Alte wahre Kabinettstücke feinster Charakteristik lieferte. Reizend war auch, daß eine alte Garderobiere, die meine Mutter schon angekleidet hatte, nun auch noch mir ihre Hilfe angedeihen ließ. Frau Bärwinkel, so hieß die Alte, zeichnete sich gelegentlich eines Gastspiels von Frau Artôt ganz besonders aus. Für den schnellen Umzug der Angela im letzten Akt vom »schwarzen Domino« war eine Art Garderoberaum auf der Bühne gebaut, worin alles bereit lag. Frau Bärwinkel sah aber voll Entsetzen, wie Frau Artôt auf der falschen Seite abging. Sie stürzte hinüber und sagte atemlos zu Frau Artôt, die, wie sie hörte, nur französisch sprach: » Madame, schankschemant vis-à-vis!« – Frau Günther-Bachmann, die wenig sprach und sich von allen sehr retirée hielt, war es, die mich gleich anfangs meiner Karriere vom dummen Aberglauben befreite. Sie war in meiner Garderobe, als mir die Garderobiere Schuhe auf den Tisch stellte. »Das gibt ein Unglück«, hörte sie mich sagen – was ich so oft von andern gehört hatte. »Mein liebes Kind,« sagte sie freundlich, Sie sind jetzt 20 Jahre alt, was wollen Sie dann mit 50 machen, wenn Sie all die Torheiten annehmen?« – Von dem Augenblick an emanzipierte ich mich vom Aberglauben jeder Art, denn ich sah ein, wie lächerlich es war, das Gelingen einer Rolle auf ein Paar Schuhe anstatt auf sein Können zu stellen.
Das Schauspiel war vorzüglich. Laube hatte ausgezeichnete Kräfte vorgefunden, und Kräfte aller Arten boten sich dem Meister an. Es ist fast unglaublich, wieviel starke Talente sich hier zusammendrängten. Friedrich Mitterwurzer, mit dem Laube viel experimentierte, der im Fache hin- und herschwankend bald dies, bald jenes spielte, während seine Gattin, die von Laube an die rechte Stelle gesetzt und das muntere Fach innehatte, damals schon viel versprach. Mitell, der vorzügliche Bonvivant; Richard Kahle, Rhetoriker par excellence und Liebling der Studenten, als Intrigant; Herr von Leman, ein besonders feiner Chargenspieler; Engelhardt, ein ebenso ausgezeichneter Komiker; Herzfeld – Held; Frau Herzfeld-Link, jugendliche Heldin; Georg Link, Naturbursche; Emil Claar; Josef Nesper, kleinere Rollen, der aber nichts zu spielen bekam und bald fortging. Clara Ziegler, Heroine, wurde dann durch Frau Straßmann-Damböck ersetzt; Hermine Delia, Salondame; Frau von Moser-Sperner, Sentimentale. Wahrlich ein stolzes Ensemble, das sich nach Laubes Rücktritt an alle ersten Hoftheater zerstreute.
Einer Clavigovorstellung erinnere ich mich ganz besonders, über der Laubes Geist schwebte. Es wurde wunderbar gespielt. So erschütternd wirkte die letzte Szene im dritten Akt, daß viele Ungebildete lachten, dann aber das ganze Publikum in Beifallstürme ausbrach. Eine ähnliche Wirkung erlebte ich später in Paris, in Molières: » l'Avare« im Théâtre français, als Coquelin den Geizigen gab. Während ich tief ergriffen unter dem tragischen Eindruck menschlicher Leidenschaft fast erschauerte, lachten viele andere, bis auch hier der Beifall sich in Stürmen Luft machte. » Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas.«
Laube, der noch eine Menge junger Talente auf Lager hatte, konnte natürlich nicht einem jeden seine Rolle vorkauen, denn manche begriffen nicht, andere wieder waren nachlässig. Er verfiel auf den unglückseligen Gedanken, sich einen Vortragsmeister in Alexander Strakosch zu engagieren, der selbst ungarisch-deutsch sprach, bei dem nun alle lernen sollten, mußten, aber nicht wollten. Ich weiß nicht mehr genau, wieso auch Emil Claar in das Verhältnis Laube-Strakosch trat, doch waren die Folgen für alle drei äußerst verhängnisvolle, von denen ich später berichten werde.
Kaum war ich vierzehn Tage in Leipzig gewesen, als man mich von Berlin aus benachrichtigte, daß Herr von Hülsen selbst nach Leipzig käme, um mich zu sprechen. Um was es sich handelte, konnte ich mir denken, und um voreiligem Gerede vorzubeugen, ersuchte ich ihn, mich ihn im Hotel aufsuchen zu lasten. Aus Briefen an meine Mutter entnehme ich das Weitere.
Leipzig, 13. Juni 1869.
Meine liebe, liebe Mama!
Als ich gestern zu Herrn von Hülsen kam, wurde ich mit den Worten: »ah, wir sind ja alte Bekannte« empfangen. »Nicht wahr, Sie haben mir schon etwas vorgesungen und mir sehr gefallen. Warum haben wir uns denn damals nicht geeinigt?« – »Weil ich nicht wollte.« – »Richtig, Sie wollten nicht.« – »Ist es nicht besser, Herr General-Intendant, daß Sie mich jetzt, wo ich was gelernt habe, selber holen, als wenn ich damals als Anfängerin in Berlin geblieben wäre?« – Er war vollkommen meiner Ansicht, möchte mich nun am liebsten gleich mitnehmen, will, wenn es nötig ist, die Konventionalstrafe bezahlen, will mit Laube offen und ehrlich reden und alles versuchen, mich loszumachen. – – – – – –
Laube ging aber nicht darauf ein. Erst als mir Regisseur Seidl den Rat gab, auf dem Berliner Gastspiel wenigstens zu bestehen und Laube zu bitten, mich das Geld verdienen zu lassen, sagte Laube unter der Bedingung zu, daß von meinem Abgang nie mehr die Rede sein dürfe. Das versprach ich und hielt es auch. Doch halfen mir weitere unvorgesehene Ereignisse mich meines Kontraktes zu entbinden.
Leipzig, 24. Sept. 1869.
Mein liebes, liebes Mamachen!
Meine alltägliche Beschäftigung hat seit zwei Tagen einen Stillstand erfahren, indem ich an einer ziemlich argen Halsentzündung darniederliege, mich aber auf dem Wege der Besserung befinde. Mein Gekritzel sagt Dir, daß ich liegend schreibe. Sonst aber bin ich ganz wohl, bei gutem Appetit und hoffe, die ganze Geschichte bald los zu sein. Gestern mittag schickte ich mein Attest zu Laube, der sich sogleich selbst auf den Weg machte, um es Direktor Behr zu zeigen. Die ganze Familie Behr wohnt in zwei kleinen Stübchen am Rosental, weil sie die große Wohnung erst im Oktober beziehen können, essen aus dem Gasthaus und sitzen sehr ungeniert gemütlich (wie wir manchmal) bei Tische, als
herein mit gemessenem Schritt
Heinrich Laube tritt!
Mein Attest in der Hand hält er es mit weitaufgerissenen Augen Behr mit den Worten: »da haben wir die Pastete, jetzt sind wir erschossen!« entgegen.
Es war so komisch, daß ich trotz meiner Heiserkeit furchtbar habe lachen müssen, als Behr es mir heute erzählte, der sich über die Töne wunderte, die ich dabei zu Gehör brachte. Bald sprach ich im höchsten Diskant, bald im tiefsten Baß. Die ganze Regie hat mich heute schon besucht, es wundert mich nur, daß »Heinrich« (Laube) noch nicht da war.
Ich bezweifle, daß Du mein Geschreibsel lesen kannst, außer Du setzest Dir 99 Vergrößerungsbrillen auf, auch dann lieferst Du noch ein Kunststück. – In diesem Monat habe ich schon 15mal gesungen. Die Gerolstein macht mir jetzt viel Spaß. Frau Krebs-Michalesi und Deine alte Kollegin Günther-Bachmann haben mir große Elogen gesagt, und letztere ist sehr kritisch. Wenn ich im letzten Akte entsetzt sage: »Sie haben eine Frau und vier kleine Kin – – –? her mit dem Federbusch!« bekomme ich jedesmal einen Applaus, und das letztemal habe ich so mitgelacht, daß ich aufhören mußte zu sprechen.
Im ersten Akt macht unser Komiker Engelhardt schon einen Witz, der – wie ich glaube – Berliner Ursprungs ist. Wenn ich ihn als Großherzogin freundlich frage: »Wie heißen Sie?« er verschämt die Frage unbeantwortet läßt, und erst auf meine zweite Frage: »Wie heißen Sie?« mit: »och Lehmann« antwortet, so kannst Du Dir das Gelächter denken. – Übrigens fühle ich mich sehr wohl in meinem Schlafwinkel. Die liebe Sonne scheint den ganzen Tag in mein Bett; meine lieben Berls besuchen mich, und zu meiner Liegerei fehlt mir nichts als unsre graue Mietzekatze. – – –
Laube hat schon seit einiger Zeit Händel mit Kritik, Bürgermeister und Theatervorständen. Laube ist ein schwacher Mensch, denn er läßt sich von dem »Vortragsmeister Strakosch« auf der Nase herumtanzen. Er und Claar rühren für Laube unaufhörlich die Reklametrommel, was Laube doch nicht nötig hat. Es fangen schon an, sich Parteien für und gegen Laube zu bilden, und überall werden Stimmen laut gegen die Unsauberkeit der andern, die Laube wahrscheinlich einmal wird schwer büßen müssen. – –
– – – Ich bin oft bei Laubes; Frau Iduna hat mich fest in ihr Herz geschlossen und busselt mich immer ab, wenn ich komme. Sie ist eine gar liebe gescheite Frau, und ich bin gern in ihrer Gesellschaft. Auch wird es Dich interessieren, zu hören, daß mir der alte, aber immer noch schöne und elegante Emil Devrient sehr den Hof macht. Er sagte mir neulich nach den Hugenotten, er habe noch keine so noble, hoheitsvolle Königin gesehen, und nannte mich »Künstlerin!« Nun, das bin ich noch lange nicht, aber ich strebe darnach, es zu werden. Trotz seiner 70 ist er ein recht koketter und verliebter alter Herr! – – –
Tausend Grüße für Dich, liebes Mamachen und alle unsre Freunde von Deiner
Lilli.
Es war eine recht starke Angina, an der ich litt, also schlimmer, als ich meiner lieben Mutter schrieb. Ich hatte im Rienzi den Friedensboten – eine Lieblingsrolle von mir – zu singen und mit den Friedensboten aus der Versenkung aufzutreten. Als ich den Chor beginne, um mich einzusingen, fühle ich starke Schmerzen und eine plötzliche Heiserkeit. Mit schnellem Entschluß flüstre ich dem nächststehenden Knaben – einer sehr musikalischen kleinen Anfängerin, die schon auf Proben für mich gesungen hatte – zu, sie möge vortreten und singen, und schiebe sie bei dem Vorspiel einfach vor. Kapellmeister Schmidts Gesicht festzuhalten, wäre der Mühe wert gewesen! Als er aber die Situation begriff und die kleine »Mühle« sich ihrer heiklen Aufgabe mit großem Geschick entledigte, klärte es sich dankbar lächelnd wieder auf. Ferdinand Groß, unser ausgezeichneter Rienzi, sang die Riesenrolle während der Messe elfmal in einem Monat.
Nach einem Wohltätigkeitskonzert für arme Studenten brachten mir die Arionen einen Fackelzug; ich war tödlich erschrocken über die auffallende Ovation. Nach einem zweiten derartigen Konzert waren wir: Herm. Delia, Marie Wieck (Schwester Clara Schumanns), ich, 3-4 alte Professoren und Schulräte, ferner ein paar junge Studenten des Komitees zu einem regelrechten Kommers zusammen. Es war wundervoll. Die alten Herren in hellster Extase, die Studenten nicht minder, und wir jungen Künstlerinnen heiter und glücklich. Der jüngste der Studenten brachte mir mit einem Glase Champagner einen Gruß Mozarts. Nach kaum einem Jahre erhielt ich durch die Feldpost anonym eine gepreßte Rose mit folgenden Zeilen: »Des Sommers letzte Rose gepflückt vor der Schlacht bei Sedan für die unvergeßliche Rose Leipzigs.« Der junge Mann war – wie mir Prof. Möbius schrieb – in der Schlacht geblieben; es mögen seine letzten Worte gewesen sein. Rose und Brief habe ich sorgsam verwahrt zu liebem Angedenken.
Meiner Schwester äußerst gesellige Natur hatte sich viele Freunde erworben, die natürlich auch die meinen wurden. Reizende Stunden verlebten wir bei Edelmanns, denen die »Modenzeitung« gehörte, wo wir ganz zur Familie zählten. Ferner Rechtsanwalt Hagemann mit Frau und Schwägerin. In diesem Hause wohnte der Humor; man sah nur fröhliche Gesichter, unaufhörliche, natürlichste Heiterkeit würzte das Zusammensein. Man brauchte die drei Menschen nur anzusehen, so überkam einem schon das Gefühl ihrer Fröhlichkeit. Kaum eingetreten – man mochte noch so griesgrämig sein – stand man mitten drin und lachte sich gesund. Hagemann wurde noch in seinen alten Tagen von Kaiser Wilhelm II. zu Jagden, Skatpartien und Gesellschaften geladen. Er war ein ebenso guter Jäger wie Skatspieler und Gesellschafter und nahm sich auch vor dem Kaiser kein Blatt vor den Mund. Er war einmal zu großer Gesellschaft ins Schloß geladen, ein Glas Rotwein stand unberührt vor ihm beim Souper. Plötzlich steht der Kaiser hinter ihm: »Nun Hagemann, Sie trinken ja nicht?« »Ne Majestät,« erwidert dieser, »der Doktor hat mir kleene Rotweine verboten!« Der Kaiser lachte und befahl sofort »vom Besten«, der von nun an immer vor seinem Gaste stand, und von dem der Kaiser ihm öfter nach Leipzig sandte.
Als ich eines Mittags aus der Probe kommend, Hagemann begegnete und einen Hut aufhatte, der ihm nicht gefiel, zwang er mich, mit ihm in einen sehr teuren Laden zu treten, wo ich mir einen sehr schönen aussuchen mußte; dann mußte ich mit ihm nach Hause zum Essen. Und wie ich Frau Hagemann die Hutgeschichte erzähle, sagte sie lachend: »Na hören Se, Sie sind scheene dumm, ich hätte mir zwei ausgesucht, denn so 'ne Gelegenheit kommt nich gleich wieder.« Bequem in seinem Lehnstuhl zur Siesta eingenickt, schlief Alfons Hagemann, ahnungslos, schmerz- und lautlos ins Jenseits hinüber, gesund, heiter und glücklich wie er gelebt hatte. Seine liebe Frau, die ihn um mehr als 10 Jahre überlebte, stickte in ihrem 81. noch ein Reisekissen für mich, mit dem sie, wie sie mir sagte, sich beeilen müsse, um es noch fertig abliefern zu können.
War es nur unsre Jugend, oder war es wirklich so, man bekam in Leipzig nicht viel Trauriges zu sehen, die Menschen waren meist froh und lebenslustig. Auch bei Prof. Reclam waren wir öfter zu heitern Stunden mit Freunden vereint, und dort passierte uns etwas sehr Komisches. Einmal war außer mir und meiner Schwester nur noch Kapellmeister Mühldorfer anwesend, der am selben Abend nach einem Schauspiel noch eine kleine Oper zu dirigieren hatte und darum eine Stunde früher fortging als wir. Mühldorfer hatte im neuen Theater zu tun, unsre Wohnung lag dicht beim alten Theater, auf ganz entgegengesetzten Seiten. Draußen herrschte furchtbarer Nebel, dessen wir aber erst beim Fortgehen gewahr wurden. Als wir endlich zu Hause angekommen zu sein wähnten, standen wir vor dem neuen Theater, das seine Pforten längst geschlossen hatte; und unter großen Schwierigkeiten erreichten wir mitten in der Nacht unser Quartier. Als ich andern Morgens in der Probe Mühldorfer sprach, sagte er: »Wissen Sie, was mir gestern passiert ist, Frl. Lehmann? Ich bin gerade verkehrt gegangen, bin am alten Theater angekommen, und als ich ans neue kam, war's Theater längst aus. Es hatte jemand anderer für mich dirigiert.« –
Berlin, 12. Okt. 1869.
»Heute hast Du in mir einen rechten Triumph gefeiert, meine liebe, süße Mama! Heute habe ich die Königin in den ›Hugenotten‹ gesungen, ungeheuer gefallen und somit ein Ziel erreicht, das ich noch in weiter Ferne glaubte. Wieviel ich an Dich dachte, kann ich Dir gar nicht sagen; als ich so gefiel, war mein einziger Gedanke: wie wird meine Mama sich freuen! Das alles habe ich Dir zu danken. Jeder hörte, wie gut ich sang, und alle frugen mich: wo ich gelernt hätte? Alle machten mir Komplimente für Dich, als meine einzige Lehrerin. Ich wollte, Du wärest dabei gewesen; doch nein, Du wärest umgekommen vor Angst, und so ists besser, Du warst nicht dabei.« …
Mit unterlegtem Kontrakt, der mich auf drei Jahre an Berlin band, hatte ich also gesungen und sollte am 14. Oktober als zweite Rolle die Rosine im Barbier singen. Die Probe hatte ich mitgemacht, wurde aber am Nachmittag telegraphisch nach Leipzig zurückberufen. Mein Engagement war perfekt, und es handelte sich nur noch um die günstige Gelegenheit, es sobald als möglich anzutreten.
Hatte ich auf der Durchreise nach Danzig eine wenig erfreuliche Vorstellung von der Stummen gehört, so sah ich diesmal bei meinem Gastspiel das Ballet »Fantasca«, das mein Erstaunen herausforderte. Von allen Ballets aber, die ich in Berlin gesehen, blieb mir »Flick und Flock« immer das liebste, das auch, wie ich glaube, der Kaiser am meisten liebte. Anders war's, wenn Adele Grantzow tanzte, dann war alles gleichmäßig gut. Diese große Schauspielerin und Tänzerin konnte man gar nicht genug bewundern; sie war klassisch in Gebärde und Ausdruck trotz der damals modernen kurzen Röckchen und schön, man wurde nicht müde, sie anzusehen. Ähnliches hat mir nur die russische Tänzerin Pawlowna wiedergeben können. Die Künstlerlogen waren schon um 4 Uhr besetzt. Wir hatten uns Handarbeiten mitgenommen und warteten geduldig von 4-7, um einen Vorderplatz als Erstgekommene zu gewinnen. Adele Grantzow war es uns wert; von ihrer Weichheit und Grazie ließ es sich lernen wie von keiner andern. Daß diese große Künstlerin durch Unvorsichtigkeit eines Charlatans, der ihr mit einem schmutzigen Messer bei Behandlung eines Ekzem zu nahe kam, so früh schon sterben mußte, ist wohl das Grausamste, was man sich denken kann. Niemand konnte sie ersetzen. Alle waren sie nur Tänzerinnen, keine auch nur annähernd eine Schauspielerin wie sie. Auch die Pawlowna nicht, obwohl diese wieder Eigenschaften besitzt, die rhythmische Vollendung für mich bedeuten.
Das einzig nennenswerte Opernwerk war Franz v. Holsteins melodienreicher »Heideschacht«, in dem Frau Krebs-Michalesi aus Dresden die Altpartie und ich einen flotten Burschen sang. Die Oper gefiel und wurde oft gegeben, da der feine, bescheidene Musiker viele Freunde besaß.
Toni Berl war nun aus Darmstadt zum Besuch gekommen. Ihr nachgesandt sollte das non plus ultra reinster Rassenschönheit von einem Hunde kommen, das ihr Freunde zum Geschenk ausgesucht hatten. Zu unser aller Entsetzen kam eine Riesenkiste, die auf einen Bernhardiner schließen ließ. Heraus kroch aber ein kleiner weiß und schwarz gefleckter Dorfköter mit reizendem Ringelschwänzchen! Zum Glück für ihn waren wir alle Tiernarren und verwöhnten ihn, was er uns durch Liebe und Anhänglichkeit lohnte. Als Tonis Urlaub zu Ende ging, zerbrachen wir uns den Kopf ihn bequem zurückzuschaffen, da man Hunde im Kupee damals nicht duldete.
Der Schmuggel in einem geeigneten Körbchen gefiel uns am besten. Täglich wurde der Hund, der sich daran gewöhnen sollte, einige Stunden in sein »Reisekörbchen« geschlossen, worin er nicht muckste. Am Tag der Abreise kochte ihm Angeli noch ein feines »Reiseknöchelchen«, das wir ihm mit in sein Körbchen legten. Und nun geleiteten wir alle zusammen die interessanten Reisenden nach dem Bahnhof. Das Körbchen lag bereits oben im Netz, und niemand im vollgepfropften Kupee II. Klasse hatte eine Ahnung vom blinden Passagier. Da kommt der Schaffner: »Bitte die Billets.« »rrrrruu«. – »Was ist das?« – »Ich weiß es nicht, aber es scheint ein Hund zu sein?« – »uff, uff, wau, wau!« – »Da ist ein Hund drin«, schreit der Cerberus, »wem gehört der?« Und nun muß sich unter stetem Gekläff des Lieblings die Besitzerin melden. Der Schaffner nimmt den Hund, für den er nicht nur ein Billet sondern auch den Hundekasten prätendiert, heraus, wir entreißen ihm das Streitobjekt, die Tür wird zugeschlagen, und das Reiseknöchelchen fährt im Reisekörbchen mit Toni ganz allein nach Darmstadt.
Eines Tages begegnete mir Kollege Nesper, der, wie ich wußte, sein Engagement in Halle bereits angetreten hatte. Erstaunt, ihn hier zu sehen, vertraute er mir an, daß er eben durchzugehen im Begriffe sei, weil Halle so gar keine Amüsements böte. Ich wusch meinem lieben Kollegen ganz gehörig den Kopf, veranlaßte ihn, sofort nach Halle zurückzukehren, trotzdem sein Gepäck bereits auf dem Wiener Bahnhof lag, und schwieg gegen jedermann. Wir sollten uns bald Wiedersehen, denn eines Tages fuhr fast unser ganzes Personal nach Halle zu einer Wohltätigkeitsvorstellung, von der ich nur noch soviel in meinem Gedächtnis rettete, daß ich mit Friedr. Mitterwurzer zusammen die Briefszene der Metella aus dem Pariser Leben spielte resp. sang und daß die damals sehr liebe und schöne Hermine Delia mit mir in einer Stube Siesta hielt und wir beide unsere Sonnenschirme im Bette aufgespannt hatten, weil uns die Sonne aufs Gehirn schien. Daß es lustig war, das weiß ich ganz bestimmt.
Riezlchen war anfangs 1870 zu mir nach Leipzig gekommen, nachdem sie tüchtig wieder mit Mama studiert und ihre Stimme in Ordnung gebracht hatte. Aber die Nerven hatten gelitten, was sich, wenn es einen Tag weniger gut ging als den andern, in schrecklichem Kleinmut ausdrückte. Sie wollte wieder auftreten, und wir animierten sie ernstlich dazu. Die Hauptsache war nun, daß wir wieder beisammen, Freud und Leid teilen konnten.
Merkwürdig, daß jetzt fast alle Söhne des Kurfürsten in Leipzig lebten. Mit allen ersten Künstlern befreundet, trafen wir sie oft bei festlichen Gelegenheiten oder waren bei ihnen mit unsern Kollegen eingeladen. Auch darüber schrieb ich an meine Mutter.
Leipzig, 29. März 1870.
Mein liebes, liebes Mamachen!
»… Du wirst Dich freuen zu hören, daß wir gestern ein entzückendes Souper beim Prinzen Heinrich von Hanau mitgemacht haben. Sein Bruder Karl, der ein sehr ruhiger, ernster Mann scheint, hat mir, trotzdem er gar nicht hübsch ist, den besten Eindruck gemacht. Straßmann mit Frau, Riezl und ich und fast alle unsre Kollegen trafen wir dort. Prinz Heinrich war der liebenswürdigste Wirt, den man sich denken kann, und so heiter, wie ich nie geglaubt habe, daß er sein könne. Er scheint ein großer Verschwender. Beim Souper brachte Prinz Friedrich – der nun wieder mit der Schauspielerin, Frl. von Alten, längst verheiratet ist – Dein Wohl aus, liebes Mamachen, was ich Dir mit vielen ehrfurchtsvollen Grüßen bestellen soll. Wir haben uns dann – ich bitte Dich, falle nicht um – bis ¾5 früh unterhalten. – – –«
Vier Wochen später schrieb ich an Mama über ein weniger glücklich verlaufenes Souper:
»… Als wir vorgestern zum Souper bei Prinz Karl von Hanau sind, wo Angeli Berl auch geladen, Riezl aber, die sich nicht wohl fühlte, zu Hause geblieben war, wurde ich herausgebeten und finde Riezl weinend, ich solle gleich nach Hause kommen. Sie erzählt mir schnell, wie Vater Berl ganz heiter von Hause fortgegangen sei, um seine Frau aus dem Theater zu holen, sich plötzlich unwohl gefühlt, in eine Droschke gesetzt und seine Wohnung angegeben habe. Als der Kutscher den Schlag aufmachte, konnte Vater Berl nur noch lallen. Der Kutscher meinte einen Betrunkenen vor sich zu haben, fuhr mit ihm zur Polizei, wo er nach wenigen Minuten starb. Riezl und ich brachten Angeli, die gar nicht an des Vaters Unwohlsein glauben mochte, heim, fanden aber nicht einmal seine Leiche vor, die von der Polizei bereits ins Hospital geschafft worden war. – Wie entsetzlich für die arme Familie, die wir zu trösten auf das beste bemüht sind.« – – –
Waren wir durch Mamas feinen Geschmack und feinste musikalische Bildung in klassischer Musik wie: Händel, Gluck, Mozart, Haydn, Beethoven, Weber, Schumann und Schubert aufgezogen worden, so konnten wir unsern musikalischen Horizont in Leipzig noch bedeutend erweitern, wo soviel gute Musik gemacht wurde. Im alten Gewandhaus besonders war klassische Musik eine Reliquie, einer Hostie vergleichbar, die nur von Geweihten gefaßt, nur von denen genossen wurde, die in dieser höchsten, von Herzen kommenden, zu Herzen sprechenden unmittelbaren Kunst aufgingen. Was ich von dieser Heiligkeit jemals empfing, sprach und sang weiter in meinem Leben, in meiner Kunst. Die dortigen Lehren waren also sehr wichtig für meine Zukunft; jede dieser Lehren ein Gewinn für mein Seelenleben auf dem Wege zu einem bessern Menschen und zur läuternden Beurteilung des natürlichen Gefühls. An den Stätten wo Goethe, Schiller, Sebastian Bach gewandelt waren, fühlte man sich gehoben von Ehrfurcht, erfüllt von tiefer Rührung.
Unsre Theaterverhältnisse hatten sich immer mehr zugespitzt. Unmäßige Artikel gegen Laube machten böses Blut und reizten die Studentenschaft zu Skandalsucht. In den Vorstellungen wurden Rufe laut; man verlangte, daß Strakosch und Claar entlassen würden. Alles wartete auf den Ausbruch der Katastrophe. Dazu schien die im alten Theater angesetzte Vorstellung: »Bürgerlich und Romantisch«, worin auch Claar beschäftigt war, wie geschaffen. Und kaum war Claar aufgetreten als der Ausbruch erfolgte. Es wurde gezischt, gepfiffen, gejohlt. Immer wieder versuchte Claar seine Rolle anzugehen, doch die energischen Rufe: »Claar hinaus, Claar abtreten, entlassen«, ja sogar: »Laube Direktion niederlegen« erschollen so hartnäckig, daß Claar nichts andres übrig blieb, als abzugehen, worauf wieder – diesmal aus Vergnügen – gejohlt und applaudiert wurde. Hermine Delia, Claars Verlobte, fiel auf der Szene in Ohnmacht, der Vorhang mußte fallen. Nach einer Zeit erschien der Regisseur und annoncierte, daß jemand anderer Claars Rolle übernommen habe, worauf sich die Gemüter beruhigten und das Stück zu Ende gespielt wurde. Da weder Claar noch Strakosch entlassen wurden, wiederholten sich auch im neuen Theater derartige Szenen. Laube riß dann aber die Geduld, er kündigte die Direktion für den 1. Juni 1870. Man hoffte bis dahin einen geeigneten Vertreter zu finden, bot Laube die Direktion verschiedentlich wieder an, doch blieb dieser fest in seinem Entschluß und ging – von uns Künstlern und vielen aus dem gebildeten Publikum aufs tiefste betrauert. Welcher Jammer um das von ihm so prächtig zusammengeführte und studierte Ensemble, das auf dem besten Wege war, das erste Schauspiel Deutschlands zu werden!
Vergebens hatte ich den ganzen Winter Mamachen himmelhoch gebeten, alles zu versuchen, ihren Kontrakt sobald als möglich zu lösen. Sie sollte recht schlecht spielen, riet ich ihr, damit man sie gehen ließe. Das täte sie ohnehin schon, schrieb sie mir zurück, denn es würde ihr schon sehr schwer und sie ängstige sich bei jedem großen Solo. Gekündigt hatte sie ja längst. Es half aber alles nichts, der Kelch mußte bis zur Neige geleert werden. Der 1. Mai 1870 erlöste sie endlich von ihren 16 Jahre mit Geduld getragenen Fesseln, und am 12. holte ich mir unser liebes Mamachen, unser ganzes Glück, mitsamt der grauen Mietzekatze, unserm alten Dompfaffen und der goldenen Harfe aus Prag nach Leipzig. Als sie ihre alten Möbel verkaufen wollte, bot man ihr so entsetzlich wenig dafür, daß sie der Trödeljüdin sagte: »dann verschenke ich sie lieber«. »No wissen Se was, schenken Sie se mir!« antwortete ihr dieselbe. Tatsächlich wurden alle an arme Bekannte verschenkt, und selbst das alte Schlafsopha mit dem »Familienloch«, wie ich die Stelle nannte, auf die sich mit Vorliebe alle unsre Bekannten setzten, fand einen dankbaren Abnehmer. Ich entführte Mama im Triumph. Der Abschied von Prag wurde ihr schwer genug; fürchtete sie doch noch immer gar zu sorglos ihre Stellung aufgegeben zu haben. Meine beiden Bleikammern hatte ich mit drei größeren, sehr hübschen, nicht zu heißen und weniger kalten Zimmern nach der Ostseite vertauscht, wo wir alle drei glücklich vereint, einem neuen Leben entgegensahen. Daß Mama viele Tränen nachgeweint wurden, brauche ich nicht zu sagen, denn jeder, der sie kannte, hatte einen Helfer, einen Schutzengel in ihr gefunden, den er bei ihrem Fortgang verlor. Aber auch sie schied mit geteilten Gefühlen von einem Ort, der uns so lange heimatliche Unterkunft gewährte, wo eine für sie so sorgenvolle, für uns so glückliche Zeit dahingegangen war, und wir doch ein ganzes Herz voll Anhänglichkeit zurückließen für alles und alle, die uns lieb gewesen, und denen auch wir nicht gleichgiltig sein konnten.
Nachdem Laube bestimmt erklärt hatte, die Direktion des Leipziger Theaters keinesfalls wieder aufnehmen zu wollen, war ich, gleich allen andern Mitgliedern, meines Kontraktes entbunden. Berlin meldete sich sofort, und ich sagte zu, meinen Kontrakt am 1. August daselbst anzutreten, sobald ich Hülsen nochmals würde gesprochen haben. In meinem Berliner Kontrakt entdeckte ich nämlich folgende Klausel: »Der Kontrakt tritt in Kraft nach Ablauf des Kontraktes mit der Leipziger Theaterdirektion.« Laube war nicht genannt, ich hätte also noch 20 Jahre dort bleiben können. Hülsen sah das auch ein, und da seit dem Berliner Abschluß bereits ein Jahr verstrichen war, erhielt ich sofort die Gage des zweiten Kontraktjahres, während man für das dritte Jahr eine erhöhte einstellte.
Die Jagd nach der Direktion hatte begonnen. Unter den vielen, die sich meldeten, war auch Direktor Emil Fischer aus Danzig, der nach bei mir eingezogenen Erkundigungen eines Tags in Leipzig eintraf und sich im »Hotel de Prusse« einmietete.
Riezlchen, die nach einer sehr schweren Brustfellentzündung mit Mama nach Bad Elster gereist war, hatte uns viel Sorge gemacht. Zu meiner enormen Beschäftigung erhielt ich auch noch Partien zum Vorstudium aus Berlin geschickt, ich konnte mich fast gar nicht um Emil Fischer bekümmern, dem es, wie ich bemerkte, in Leipzig sehr gut gefiel.
Nun brach auch noch der Krieg aus, und alle andern Interessen wichen diesem teils ersehnten, teils gefürchteten Ereignisse.
Wir aber spielten weiter. Friedrich Haase und Ferdinand von Strantz war die Direktion zugefallen, die sie am 1. Juni antraten. Beide Herren beschworen mich unaufhörlich, nicht nach Berlin zu gehen, sondern in Leipzig zu bleiben, wo ich's viel besser haben sollte. Ich dachte nicht daran. Als Abschiedsrolle hatte man mir die Martha ausgesucht. Meine Garderobe fand ich bekränzt, ebenso den Toilettentisch der »Lady Harriet«. Zwölf Chordamen, im Halbkreise gruppiert, hielten große weiße Buketts in Händen, aus denen sich 12 rote Buchstaben abhoben, die zusammen meinen Namenszug ergaben. Jeder auftretende Künstler brachte mir Geschenke, Blumen oder Kränze. Am Schluß der Vorstellung mußte ich noch einige Worte an das Publikum richten, ehe man mich entließ. Nach der Vorstellung versammelten sich auf der Bühne alle meine Kollegen. Direktion und Regie hielten Ansprachen. Alles schien darauf angelegt zu sein, mir den Abschied recht schwer zu machen. Losreißen aber mußte ich mich trotz aller Tränen, Liebe, Anerkennung und Kollegialität. Mein Ziel war höher, der Weg noch weit, ich mußte und durfte keine Zeit verlieren.
Schon hatte ich Zeitverlust genug zu beklagen, durch die große Geselligkeit, in deren Strudel ich gegen meinen Willen, durch die Liebenswürdigkeit unsrer Freunde und meine plötzlich erwachte sorglose Heiterkeit geraten war, ohne mir die geringste Rechenschaft davon zu geben, wie wenig sie mir taugte. Das lange Aufbleiben bei meiner anstrengenden Berufstätigkeit, den anstrengenden Proben, die mir ohnehin jeden Morgen raubten, förderten weder meine Gesundheit noch mein Studium. Ich hätte meine Kräfte besser verwenden oder sparen sollen. Aber ich war lange genug menschenscheu gewesen, und wurde auch bald genug wieder untauglich für jede Art von Gesellschaft, meiner Kunst zuliebe, die mir schließlich alles ersetzte, was ich hier oder dort verloren zu geben gezwungen war. Ich mußte mir also sagen, daß auch diese Zeit notwendig war für das junge Gemüt des Menschen sowohl als der Künstlerin, das doch der Lebensfreude nicht ganz entbehren durfte.
Herr von Strantz, der seine Berliner Wohnung mit Mobiliar gern los sein wollte, offerirte sie mir samt seinem dienstbaren Geist, eine Offerte, die mir sehr gelegen kam und mich vorderhand aller Wohnungssucherei überhob. Die letzten einschneidenden Verhältnisse hatten uns alle sehr angegriffen, ich hatte wirklich eine Erholung nötig. Während ich mit Riezl auf vierzehn Tage nach dem damals noch ganz stillen Reinhardsbrunn in Thüringen ging, blieb Mamachen in Leipzig, um alles für den Umzug nach Berlin zu rüsten. Von Reinhardsbrunn machte ich allein per Wagen einen Ausflug nach der Wartburg und genoß, ganz in mich gekehrt, zum erstenmal den mächtigen Eindruck der Burg, des Tals, des Ortes, der ganzen lieblichen Gegend, die mich Scheffel und Wagner seit lange lieben gelehrt hatten.
Von diesem Ausflug erst wenige Stunden nach Leipzig zurückgekehrt, erhielt ich ein Telegramm folgenden Inhalts: »Wo ist mein Mann? Weib und Kinder verhungern, schaffe mir meinen Mann. Verzweifelt Rosa.« Das Telegramm war drei Tage unterwegs gewesen, von Danzig bis Leipzig. Wir waren sprachlos und zerbrachen uns den Kopf, was wohl geschehen sein konnte? Hatten wir Fischer doch seit Wochen Lebewohl gesagt und ihn zu Hause geglaubt. Er konnte also nur krank oder ihm ein Unglück zugestoßen sein. In Angst und Eile fuhr ich zum Hotel und wurde vom Portier in den Garten gewiesen. Dort saß der, wie ich mir einbildete, schwer kranke, liebe Direktor mit mehreren Herren beim Diner, eine große Bowle vor sich, und die hellen Tränen schöner Lustbarkeit flossen ihm gerade über das lachende Gesicht. Wieder war ich sprachlos; aber nicht lange. Es hatte sich meiner ein furchtbarer Zorn bemächtigt, den seine Heiterkeit und die mir angebotene Erdbeerbowle nicht abschwächen konnten. Ich nahm ihn beiseite, zeigte ihm die Depesche und erhielt die natürlichste Antwort der Welt: daß er nicht bezahlen und darum auch nicht fortkonnte!!! Am Nachmittage machte ich's mit Hilfe eines uns beiden bekannten Mannes möglich, die Schuld zu begleichen, setzte meinen lieben Direktor in den Zug, drückte ihm sein Billet und seinen Gepäckschein in die Hand, schrieb an unsre liebe Rosa alles, was ich wußte, und hörte viele, viele Jahre nichts mehr von der armen »hungernden Frau« und ihrem gar zu sorglosen Gemahl.
Nur wenige Tage später saßen Mamachen und ich mit unserer kleinen Menagerie ebenfalls im Zuge nach Berlin, um Europa erschütternden Ereignissen entgegenzufahren.
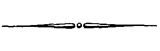

Lilli Lehmann.