
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Auf Sobbowitz wurde Geburtstag gefeiert. Es war der zwanzigste der Gutsherrin Anna von Proen, die vor drei Jahren als kaum Siebzehnjährige von ihrem jetzigen Eheherrn mit einigem Ungestüm in den heiligen Ehestand entführt worden war. Mit dieser Geburtstagsfeier sei zweckmäßigerweise auch gleich die Kindtaufe ihres Zweitgebornen zu verbinden, hatte der praktische Vater gemeint. Denn jetzt in der Ernte, wo alle Hände gebraucht würden und alle Gespanne unausgesetzt auf den Beinen seien, müsse jede unnötige Fuhre vermieden werden. Überdies dürfe man auch den polnischen Gutsnachbarn kein böses Beispiel mit Völlerei und Sauferei geben. Aber Frau Anna hatte dies als dummes Gehabe und auch als unstandesgemäß abgetan. Außerdem wenn man Kinder haben wolle, müsse man auch die Kindtaufen mit in Kauf nehmen, die nun mal dazugehören, und wenn sich der eine Teil die Mühe mache, Kinder zur Welt zu bringen, so schicke es sich, daß der andere Teil sich der weit geringeren Mühe unterziehe, dies vor aller Welt kundzutun und es sich etwas kosten zu lassen. Mit diesem Stich, der den als knauserig bekannten Feldhauptmann an seiner empfindlichsten Stelle traf, hatte sie den Disput entschieden, die Kindtaufe wurde bis nach der Ernte verschoben, und der Geburtstag der Schloßherrin sollte für sich allein gefeiert werden.
Hierzu brauchte man nicht gleich die ganze Gutsnachbarschaft einzuladen, was wiederum für den Hausherrn ein kleines Pflaster war. Jedoch bestand Anna darauf, daß Martin Opitz als langjähriger Freund des Hauses an diesem Tage nicht übergangen werden dürfe, und Proen hielt es für geraten, seiner sehr eigenwilligen Ehehälfte hierin nachzugeben. War doch der Dichter im Laufe der Jahre zu einer Art von Hausfreund in Sobbowitz aufgerückt, dessen Besuche freilich nur selten waren, eben darum aber um so höher im Werte standen. Wie weit lagen doch jene Anfälle von blinder Eifersucht des Feldhauptmanns, wenn Opitz oder Proen auf jene Zeit zurückblickten! Dieser hatte sich längst überzeugt, daß Annas einstiges Interesse für Opitz höchstens dem Dichter, kaum je dem Manne gegolten hatte und im Grunde nicht mehr als noch halbkindische Neugierde gewesen war, in jedem Falle aber, auch wenn es sich anders verhalten hätte, Annas Geschmack sich seitdem völlig gewandelt habe. Der immer gleich kühle und Abstand haltende, ironisch gefärbte Ton, den sie im Gespräch mit dem Poeten anzuschlagen liebte, war für Proen der schlüssigste Beweis, daß er vor diesem nichts mehr zu befürchten habe, und was immer er einst befürchtet haben mochte, alles nur aus törichter Einbildung und Selbstquälerei entstiegen war. Wie es Proen erscheinen wollte, war der Poet für Anna nichts weiter als ein brauchbarer Gesprächskontrahent, mit dem sie ihre beißenden und witzigen Rededuelle ausfechten konnte. So hatte der Dichter sich weniger aus Berechnung als durch angeborne Schmiegsamkeit und Fügsamkeit in weibliche Schwächen und Launen ein bequemes Plätzchen in Sobbowitz erobert.
Es bedeutete deshalb für ihn die verdiente Anerkennung eines nicht grade leicht errungenen Privilegs, daß er in diesem Jahr zum erstenmal auch eine Einladung zur Geburtstagsfeier der »schönen Anna« erhielt, wie einstmals schmeichelhafterweise ihr Spitzname in der Stadt gelautet hatte. Hiervon war freilich nicht mehr viel übrig geblieben. Selbst die nächsten Freunde des Hauses mußten zugeben, daß das einst so amazonenhafte Mädchen, dessen sieghafte Schönheit die ganze Stadt bezaubert hatte, zu einer Art von Landpomeranze geworden war, die in ihrer Art gewiß auch noch ihre Reize hatte, jedoch nichts mehr von jenem märchenhaften Glanz ihrer Mädchenzeit besaß.
Solche Erinnerungsbilder waren es, die dem Dichter durch den Kopf gingen, als er in der von dem Feldhauptmann eigens für ihn geschickten offenen Kalesche die mehrstündige Fahrt nach Schloß Sobbowitz unternahm. Es war ein strahlender wolkenloser Augustsonntag noch in der ersten hochsommerlichen Hälfte des Monats. Ein laues Lüftchen milderte die Hitze des aufsteigenden Vormittags. Es mochte von der hinter seinem Rücken jenseits der Stadt blauenden Meeresflut herüberkommen, dachte Opitz und beschloß, in den Tagen des nahenden Spätsommers wieder öfters kühlungsuchend an den benachbarten Seestrand hinauszureiten, wie er es sich in seiner Danziger Anfangszeit zur Gewohnheit gemacht hatte. Man traf auf den von der heiligen Salzflut bespülten Sanddünen nur selten einen Menschen, und schon dies verlohnte einen kurzen Ritt dorthin aus dem Gewimmel und der dumpfen Enge der Stadt, deren sommerliche Gerüche sich manchmal betäubend auf die Sinne legten.
Der erste Teil der Wagenfahrt auf der gutgehaltenen, wenn auch bisweilen sehr sandigen und staubigen Poststraße, die nach dem Verlassen der Festungswälle am Hange der die Stadt überhöhenden schönbewaldeten Hügelkette entlangführte, hatte dem Auge des Dichters eine beglückende Schau über die zu seiner Linken sich absenkende schier unabsehbare Fläche des zum Danziger Herrschaftsgebiet gehörigen Niederungslandes mit seinen in höchster Erntereife prangenden Korn- und Weizenfeldern dargeboten. »Fürwahr! Eine güldene Au ist dieses Land!« murmelte er mehrmals vor sich hin und sog den würzigen Atem, der ihm von den Niederungsfeldern entgegenwehte, begierig wie den erlesensten Wohlgeruch in sich ein. Ihm war, als müsse er sich damit von etwas ihn Bedrückendem und Beklemmendem, dem er nicht gleich auf den Grund kam, freimachen. Aber gleich darauf, als in einem großen Kirchdorf die Straße nun von der bisherigen Richtung landeinwärts abbog und er im Vorüberfahren zahlreiche Kirchgänger aus der wuchtigen, noch aus der Ordenszeit stammenden Dorfkirche herausströmen sah, fiel ihm sofort wieder ein, was die Ursache dieses ihn bedrückenden Gefühls war.
Er hatte heute morgen, da es ihn vor Antritt seiner Wagenfahrt noch zur sonntägigen Frühandacht getrieben, eine unerwartete und ihn tief erregende Begegnung vor dem Portal von Sankt Marien gehabt. In der ersten Reihe der dort – wie stets – harrenden Bettlerschaft, die den Kirchgängern ihre Hände oder ihre Mützen almosenheischend entgegenstreckten, war ihm eine untersetzte Gestalt aufgefallen, die ihn trotz des abgewandten Gesichtes merkwürdig bekannt anmutete. Ein schreckhafter Gedanke durchzuckte ihn. Wär's möglich? Konnte ein Mensch so weit herunterkommen, so tief sinken? Seine Füße zögerten. Schon hatte er kehrtmachen wollen. Aber es war zu spät. Jene Gestalt hatte ihm ein unverkennbares Gesicht zugewandt und seine Füße trugen ihn weiter, bis dicht vor den Bettler hin. Es war sein Heidelberger Kommilitone Heiterlin, der sich jetzt Serenius nannte und, seitdem er vor Jahren ihm auf dem Bischofsberg in noch leidlicher Verfassung begegnet war, noch einige Male in zunehmender Verkommenheit seinen Weg gekreuzt hatte, ohne daß je wieder ein Wort zwischen ihnen gewechselt worden war. Aber heute hatte die Überraschung ihnen beiden nun doch den Mund geöffnet. »Du bist's, Heiterlin?« hatte Opitz gemurmelt, während er die bereits gelockerte Silbermünze in die geöffnete Hand des Bettlers und Jugendfreundes drückte und die Schnapsstimme des andern die hämischen Worte sprechen hörte: »Der Herr Herzogl. Rat erinnert sich also doch noch des gemeinsamen Rinnsteins am Neckarstrand?« – »Ist das das Ende?« hatte Opitz gemurmelt und die Hand über die Augen gelegt, indes er die Kirchenschwelle überschritt und noch die Antwort des Bettlers auf seine erschütterte Frage vernahm: »Finis coronat opus, carissime.« Unter dem Gewoge der Orgeltöne, die vom Chor des mächtigen Kirchenschiffs herunter über ihm zusammenschlugen, war er in den nächsten Kirchenstuhl gesunken und hatte seiner Erschütterung lange nicht Herr werden können. Finis coronat opus! klang es immer wieder in die Orgeltöne und in die Choräle der Gemeinde hinein. Erst das Ende ist die Krönung des Ganzen, so konnte man es sich frei übersetzen. Welche Selbstverhöhnung des einstigen Studienfreundes und Dichterkollegen, der ein neuer Horaz oder Catull hatte werden wollen!
Der Gottesdienst war zu Ende gegangen, ohne daß Opitz es gewahr wurde. Erst nach geraumer Zeit war er wieder zu sich gekommen und hatte sich fast allein in dem Halbdunkel der gewaltigen gotischen Pfeilerhalle gefunden. Gesenkten Kopfes hatte er eine entlegene Seitenpforte gesucht, um dem Gespenst der Vergangenheit nicht noch einmal in den Weg zu laufen, und hatte sich in den Wagen geworfen, der ihn nach Sobbowitz bringen sollte.
Als er gegen Mittag dort anlangte, fand er zu seiner Verwunderung statt der erwarteten Geburtstagslustigkeit ernste, ja verdüsterte Gesichter. Auch der Gäste waren es nur wenige, außer Opitz selbst Bürgermeister Johann Zierenberg, der Oheim des Geburtstagskindes, mit seiner Schwester Brigitte Schwarzwald, Annas Mutter, und seiner schönen Schwiegertochter Lisbeth, der gebornen Hafferat, die vor einem Jahr in Sankt Marien des Bürgermeisters jüngstem Sohn Gottfried, Constanzias Bruder, angetraut worden war. Das Ehepaar Kerschenstein war, wie sich von selbst verstand, ebenfalls eingeladen gewesen, hatte aber absagen müssen, da den Ratsherrn in dem etwas feuchten Zierenbergschen Garten, wo er seit Mai mit Constanzia seinen Sommersitz genommen, ein heftiger Anfall seines alten Leidens, der Gicht, an den Krankenstuhl gefesselt hielt und Constanzia nicht von seiner Seite weichen wollte. Aber nicht dies war die Ursache der allgemeinen Betroffenheit, der Opitz bei seinem Kommen begegnete. An die Kerschensteinsche Gicht war in diesem Familienkreise jedermann als an eine unvermeidliche und über die Maßen anhängliche Begleiterscheinung des Lebensalltags gewöhnt, so daß auch niemand mehr in Sorge deshalb geriet, außer Constanzia selbst, die es sich nicht nehmen ließ, ihren Eheherrn jeweils wieder gesund zu pflegen.
Woher aber mochten denn nun diese allgemeine Beklommenheit und Kopfhängerei stammen, die keinen Frohsinn aufkommen ließen? so fragte sich der Dichter, bis ihm ein plötzlicher Ausruf der Hausherrin, der lange zurückgehalten ihr offenbar gegen ihren Willen entfuhr, den erschreckenden Aufschluß gab. Was denn das für eine Art von Geburtstagsfeier sei? Mit dieser blödsinnigen Pestilenz unter den Flissacken auf der Weichsel! Als ob es nicht grade genug Flissacken gäbe und Läuse in ihren Pelzen dazu! Damit habe Ohm Zierenberg ihnen allen die Laune verdorben. Annas unbedachter Ausruf schien allen Anwesenden die Zunge gelöst zu haben, als habe jeder nur auf ein solches befreiendes Wort geharrt, um seine Meinung kundzutun. Das allgemeine Stimmengewirr der sich kreuzenden und widersprechenden Meinungen wurde übertönt von der gebietenden Stimme des Alten, der solche Situationen zu meistern gewohnt war. Was denn so einem jungen Keichel einfalle, in die ernsten Angelegenheiten der Erwachsenen hineinzukrähen, knurrte er noch halb humoristisch seine Nichte an. Doch diese, nun einmal im Zuge und kriegerisch gestimmt wie immer, war nicht in der Laune, sich über den Mund fahren zu lassen und protestierte, sie sei zwanzig Jahre, habe zwei Jungen in der Wiege, und sei somit schon eine ganz ausgewachsene Klucke, die im Hühnerstall mitgackern dürfe. Dabei sah sie sich herausfordernd im Kreise um und blieb schließlich mit ihrem Blick auf dem ihr grade gegenübersitzenden Dichter haften. Auch er mache ein Gesicht wie sieben Wochen Regenwetter. Ob er denn gar so große Angst habe, sich von den Flissacken, mit denen er auf seinen vielen polnischen Reisen offenbar dicke Freundschaft geschlossen habe, die Pestilenz zu holen?
»Mein Leben steht in Gottes Hand, edle Frau,« gab der Poet mit ungewohntem Ernst zurück, »und wenn es mir durch seinen Ratschluß bestimmt ist, von einem Flissacken oder einem Bofke, wie man sie hier nennt, oder sonst einem Herumtreiber mir die tödliche Kontagion zu holen, so wird es geschehen, ob ich gleich meiner Lebtag noch keinen Bruderkuß oder Händedruck mit einem Flissacken oder ähnlichen Brüdern getauscht habe.«
»Oho! So feierlich, Herr Herzogl. Rat?« rief Anna und schlug eine helle Lache auf. »Das klingt ja beinah wie Eure eigene Traueranzeige in Hünefelds Zeitungsblatt.«
Frau Brigitte Schwarzwald, Annas Mutter, hatte die Zuspitzung des Gesprächs mit zunehmender Unruhe verfolgt. Jetzt hielt es sie nicht länger. Sie schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und schrie:
»Halte den Mund, du ungezogenes, ungehobeltes Geschöpf! An dir sind auch nicht genug Ruten entzweigegangen!«
Anna nickte mehrmals mit gutgespielter Reue.
»Eure Schuld, Frau Mutter! Nicht die meine! Warum habt Ihr mein Sitzfleisch oder meine vier Buchstaben allzusehr geschont? Es war ja alles da!«
»Jetzt wird es mir aber zu bunt!« rief Frau Brigitte in das etwas betretene Schweigen hinein, das diesen Worten ihrer Tochter folgte. »Ich geh' meiner Wege! Ich kann das unanständige und lästerliche Geplapper nicht länger mitanhören! Wo wir die Strafe des Herrgotts für alle unsere Sündhaftigkeit, die Pestilenz, schon beinah' vor der Haustür haben!«
Damit stand sie auf und wandte sich zur Tür, wurde aber von Proen, der ebenfalls aufgesprungen war, mit einer beschwörenden Handbewegung zurückgehalten.
»Ihr dürft es nicht krummnehmen, Frau Schwiegermutter. Seht Ihr nicht, wie der Übermut ihr aus den Augen blitzt? Sie ist ja auch noch ein halbes Kind.«
»Übermut! Halbes Kind!« wiederholte Frau Brigitte mit neu aufsteigendem Ärger, ließ sich jedoch von ihrem aufs höchste geschätzten Schwiegersohn willig wieder auf ihren Platz führen. »Mit zwanzig Jahren! Halbes Kind! Hat selbst schon zwei Kinder!« murrte sie weiter. »Wenn ich so denk', als ich zwanzig war ...! Der Übermut vergeht einem! Halbes Kind ...!« Sie schüttelte wiederholt den Kopf, blieb aber an des Schwiegersohns Seite gehorsam sitzen.
Anna hatte sich erhoben und trat in soldatischer Haltung vor ihren Mann hin.
»Halten zu Gnaden, Herr Feldhauptmann!« sagte sie salutierend. »Aber das halbe Kind verbittet sich dero Anzüglichkeiten!«
Proen lachte.
»Meldung zur Kenntnis genommen! Soldat abtreten!« kommandierte er. »Heute abend zum Befehlsempfang wieder antreten!«
Anna salutierte von neuem.
»Zu Befehl, Herr Feldobrist in spe!« schmetterte sie und trat mit einer wohlgelungenen soldatischen Kehrtwendung ab und auf ihren Platz zurück.
Alle lachten und auch Opitz lachte mit, ob ihm gleich nicht grade danach zumute war. Nur Frau Brigitte konnte ihres Unmuts noch immer nicht Herr werden und schüttelte mißbilligend abermals den Kopf.
»Ihr habt nicht so ganz unrecht, Herr Schwiegersohn,« sagte sie zu dem neben ihr Sitzenden. »Sie ist wirklich noch ein halbes oder eigentlich ein ganzes Kind. Wann wirst du mal vernünftig werden, Anna?«
»Wenn Weihnachten auf Pfingsten fällt, teuerste Frau Mutter,« gab sie prompt zurück, »und Pfingsten auf Weihnachten.«
»Also wohl niemals?« seufzte Frau Brigitte resigniert.
»Aber sie ist doch köstlich, Frau Tante!« rief die jungverheiratete Lisbeth, geborne Hafferat, über den Tisch herüber. »Wenn man nach drei Jahren Ehestand noch einen so guten Humor und Witz hat! Ich habe meinen Gottfried, Euren Neffen, jetzt ein Jahr und komme mir an seiner Seite schon schrecklich ehrpusselig vor. Ich wünschte, ich könnte noch so lachen wie du, Anna.«
»Alles nur Galgenhumor, Lisbeth!« rief Anna zurück und lachte hell und grell auf.
Durch dieses Wort und dieses Lachen schien der Schleier künstlicher Lustigkeit, der sich über den ganzen Kreis gebreitet hatte, mit einem Schlage zerrissen zu sein.
»Ja, alles hat seine Zeit,« sagte der Bürgermeister und stand auf. »Wer mich kennt, weiß, daß ich meiner Lebtag kein Feind von einem guten Spaß gewesen bin und auch bis dato nicht bin. Aber wo der Ernst anfängt, hört der Spaß auf, und deshalb muß ich es auch dem Herrn Herzogl. Rat kund und zu wissen tun, was ihr andern schon von mir gehört habt, als ich mit der Nachricht ins Haus platzte und dir, Anna, und Euch, mein lieber Feldhauptmann, einen Strich durch Euer schönes Fest und Eure wohlgemeinte Einladung machen mußte.«
»So ist es denn wirklich und wahrhaftig Tatsache, Eure Magnifizenz?« fiel Opitz erregt ein, als Zierenberg einen Augenblick schwieg. »Wir haben die Pestilenz in Eurer wohllöblichen Stadt?«
»Ja, so ist es, Herr Herzogl. Rat!« erklärte Zierenberg mit fester Stimme. »Ihr habt das Wort gesprochen, das von keinem gern gehört wird und dawider doch kein Herumdrücken hilft. Unsere Hoffnung steht bei dem Allmächtigen im Himmel, daß er uns aus dieser Not und Pein nach seinem Dafürhalten heraushelfen und es mit einem kleinen Strafgericht und kleinen Denkzettel für unsere Stadt und uns alle sein Bewenden haben möge. Feldhauptmann, laßt meinen Wagen anspannen! Ich fahre nach der Stadt zurück und wer will, kann mitfahren. Ich habe Platz.«
Durch die engen, in der Augusthitze dampfenden Gassen der alten Reichs- und Hansestadt schreitet Seine großmächtige Majestät der Schwarze Tod.
Wo er mit seinem knöchernen Finger anklopft, da schützen weder Schlösser noch Riegel. Wie von einem Donnerschlage springen die sichersten Türen, die festesten Tore auf. Die Elendshütten der Armut, die Prunkstuben der Patriziergeschlechter öffnen sich seinem Verwesungshauch, der die Menschenkreatur zwischen heute und morgen aufs Sterbelager wirft. Fast unaufhörlich erklingt von allen Türmen der Stadt mahnendes Sterbegeläut und scheucht die zitternde Menschenherde in die weitgeöffneten Gotteshäuser, wo sich die noch verschont Gebliebenen, Männer und Frauen, reich und arm, eine nicht abreißende Kette von Bußfertigen, zum Empfang des Abendmahls drängen, dem letzten vielleicht vor dem nahe drohenden Ende. Handel und Wandel stocken. Alle irdischen Gedanken verkriechen sich vor den Visionen des letzten Gerichts.
Von früh bis spät sind die Pforten der Kirchhöfe aufgetan, um ihren schweigsamen Gästen, die in schwankenden Särgen herannahen, sicheren und dauerhaften Unterschlupf zu gewähren. Aber bald genug übersteigt die Menge der Ankömmlinge die Zahl der vorhandenen Unterkünfte, so daß draußen vor den Toren neue und größere Empfangsräume angelegt werden müssen, die man einst Pestfriedhöfe nennen und mit Grauen in großem Bogen umgehen wird. Nur klein ist jedesmal die Zahl der Leidtragenden und wird von Tag zu Tag kleiner, denn ganze Familien sind zusammengeschmolzen und schmelzen weiter zusammen bis auf ein paar letzte, die auch schon des letzten Rufs der Posaunen gewärtig sind.
Sargtischler haben große Zeit wie die Totengräber auch, zimmern Särge auf Vorrat und arbeiten im Schweiße ihres Angesichts. Pestchirurgen, Pestbarbiere, Pestpriester, Pestträger, Pestweiber, auch Pestmütter genannt, sind gesuchte Leute, denen doch jeder gern aus dem Wege geht, bis es noch an ihn kommt. Sie bilden eine eigene Klasse von Menschen, die teils von Berufs wegen, teils des Geldverdienens und künftiger Versorgung halber, manche auch aus Christenpflicht und frommem Erbarmen oder weil sie in dieser Welt nichts mehr zu verlieren haben, sich der Erkrankten und Sterbenden annehmen und gewiß selbst ihre Rechnung mit dem Himmel und mit dem Tod bereits abgeschlossen haben. Aber auch unter ihnen sind Galgenvögel und Frevler, die einzeln oder bandenweise in die mit den weißen Kreuzen oder weißen Laken gekennzeichneten Pesthäuser eindringen und von Gesunden wie von Kranken Gelder erpressen mit der Drohung, sie in die gefürchteten Lazarette und Quarantänequartiere einzuliefern, falls sie sich nicht loskaufen. Es ist der Auswurf der Menschheit. Die Aasgeier des Schwarzen Todes sind es, die aus der Ernte des großen Sterbens die niedrigste und verwerflichste Art von Erwerb ziehen. Galgen und Rad warten am Ende ihres Wegs auf sie, wenn sie nicht schon vorher, behaftet mit den blauschwarzen Flecken und Beulen, den Wahrzeichen der Pestilenz, ins Grab sinken.
Alle Bande von Sitte, Pietät, Menschlichkeit beginnen sich zu lockern oder vollends zu lösen. Kinder trennen sich von den Eltern, Eltern von ihren Kindern, der Mann von der Frau und die Frau vom Manne, wenn die Kontagion, wie man die Ansteckung nennt, einen der beiden Teile niedergeworfen hat. Vergebens mahnt die Obrigkeit zu Ruhe und Besonnenheit, warnt vor kopfloser Angst, vor blinder Panik, alldieweil sie der gefährlichste Nährboden eben jener zu fürchtenden Kontagion sind und das in der Flucht gesuchte vermeintliche Heil in sein grades Gegenteil verkehren.
Aber alle Belehrungen, alle Aufrufe sind umsonst. Schon beginnt die Flucht aus der Stadt aufs Land und, was noch schlimmer, vom Land in die Stadt. Denn wenn schon die Gassen der Stadt mit allen ihren aus den Häusern hinausbeförderten Resten und Abfällen des täglichen Lebensverlaufs, mit dem ganzen stinkenden Unrat von Menschen und Tieren zumal in Sommerszeit als ein gefährlicher Ansteckungsherd zu erachten sind, dem man durch mehrmals tägliches Ausräuchern mit angezündeten Kaddig-, Eichen- und Eschenzweigen und wohl auch mit anbefohlenem Ausräumen des Unrats beizukommen sucht: um wieviel ansteckender sind die Dörfer mit ihrem niemals gelüfteten und gesäuberten Katen, bewohnt von halbvertiertem polnischem oder kaschubischem Volk, das von Ungeziefer bedeckt zwischen Schweinekofen, Misthaufen und Jauchentümpeln haust und einmal im Jahr, wenn überhaupt, sein Hemd wechselt. Kann es ein reicheres Erntefeld für die Sense des Schwarzen Todes geben, als diese noch im Bannkreis der Stadt gelegenen fremdvölkischen. Dörfer?
Strengste Absperrung steht seit je als oberstes Gebot auf allen Pestreglements von Behörden und Obrigkeiten in Stadt und Land. Denn die Erfahrung früherer Geschlechter, die noch im Bewußtsein der Enkel fortlebt, hat gelehrt, daß die fürchterliche Seuche, wenn sie auch von der vergifteten Luft herkommen mag, sich am leichtesten und schnellsten durch körperliche Berührung, durch Kontagion überträgt, weshalb man sie auch selbst so benennt.
Wider die Kontagion aber hilft nur das eine einzige Mittel, daß man die Stadttore verschließt, auf den Landstraßen und vor den Dörfern die Schlagbäume herunterläßt und jedem Fremden, ob reich, ob arm, wes Standes er auch sei und aus welchem Grund er auch kommen möge, den Zutritt durch aufgestellte Wachen verwehrt und gleicherweise auch in die mit den weißen Kreuzen und weißen Laken gekennzeichneten Häuser keinen hinein- und keinen aus ihnen herausläßt.
Deshalb häufen sich manchmal in diesen von des Allmächtigen Strafgericht am schlimmsten heimgesuchten Stätten die Leichen der der Pestilenz Erlegenen so sehr, daß die noch übrigen Lebenden sich in die letzten freien Ecken drücken müssen, bis die Pestkerls oder Pestträger um Einlaß an die Türen hämmern und in den mitgebrachten Särgen die Leichen ohne viel Umstände zu den Massengräbern hinpraktizieren.
*
Als Martin Opitz am Spätnachmittag jenes hochsommerlichen Augustsonntags an der Seite des Bürgermeisters Zierenberg von Schloß Sobbowitz nach Danzig zurückkehrte, fanden sie das Stadttor bereits geschlossen und mit Wachen besetzt, die die Ankommenden scharf auf verdächtige Anzeichen visierten und erst nach umständlichen Fragen über das Woher und Warum der Fahrt den Weg freigaben.
Zierenberg hatte sich dem Inquisitorium ohne ein Zeichen der Ungeduld und ohne mit der Miene zu zucken unterzogen und nickte beim Weiterfahren befriedigt vor sich hin. So gehöre es sich, erklärte er dem nicht wenig verwunderten Poeten, der die sonst so selbstherrliche Natur des Alten gar nicht wiedererkannte. Denn was hätte wohl, fuhr er fort, das ganze heute von ihm erlassene Reglement für einen Zweck, wenn es nicht auch auf ihn selbst Anwendung fände, und wenn etwa Rang und Stand darüber zu entscheiden hätten, wer als gesund zu befinden sei und wer nicht, als ob ein Bürgermeister oder ein Herzogl. Rat vom Herrgott in persona einen Freibrief gegen die Pestilenz in der Tasche trügen und gegen alle Kontagion gefeit seien. Vor bald vierzig Jahren, zur Zeit des letzten großen Sterbens hier in Danzig, A. D. 1602, habe so mancher von den Ratsherren und von den regierenden Familien Freund Hein, der mit seiner Sense herumgezogen sei, den Zoll der Sterblichkeit bezahlt und nicht anders werde es auch diesmal zugehen. Da hülfen weder Amt und Würden noch Titel und Ordenszeichen. Man müsse vor seinem himmlischen Richter stehen, der diese Strafe ob unserer Sündhaftigkeit eigens heruntergesandt habe, und jeder tue gut daran, seine irdische Rechnung abzuschließen und sich in Bereitschaft zu halten.
Es waren die letzten Worte, mit denen der Bürgermeister sich von Opitz verabschiedete und ihn vor seinem Hause absetzte. Sie klangen noch in seinem Ohr nach, als er schon in seiner Stube stand und sich, abgespannt wie er war, auf einen Stuhl fallen ließ. Ihn fröstelte plötzlich, obwohl es heiß und drückend in der Stube war. Er wollte die Fenster öffnen. Aber da fiel ihm ein, daß ja die Luft da draußen vergiftet sein sollte und man besser daran täte, sie nicht erst hereinzulassen. Im Vorbeifahren waren ihm auch die da und dort in den Gassen qualmenden Holzstöße von Wacholder- und Eichenzweigen aufgefallen. Es sollten luftreinigende Schutzmittel gegen die Seuche sein, hatte ihm Zierenberg weitläufig auseinandergesetzt.
Nein! Es konnte kein Zweifel mehr sein. In der Stadt war die Pest.
Opitz hatte in angebornem Leichtsinn, der ihm vor den Nachtseiten des Daseins die Augen verschloß, zuerst durchaus nicht daran glauben wollen und sich an die Hoffnung geklammert, es handle sich um nichts weiter als ein wildes Gerücht, wie ihrer so viele in aufgeregten Zeiten, gleich dieser heutigen, als plötzlich einfallende Nebelschwaden durch das Land zogen, die Geister der Menschen verwirrten und mit einemmal sich in nichts auflösten. So werde es auch diesmal wieder sein.
Aber dieses Argument hatte vor den sehr bestimmten Angaben des Bürgermeisters, daß die Seuche von Polen her mit den die Weichsel herunterkommenden Holztraften eingeschleppt sei, nicht standhalten können. Die Zahl der erkrankten polnischen Flößer oder Flissacken, die man an Land gebracht und in eigenen Baracken draußen am Strom abgesperrt hatte, sprach zu vernehmlich dagegen. Wie von hier aus die Kontagion den Weg in die Stadt habe nehmen können, sei freilich ein Rätsel. Aber daß bereits eine nicht geringe Anzahl von Pestfällen, die mit Tode geendet hätten, zu verzeichnen sei, diese Tatsache sei nicht aus der Welt zu schaffen, so hatte der Bürgermeister geschlossen.
Opitz fröstelte es unwillkürlich von neuem. Er fühlte sich plötzlich schwach und elend. Sollte dies der Schluß werden?
Er erinnerte sich, daß er auf seiner lebenslangen Wanderschaft durch Europiens Lande so manchesmal sich die Frage gestellt hatte, von welcher Art wohl das einstige Ende der langen Mühsal sein werde und an welchem Punkt des ortis terrarum auf den Wandermüden die letzte Heim- und Ruhestätte harre. Sollte er sie so bald schon gefunden haben und der Herr über Leben und Tod, das flammende Schwert in den Händen, habe sein Donnerwort »Bis hierher und nicht weiter!« über ihn gesprochen? Er drückte den schmerzenden Kopf in die Hände und starrte vor sich hin. Es war, als sei der Faden seiner Gedankenspule plötzlich abgewickelt oder mit einem Ruck zerrissen, und es gebe kein Denken mehr. Aber war nicht auch dies schon Denken?
Er sprang auf und machte ein paar Schritte durch die schon dunkelnde Stube. Licht! Licht! rief eine innere Stimme ihm zu. Er trat an seinen Arbeitstisch und entzündete die Öllampe. In der Tat! Die Stimme hatte recht gehabt. Die Helligkeit, so schwach sie auch war, tat ihm wohl. Er konnte wieder freier atmen. Die Beklemmung, die er eben auf der Brust gespürt hatte, war wie ein Gespenst vor dem Licht gewichen.
Sein Blick fiel auf die Arbeit, die er heute morgen auf dem Tisch zurückgelassen hatte. Es war ein Werk der Gelehrsamkeit. DACIA ANTIQUA stand von seiner Hand in feierlichen Majuskeln auf dem Umschlag des kompendiösen Faszikels geschrieben. Er hatte sich in den letzten Monaten mit dem ganzen Feuereifer, den neue Pläne immer in ihm entbrennen ließen, an dieses seinen rastlosen Geist fesselnde Thema gemacht, für das er aus dem Erfahrungsschatz seiner siebenbürgischen Jahre so manche den schwierigen Stoff belebende Einzelheiten schöpfen und allerlei Lichter aufsetzen kennte. Aber von den zahlreichen altrömischen Inschriften und den Funden frühgermanischen und frühsarmatischen Volkstums in dieser von Trajan eroberten römischen Provinz war ihm der Gegenstand ins Ungemessene geschwollen, sodaß sein nun einmal auf das Maßhalten bedachter Geist wie in plötzlichem Schreck davon abgelassen hatte und die Arbeit nun als ein unbewältigter Torso vor des Dichters Augen auf dem Tische lag. Sollte er noch immer mehr Inskriptionen römischer Imperatoren aufeinanderhäufen? Wem war damit gedient? Der lange ersehnte Lehrstuhl an einer der Hohen Schulen des Reichs, etwa an der Wiener oder Prager Alma Mater, der dem Verfasser der Schrift von der »Deutschen Poeterey« seiner Meinung nach schon vor zwanzig Jahren gebührt hätte, würde ja doch niemals kommen, würde wohl immer nur ein trügerischer Wahn bleiben. In jähem Überdruß griff er nach dem verwünschten Faszikel, an den er so viele kostbare Lebensstunden verschwendet hatte, und schleuderte ihn in weitem Schwung an die Wand, wo er in ein offenstehendes Schubfach mit alten Papieren fiel. Mochte er da einer seligen Urständ entgegenschlummern!
Und doch war es schade darum! sagte er sich im gleichen Augenblick. Wie manche von seinen Danziger Freunden und Verehrern hatten das im Werden begriffene gelehrte Opus der Dacia Antiqua bereits in Händen gehabt und waren des Staunens, waren der Bewunderung voll gewesen über die in dem Opus aufgehäufte Gelehrsamkeit aller Gebiete der Historie, der Archäologie, der Paläographie und Diplomatik. Man hatte ihn einen Polyhistor genannt, wie es keinen zweiten in deutschem Landen mehr gebe, und ihn den größten Geistern der Humanistengilde, einem Konrad Celtes, einem Erasmus, einem Baco beigesellt, die alle längst im Elysium weilten und nun in ihm den einzigen würdigen Nachfolger gefunden hätten. Und er selbst? Hatte er diesen Schmeicheltönen jener Lobredner nicht willig genug sein Ohr geliehen? Waren sie nicht Musik für ihn gewesen? Hatte nicht auch der oder jener seiner hohen Gönner
*
Hier nahm der Tod dem Dichter die Feder aus der Hand. Max Halbe starb am 30. November 1944 kurz vor der Vollendung des Schlußkapitels seines Romanes »Die Friedensinsel«. Die letzten Zeilen des Manuskriptes nebenstehend im Faksimile.
*
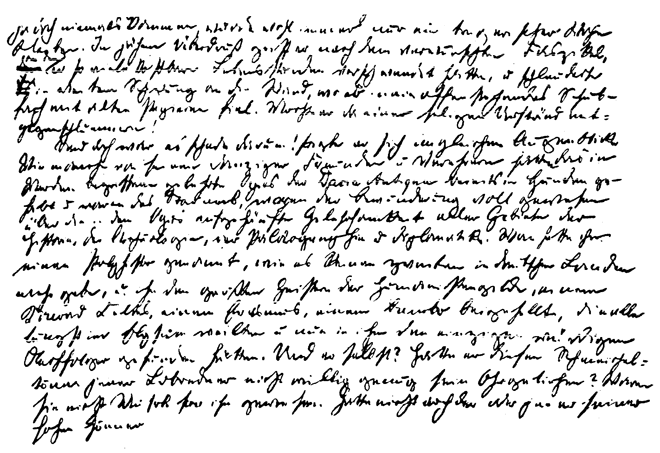
Martin Opitz starb an der Pest am 20. August 1639 zu Danzig, gepflegt von Marie Dorothee, der aus dem Hause gelaufenen Frau des Predigers Nigrinus.