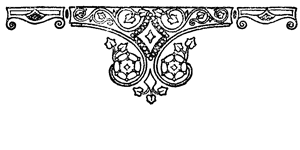|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
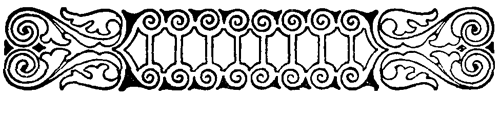
Den Abend brachte Schleinitz-Müller im Arbeitszimmer des Schloßherrn zu. Das war eines der Turmgelasse und befand sich über dem Gemach, das Eck seinem Gast eingeräumt hatte.
Dieser zeigte so großes Interesse an dem alten Bau, daß es wiederum Eck Freude machte, ihn darin umherzuführen.
Die Ecks hatten auch ihre Begräbnisstätte in ihrem Stammhause. Die Kapelle, die sich im Erdgeschoß befand, zeigte Eck seinem Gast zuerst, und da war eine Bemerkung gefallen, die Eck wie für sich selbst gemacht, die aber seinen Gast verstohlen hatte aufschauen lassen. Es gab da verschiedene Totenschilde und Gruftsteine, und in einer Nische stand ein wunderschön gearbeiteter Sarkophag aus weißem Marmor. Er stellte ein antikes Ruhelager vor, und in Lebensgröße lag die Gestalt einer schlummernden, zarten Frau darauf. Ein süßer Duft, der von dorther kam, hatte Ecks Gast zuerst die Blicke nach dieser Richtung wenden lassen. Auf der Brust der Schlummernden lagen weiße Rosen.
»Das ist ja herrlich!« sagte Schleinitz, sich dem Grabmal zuwendend. »Wer hat hier solche Ideen?«
»Das Grabmal wurde nach Vaters Angaben so gestaltet,« erklärte Eck. »Er hat seine Frau abgöttisch geliebt.«
Warum sagte der junge Mann nicht »meine Mutter«?
»Ich meinte die Blumen.«
»Die Blumen lege natürlich ich hierher – übrigens erst seit ein paar Tagen,« setzte Herr v. Eck sonderbar lächelnd hinzu. »Hätte ich dieses Grabmal immer so behandelt und – freilich anderes hätte ich wieder nicht tun dürfen – ich wäre heute ein glücklicher Mensch.«
Das hatte Eck wie nur zu sich selbst gesagt, dann war er einem Träumer gleich aus der Kapelle gegangen.
Und jetzt, eine Stunde später, saß er in seinem eleganten, traulichen Arbeitszimmer als liebenswürdiger Hausherr seinem Gaste gegenüber und erzählte diesem äußerst angeregt ein Jagdabenteuer, das er in der Herzegowina gehabt.
Dieser hörte ihm nicht minder angeregt zu und dachte dabei: »In einem so lieben Raum kann doch nur ein lieber Mensch wohnen. Wenn ich nicht genau wüßte, daß mein Hirn gesund ist, müßte ich beinahe annehmen, daß eine wüste Täuschung mich umfängt.«
Zur größeren Bequemlichkeit seines Gastes hatte der fürsorgliche Eck in dem Zimmer, in welchem sie sich befanden, decken lassen. Gegen sieben Uhr kam Lisi mit dem Tischzeug herein.
»Legen Sie drei Gedecke auf,« sagte Eck über seine Achsel weg zu dem Mädchen.
Lisi antwortete darauf nicht.
»Haben Sie gehört?« fragte ihr Herr scharf.
»Ja, gnädiger Herr. Und ich soll fragen, ob auch Rotwein zu Tisch kommt oder nur weißer.«
»Mailberger und Refosco.«
Sehr schroff klang das. Ecks Gast sah, wie der braven Lisi die Tränen in die Augen schössen, und dann, wie froh sie plötzlich wieder lächelte.
Ihr Herr hatte nämlich, vermutlich um seine Schroffheit wieder gutzumachen, sie in geradezu lieber Weise um Wasser gebeten.
Wie da das Mädchen flog, und wie ihre Hand zitterte, als sie ihm das Glas, das auf einem silbernen Tellerchen stand, hinhielt!
Er nahm einen Schluck, schaute zu ihr auf und sagte: »Heute früh war ich ja ganz überflüssigerweise heftig. Falls Sie nicht sogleich einen anderen Dienst finden – na, kurzum, ich habe Ihre Kündigung nicht ernst genommen.«
Lisi wurde blaß und rot, öffnete den Mund, schloß ihn wieder und sagte endlich stockend: »Ach – ich gehe doch lieber, gnädiger Herr. Es – es ist besser so.«
Eck redete nichts mehr zu dem Mädchen. Er zuckte nur die Achsein und wandte sich wieder seinem Gaste zu. »Nun, da haben Sie es,« sagte Eck, als sie wieder draußen war. »So sind diese Frauenzimmer! Empfindlich über die Maßen, und die Nase tragen sie höher als unsereiner.«
»Ich finde auch –«
»Nicht wahr?« unterbrach ihn der junge Mann lebhaft.
»Daß es besser ist, wenn das Mädchen geht.«
»Ah so? – Und warum finden Sie das?«
»Haben Sie denn nicht bemerkt, daß das arme Ding in Sie verliebt ist?«
»Nein, das habe ich noch nicht bemerkt. Ich habe überhaupt das Mädchen wenig beachtet. Nicht einmal früher, als ich meine Braut noch nicht kannte. – Also das ist's? Na, da werde ich sie nicht aufhalten.«
»Sie sind ja förmlich entrüstet. Lisi ist doch ein schmuckes Mädchen –«
»Ach, Herr v. Schleinitz, mit der Verliebtheit bin ich fertig, seit ich liebe. Nur ist es merkwürdig –«
»Was denn?«
»Daß ich seit einiger Zeit so trüb gestimmt bin,« sagte Eck nachdenklich.
Müller horchte auf. Das ging ja vortrefflich. Jetzt würde er bald hören, was er hören wollte.
In diesem Augenblick aber wurde der gemeldet, für den das dritte Gedeck aufgelegt worden war. Es war Ecks Förster, ein schon recht alter, gemütlicher Weidmann.
Das Gespräch drehte sich nun meist um Jagd- und Forstangelegenheiten. Es wurde auch erwähnt, daß die neuangelegte Rodelbahn in einem sehr guten Zustande sei, wovon der Förster sich an diesem Nachmittag erst überzeugt hatte.
»Wann werden denn die Herrschaften kommen?« erkundigte er sich.
»Am elften Dezember, also am Dienstag.«
»Und heute ist der achte. Da werde ich also am Montag den Weg zur Rodelbahn kehren lassen müssen?«
»Das hat bis Dienstag vormittag Zeit. Meine Braut schrieb mir, daß Doktor Malten am Morgen noch nicht abkommen könne. Die Gesellschaft wird also erst um ein Uhr dreißig in Bruck anlangen.«
»Also am Dienstag!«
»Die zwei Schlitten und der Break werden ausreichen.«
»So viele kommen? Und der Herr Doktor Malten auch? Das ist ein gar lieber Herr! Der kuriert nicht nur die Kranken, der unterstützt sie auch. Das weiß ich durch unseren Heger. Der hat einmal im Grazer Spital gelegen, zu der Zeit, als Doktor Malten noch Assistenzarzt dort war.«
»Ja, er ist ein guter Mensch,« bestätigte Eck nachdenklich und setzte nach einer Weile hinzu: »Und ein Mann von feinstem Ehrbegriff.«
»Die Frau Gräfin wird auch kommen?«
Eck lachte. »Natürlich!« sagte er heiter. »Die jungen Damen können doch ohne Gardedame nicht zu einem Junggesellen kommen! Übrigens – Sie schwärmen ja für die Gräfin.«
»Tu' ich auch! Die Gräfin ist ein Engel!« »Sie haben ganz recht,« meinte Eck weich.
Der Förster war mit seinen Gedanken schon wieder anderswo. Er sagte: »Aber das Reisig schicke ich schon Montag.«
»Gewiß! Wir haben ja schon angefangen, den Eingang vom Schloß zu schmücken.«
»Die Lisi ist doch ein spaßiges Mädel!«
»Wie kommen Sie denn wieder auf die Lisi?«
»Wie ich vorhin gekommen bin, haben der Kutscher und der Stallbursche gerade das ›Willkommen‹ probiert. Es nimmt sich wirklich hübsch aus. Die Buchstaben aus Schneerosen leuchten ordentlich heraus aus dem dunklen Tannengrün.«
»Ist das nicht ein bißchen zu früh fertig geworden?« fragte Eck. »Werden die Schneerosen nicht welk sein bis Dienstag?«
»O nein, gnädiger Herr, die halten acht Tage aus.«
»Also was ist's mit der Lisi?«
»Na also – die zwei stellen das Riesenschild auf, und die Lisi schaut ihnen zu, da sagt der Kutscher: ›Das gilt doch eigentlich nur unserer künftigen gnädigen Frau.‹ Da fängt das Mädel plötzlich zu heulen an und läuft davon.«
Schleinitz lächelte, Eck sah recht ärgerlich aus.
Der Förster fing glücklicherweise jetzt vom Armenhaus zu reden an, und obwohl Eck abwinkte, kam es doch zutage, daß er für die Ortsarmen eine namhafte Summe gespendet hatte.
»Ich weiß ja, daß der gnädige Herr es nicht gern hat, wenn man von seinem guten Herzen redet,« wendete sich der Förster zu Schleinitz, »und eigentlich brauchte man darüber auch kein Wort zu verlieren. Wenn einer nur acht Tage bei uns in St. Florian ist, weiß er schon, daß jeder unseren gnädigen Herrn gern hat.«
»Jetzt hören Sie aber einmal auf!« mahnte Eck verdrossen.
»Die Kinder laufen ihm auf Schritt und Tritt nach,« redete der Alte weiter. »Ich hab' aber auch mein Leben lang noch keinen anderen jüngeren Mann gekannt, der ein solches Herz für arme Kinder gehabt hätte, wie's unser gnädiger Herr hat.«
»Also gut! Ich hab' halt einmal Interesse für arme, elternlose Kinder. Da kann man nichts machen. Jetzt aber hab' ich auch Hunger und – da kommt ja das Essen. Herr v. Schleinitz, soll ich Ihnen beim Aufstehen helfen?«
»Ich danke. Es geht schon wieder ganz gut. Ich fühle fast keine Schmerzen mehr.«
»Das freut mich. – Ah – Sie, meine Liebe, sind selbst zu uns heraufgestiegen? Warum trägt denn nicht die Lisi auf?«
»Sie ist ja ganz verheult, das dumme Ding,« erklärte die Wirtschafterin. »Ich weiß gar nicht, was sie hat.«
Man aß und rauchte dann und plauderte, und es wurde ein recht gemütlicher Abend.
Es war schon zehn Uhr vorüber, als der Förster ging, und dann auch die beiden Herren einander gute Nacht sagten.
Der Gast des Hauses schlief nicht übermäßig gut. Zu viele Gedanken sind der Nachtruhe nicht förderlich.
Am anderen Morgen beim Frühstück erklärte er, daß er sich wohl genug fühle, um den beabsichtigten Besuch in Laibach machen zu können.
»Wie lange werden Sie dort bleiben?« erkundigte sich Eck.
»Gar nicht lang – und wenn Sie es mir gestatten, hole ich meinen Rucksack und meine Schier auf der Rückfahrt hier ab.«
»Ich hätte Sie so gern Dienstag hier gehabt. Da wird es doch ein bißchen festlich in meiner alten Klause aussehen.«
»Nun, das könnte ich schon einrichten.«
»Das wäre nett! Also – abgemacht! Dienstag sind Sie wieder hier, und dann kann ich hoffentlich noch für eine Weile auf Sie rechnen.«
»Das wird sich finden.«
Eck reichte seinem Gaste die Hand und wunderte sich, daß dieser gar so zögernd die seinige hineinlegte. –
Kurz nach ein Uhr mittags verläßt ein südwärts fahrender Schnellzug die Station Bruck. Mit diesem Zug fuhr Schleinitz-Müller ab. Sein Ziel war übrigens nicht Laibach, sondern Triest.
Auch Eck war vor ein paar Tagen in Triest gewesen, und Lisi hatte dann auf seinem Schreibtisch die Karte eines Goldschmiedes gesehen, dessen Rufname Umberto war. Und an Alfons v. Ecks Uhrkette hing wieder ein Kleeblatt, genau solch ein Kleeblatt, wie Müller eines in seiner Brieftasche bei sich trug.
Es lag also klar auf der Hand, daß der unselige Mann in Triest gewesen war, um dort, wo er vielleicht das ihm abhanden gekommene Anhängsel gekauft hatte, sich genau wieder ein solches zu verschaffen oder sich eines nach genauen Angaben anfertigen zu lassen.
Müller wurde also in Triest kaum etwas Neues erfahren, jedenfalls nichts, das an der schauerlichen Tatsache, daß er die alte Frau Schubert getötet hatte, etwas ändern konnte. Er fuhr auch gar nicht dahin in der Erwartung, etwas Wichtiges zu erfahren, sondern nur, um den schrecklichen Augenblick der Verhaftung noch eine Weile hinauszuschieben.
Er kam erst spät abends in Triest an. Natürlich waren alle Geschäfte geschlossen. Er suchte also sofort das Hotel Balkan auf, in welchem er in Triest stets zu wohnen pflegte.
Der nächste Tag war ein abscheulicher Tag. Die Stadt lag wie ausgestorben. Eine wütende Bora, vom Karst herkommend, peitschte dickes Gewölk vor sich her, das bald eisige Regenschauer, bald schweren, klumpigen Schnee über die Stadt schüttete.
Wer nicht hinaus mußte, der blieb heute sicher daheim.
Das war Müller eben recht, denn so konnte er hoffen, den gesuchten Goldschmied sicher aufzufinden.
Während er den sonst etwa viertelstündigen Weg zum Café Specchi machte, den zurückzulegen er heute eine dreimal so lange Zeit brauchte, hatte er Gelegenheit, die Gewalt der Bora gründlich kennen zu lernen. So oft er an eine auf das Meer zuführende Straße kam, bedurfte er seiner ganzen Kraft, um nicht umgeworfen zu werden. Er fühlte sich wie gerettet, als er endlich, durchfroren und ermüdet von diesem langen Kampf mit dem Orkan, in einem behaglichen Winkel des beliebten Lokales saß.
Und da erwartete ihn eine Überraschung.
Das Wiener Tagblatt, das ein Aufwärter, den Deutschen in ihm erkennend, sogleich vor ihn hinlegte, brachte eine den Fall Schubert betreffende Notiz.
Es war da zu lesen, daß der Nichte der Ermordeten am 4. Dezember abends von unbekannter Hand sechstausend Kronen in Banknoten zugeschickt worden seien. Das Geld war in Steinbrück aufgegeben worden, und es sei nicht ein einziges Begleitwort beigegeben gewesen. Fräulein Lindner habe dies der Behörde gemeldet und das Geld sowohl als auch den Umschlag der Sendung daselbst deponiert. Die Adresse war mit Maschinenschrift geschrieben.
Natürlich zweifelte Müller keinen Augenblick daran, daß Eck auf diese Weise den unfreiwilligen Raub gutgemacht hatte. Er frühstückte rasch, dann ließ er sich das Adreßbuch geben. Er fand in jenem Teil des Buches, in welchem die Gewerbe zusammengestellt sind, sehr bald zwei Männer unter den Goldschmieden heraus, deren Rufname Umberto war. Der eine von ihnen wohnte in der Via della Cattedrale, der andere so ziemlich am östlichsten Ende der Stadt.
Müller notierte sich beide Adressen und stürzte sich abermals in den Kampf mit der Bora.
Zuerst begab er sich in die Via della Cattedrale. Da hörte er, daß Umberto Vanin, der Goldschmied, den er suchte, nicht daheim sei. Der Arme lag wegen eines Beinbruches seit drei Wochen im Krankenhaus. Seine Wohnung war eine so bescheidene, daß nicht anzunehmen war, ihr Inhaber habe viele Goldwaren auf Lager. Müller erkundigte sich dennoch danach, ob Herr Vanin nicht Gehilfen besitze, die in seiner Abwesenheit Aufträge entgegennähmen. Doch es wurde ihm gesagt, daß Vanin allein sein Geschäft versehe.
Müller ging also wieder. Vergeblich schaute er nach einem Mietwagen aus. Die wenigen Leute, denen er begegnete, drückten sich gleich ihm an die Häuser und mußten immer wieder nach einem Halt suchen, um nicht umgerissen zu werden.
Schlimmer wurde es noch, als Müller auf die Riva dei Pescatori hinaus mußte. Seraja, der zweite der Triester Goldschmiede, welche den Rufnamen Umberto führten, wohnte in einem der letzten Häuser dieser Straße, die am Hafen liegt.
Da waren, wie stets bei Borastürmen, Ketten gespannt, an denen sich die Leute forthalfen. Auch Müller mußte dieses Hilfsmittel gebrauchen, um zu Serajas Haus gelangen zu können.
Und wieder hatte er kein Glück. Seraja war verreist. Seine Heimkunft wurde indessen für heute abend erwartet.
Müller verbrachte einen recht wenig angenehmen Tag und war froh, als es endlich dunkel wurde. Zu der ihm bezeichneten Stunde fand er sich pünktlich bei dem Goldschmied ein.
Seraja war soeben heimgekommen. Müller wies ihm das in der Hand der Schubert gefundene Vierblatt vor.
»O, ist es gebrochen? So schnell? Wie hat das nur sein können?« fragte der lebhafte Italiener. Er bediente sich seiner Muttersprache, denn Müller hatte ihn italienisch angesprochen.
Der Mann nahm das Vierblatt in die Hand, und kaum hatte er es besichtigt, da rief er schon: »Das ist ja gar nicht das Stück, das ich letzthin so eilig herstellen mußte. Es hat ja einen glatten Stiel.«
»Wann haben Sie kürzlich ein ähnliches herstellen müssen?« leitete der alte Detektiv seine Nachforschungen ein.
»Am 2. Dezember abends ist ein Herr zu mir gekommen, um nach solch einem Vierblatt zu fragen. Ich habe den Herrn sogleich wiedererkannt.«
»Wissen Sie seinen Namen?«
»Nein.«
»Woher wissen Sie, daß gerade dieses Kleeblatt bei Ihnen gekauft wurde?« fragte Müller.
Seraja holte eine Lupe und legte sie und das Kleeblatt vor seinen Besucher hin. »Sehen Sie genau hin. Ihre Augen sind vielleicht nicht so scharf wie die meinen, Sie werden aber doch mein Zeichen auf dem Rest des Stieles finden. Ein winziges S ist's, ich bringe es unauffällig an jedem Stück an, das aus meinem Atelier hervorgeht.«
Der Mann war überaus lebhaft, aber die letzten Worte hatte er sehr langsam gesprochen, und er sah seinen Besucher plötzlich recht mißtrauisch an.
»Wer sind Sie eigentlich?« fragte er dann.
Müller zeigte ihm seine Legitimation. »Sie sehen, daß ich nachzuforschen berechtigt bin.«
»Was hat aber dieses Kleeblatt –«
»Beide Kleeblätter!«
»Also was haben beide Kleeblätter mit Ihren Fragen zu tun?«
»Lesen Sie Wiener Zeitungen?«
»Nein.«
»Haben die Triester Blätter nichts von der Ermordung einer Frau gebracht, bei der ein Vierblatt gefunden wurde?«
»Ich habe nichts gelesen.«
»Dieses Vierblatt wurde gefunden.«
»Himmel – und ich bin also in diesen Fall verwickelt?«
Müller lächelte über des nervösen Mannes Aufregung. »Sie brauchen nichts zu fürchten. Mit der Beantwortung einiger Fragen ist die Sache für Sie abgetan.«
»Na, dann fragen Sie.«
»Also am 2. Dezember, spät abends, kam ein Ihnen schon bekannter Herr hierher?«
»Bekannt war mir der Herr, weil er – im letzten Sommer war es – dieses Kleeblatt hier bei mir gekauft hat.«
»Und Sie haben ihn wiedererkannt?«
»Er ist ein auffallend schöner Mensch. Er kam heute vor acht Tagen und verlangte wieder solch ein Kleeblatt. Ich konnte mich noch gut entsinnen, was ich ihm verkauft hatte, auch hatte er mir den Preis genannt – zweihundertfünfzig Kronen. Es ist nicht teuer. Der Diamant ist ungewöhnlich feurig. Er sagte, daß er sein Vierblatt verloren habe und ein genau solches wieder haben wolle. Ich hätte es ihm gleich sagen können, daß ich genau dasselbe Muster derzeit nicht auf Lager habe, aber ich sagte nichts, ich wollte doch ein Geschäft machen und nahm an, daß der Herr auch ein anderes kaufen werde. Allein er ließ sich auf nichts ein.«
»War er aufgeregt?«
»Als er kam, war er's nicht. Aber er ärgerte sich offenbar, als er sah, daß ich seinen Wunsch nicht ganz befriedigen konnte. Ich fragte, ob ich nicht zu anderen Juwelieren schicken solle, vielleicht könne ich ihm ein genau solches Kleeblatt verschaffen, aber das wollte er nicht. Ich selbst mußte eines anfertigen. Dienstag abend konnte ich es ihm abliefern.«
»Hat er es sich selbst geholt?«
»Ja.«
»War er inzwischen wiederholt bei Ihnen?«
»Nein.«
»Also hat er keine große Ungeduld verraten?«
»Nein. Als ich ihn bei der Übergabe des Vierblattes wiedersah, merkte ich ihm keine Ungeduld an. – Jetzt wundere ich mich darüber,« fügte Seraja hinzu, »denn er hat natürlich wieder genau solch ein Kleeblatt haben müssen, damit man auf das Fehlen des anderen nicht aufmerksam werde.«
»Sehr richtig!« sagte Müller, erhob sich, dankte dem Goldschmied für die gegebene Auskunft und ging.
Der Sturm hatte sich inzwischen etwas gelegt. Man konnte ohne Gefahr seines Weges gehen.
Bis nach Servola ging er in der Dunkelheit spazieren und kehrte erst um, als seine Uhr ihm sagte, daß es bald Zeit zur Abreise sei. Um halb zwölf Uhr ging ein Personenzug nach Norden ab.
Mit diesem fuhr Müller.
Personenzüge waren sonst nicht sein Fall. Diesmal hatte er jedoch einen Grund, gerade diesen Personenzug zu benützen, denn mit demselben Zug würde morgen auch die Rodelgesellschaft in Bruck ankommen.
Müller wußte also, daß er von Graz aus mit den Herrschaften fahren werde.
Simonettas Photographie, die auf Ecks Schreibtisch stand, hatte Müller sich gut angesehen. Er würde die junge Dame also sofort erkennen.
Noch mehr interessierte ihn eigentlich ihre Tante, die ja auch bei der Gesellschaft sein würde, die Dame, an welche die Schubert am jüngst vergangenen 19. Oktober geschrieben hatte: »Es drängt mich, bevor es zu spät dazu ist, noch einmal von der peinlichen Sache –«. Das hatte ja Müller bewogen, nach Graz fahren und sich der Gräfin Vivaldi nähern zu wollen. Sein Kollege hatte ihm aber telegraphiert, daß man so schnell nicht zu ihr gelangen könne, und hatte in seinem gleichzeitig mit dem Telegramm abgesandten Brief berichtet, daß es überhaupt ziemlich schwierig sei, einen Weg in dieses hochvornehme Haus zu finden.
Daraufhin war Müller zuerst nach Pachern gegangen.
Die vielen Briefe, welche von dort aus an die Schubert abgesandt worden waren, deuteten ja auf ein Geheimnis hin, das den verstorbenen Herrn dieses Gutes mit seiner einstigen Dienerin verband.
Und von einer »peinlichen Sache« schrieb die Schubert an die Gräfin: bevor es »zu spät« zu irgend etwas sei. – Wozu zu spät? – Vielleicht um die Baronesse freizumachen von einer Verbindung, die sie später bereuen mußte? Warum hatte die Schubert sterben müssen? Hatte sie damals wirklich der Gräfin geschrieben? Und was? Und wen hatte sie damit geschädigt? Den vielleicht, der ihr das Leben genommen? Warum war der zu ihr gekommen? Wohl kaum mit der Absicht zu morden, denn er hatte ja keine Waffe bei sich. Hätte er sonst das Tischmesser benützt? Und um sich zu bereichern, war der Betreffende auch nicht zu der alten Frau gekommen. Die silbernen Bestecke hatte er ja nur zum Schein mitgenommen. Und ihre Wertpapiere? Waren die nicht etwa bei den Briefen, deren Umschläge in Friebels Händen sich befanden? In solcher Verfassung sortiert man nicht lange. Das Geld war ja nun auch bereits in anderer Form wieder zurückgekommen. Es handelte sich also hier nicht um einen Raubmord, auch nicht um einen Diebstahl aus Habsucht! – Könnte die Gräfin Vivaldi vielleicht aussagen, was eigentlich das Band zwischen Hans v. Eck und der Schubert war? Hätte sie sagen können, wie die Schubert und Alfons v. Eck zueinander standen?
Müller hatte also allen Grund, sehr begierig zu sein, die Gräfin kennen zu lernen. Deshalb fuhr er mit diesem Personenzug, und deshalb fuhr er diesmal sogar erster Klasse.