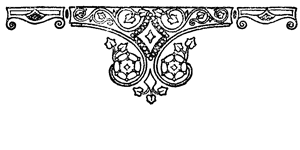|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
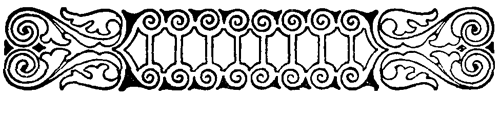
Das Gut Pachern, schon seit Hunderten von Jahren der Familie v. Eck gehörig, liegt nördlich von Graz, noch eine gute Gehstunde über Bruck hinaus, in einem windgeschützten, überaus freundlichen Tale. Einst hatten noch ein Eisenhammer und ein Sensenwerk, eine Mühle und ein Kalkofen dazu gehört, denn die Ecks des achtzehnten Jahrhunderts zählten zu dem steirischen Eisenadel; ihre Nachkommen hatten sich jedoch immer mehr nach Graz und nach Wien gezogen gefühlt, waren Offiziere geworden oder saßen auf bevorzugten Stellen in den kaiserlichen Kanzleien. Sie sahen ihr Stammhaus nur, wenn ihre Frauen dort die schöne Jahreszeit verlebten, oder sie selbst zu den herbstlichen Jagden dahin kamen.
Die Eck v. Pachern waren niemals eine vielköpfige Familie gewesen, und in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts war das alte Geschlecht nahe daran gewesen, gänzlich auszusterben, denn damals lebte nur noch ein einziges Ehepaar dieses Namens, Hans Eck v. Pachern und seine Gemahlin Bianka, die, einer venezianischen Adelsfamilie entsprossen, von Eck als Gemahlin erwählt worden war, während er in dem damals österreichischen Venedig als Hauptmann in Garnison gelegen hatte.
Das Heiratsgut der schönen Venezianerin und der Rest des großen Vermögens, das einst die Eck besessen, genügten, daß Hans v. Eck mit seiner zarten Frau ein beschauliches Landleben führen konnte. Er hatte sich pensionieren lassen und sich nach Pachern zurückgezogen.
Dort war es sehr still und ruhig geworden, denn die industriellen Unternehmungen, die einst dazu gehörten, hatten schon sein Großvater und sein Vater abgestoßen. Hans v. Pachern hatte indessen immer noch genug zu tun mit der Bewirtschaftung seines umfangreichen Grundbesitzes und der Instandhaltung seiner Forsten. Das Ehepaar lebte in dem behaglichen, schloßartigen Hause, in dessen schöner Umgebung Frau Bianka bald das Heimweh nach ihrer Vaterstadt überwand.
Nur die stille Sehnsucht, ein Kind zu haben, Mutter eines Sohnes, der das alte Geschlecht erhalten konnte, zu werden, vermochte sie nicht niederzuzwingen.
Doch die Jahre vergingen, und das Paar war bereits vierzehn Jahre verheiratet, als endlich das Ereignis eintrat, nach welchem es sich so sehr gesehnt hatte. Frau Bianka durfte Mutterfreuden erwarten.
Groß war das Glück, doch auch manche heimliche Sorge war damit verknüpft, namentlich für den künftigen Vater. Hans v. Eck liebte seine schöne Gattin sehr, und sein Glück war deshalb immer ein zitterndes gewesen, denn Bianka war so außerordentlich zart, daß die geringste Störung, die in ihr Leben kam, jedesmal auch eine Störung ihrer Gesundheit bedeutete.
Doktor Reisner aus Bruck war zum fast täglichen Besucher in Pachern geworden. Er war schon alt und bequem, kam aber doch sehr gern nach dem Schlosse, dessen Besitzer seine Freunde geworden waren. War er doch nicht oft in seinem Leben so herzenswarmen Menschen begegnet.
Und weil er sie so liebgewonnen, erschrak er, als er erfuhr, daß Frau v. Eck Mutter werden sollte. Bianka war sehr zart, war schon fünfunddreißig Jahre alt – wie würde sie das kommende Ereignis überstehen?
Die Befürchtungen erwiesen sich denn auch nicht als grundlos. Sie gebar ein totes Kind, und sie selbst war so entkräftet, daß sie nicht einmal mehr um ihr Leben rang.
Einmal nur, etwa eine Stunde, nachdem das Kind zur Welt gekommen war, hatte sie gemurmelt: »Wo – wo ist es?«
Da hatte ihr der alte Doktor gesagt, daß das Kindlein soeben gebadet werde.
Die Kranke hatte ihn mit Augen angesehen, aus denen ebenso sehr Angst wie Zweifel schauten, dann war sie wieder in Bewußtlosigkeit versunken.
Die beiden Herren hatten eine kurze Unterredung, dann wurde eiligst der Wagen des Doktors wieder bespannt, und er und eine junge Dienerin, Therese Pichler hieß sie, fuhren nach Bruck und von da mit der Eisenbahn weiter nach Graz.
Inzwischen versah die Krankenschwester allein das Amt bei der fast bewußtlosen Kranken. Diese hatte seither nicht mehr danach verlangt, ihr Kind zu sehen, und wenn ihr Mann an ihrem Lager kniete und ihre feuchte Hand küßte oder die Stirn darauf und den Mund auf die Federdecke preßte, um nicht laut aufschreien zu müssen vor übergroßem Leid, da konnte sie eben noch die bleichen Lippen zu einem liebevollen Lächeln verziehen.
Gegen Abend schickte Herr v. Eck seinen Kammerdiener mit dem großen, bequemen Landauer nach Bruck, sah dem Abfahren des Wagens zu und wich von dieser Zeit an nicht mehr vom Fenster seines Arbeitszimmers. Etwa dreißig Minuten brauchte der Wagen zur Bahn, und fast genau nach einer Stunde kam er wieder zurück. Es war längst finster geworden. Man schrieb ja den 21. Dezember. Weil aber Schnee lag, konnten Ecks scharfe Augen das dunkle Gefährt doch schon von weitem erkennen.
Und seltsam – der Anblick des herankommenden Wagens warf den starken Mann nieder. Laut aufstöhnend fiel er auf die Kniee und preßte die Stirn an die kühle Fläche der Fensterverkleidung. »So – so also schaut mein Vaterglück aus!« murmelte er vor sich hin.
Eine Stunde später saß er am Lager seiner Gattin. Sie lag ganz teilnahmlos da.
Er ergriff ihre Hand, sah ihr in die müden Augen und fragte zärtlich: »Willst du denn unseren Sohn nicht sehen?«
Da tat sie die Augen weit, ganz weit auf, und über ihr bleiches Gesicht flog ein rosiger Schimmer. »Unser Sohn – unser Sohn!« flüsterte sie, und ihr liebes Gesicht verklärte sich, und Tränen des Glückes liefen über ihre Wangen, und sie erhob die Arme, die bislang wie gelähmt gewesen, und bat: »O Hans, gib mir meinen Sohn!«
Da legten sie ihr ein ganz ungewöhnlich kräftig schreiendes, in Spitzen gehülltes Kind in die Arme.
Jetzt erst genoß die bleiche Frau ihr volles Mutterglück, und als Reisner sagte: »Gnädigste haben ihm fast Ihre ganze Kraft mitgegeben. Jetzt heißt es für Sie dazuschauen, sie wiederzugewinnen,« da lächelte Frau v. Eck stolz und selig.
Sechs Tage später drückte ihr ihr Mann die Augen zu. Die fromme Täuschung, die er dem Arzt in Vorschlag gebracht, war gelungen. Er hatte die letzten Tage seines heißgeliebten Weibes zu seligen gemacht.
Nachdem er Bianka begraben, fuhr er mit Doktor Reisner nach Graz zum Bezirksgericht. Etwa vierzehn Tage später hatte Hans v. Eck das Kind, welches das letzte Glück seines Weibes gewesen war, in aller Form adoptiert, und es wurde auf den Namen Alfons Joseph v. Eck getauft. Alfonso hatte der Vater Biankas geheißen, und des Kindes wirkliche Mutter, eine ungewöhnlich schöne und auch brave und tüchtige Frau, hieß Josepha Meyer. Daher die beiden Rufnamen, die man dem Kinde gab.
Er wuchs unter der treuen Therese Pflege und Aufsicht zu einem schönen, kräftigen Buben von großer Intelligenz, aber allerdings auch recht wildem Temperament heran.
Als Therese Pichler, die bei einem Besuch ihrer Verwandten in Wien ihren späteren Mann kennen lernte, heiratete, war Alfons bereits zehn Jahre alt und soeben aus der Führung seines Hauslehrers in die eines Militärinstituts übergegangen.
Therese Schubert, wie die einstige Dienerin auf Schloß Pachern als Frau hieß, hatte ein gutes Andenken bei ihrem Herrn hinterlassen. Er interessierte sich noch weiter für diese treffliche Dienerin, welche die schwersten Zeiten in seinem Hause miterlebt und sich stets als tüchtig und treu erwiesen hatte. Gern empfahl er sie daher, nachdem sie Witwe geworden war, einem ehemaligen Waffengefährten, dem General Labriola di Malfettani, der, wiewohl er ein Triestiner war und eine Italienerin zur Frau hatte, sich in der gemütlichen Pensionistenstadt Graz dauernd niedergelassen hatte. Bei diesem war sie mehrere Jahre geblieben, bis sie sich nach Ruhe sehnte, nach Wien zog und dort ihre Nichte Anna zu sich nahm.
Nur einmal noch wurde sie in ihrer Ruhe gestört. Herr v. Eck war schwer erkrankt, und er wollte seine alte Therese in seinen letzten Tagen um sich haben. Natürlich folgte sie sofort seinem Ruf. Es waren wirklich seine letzten Tage. Etwa zwei Wochen war sie auf Pachern, da starb Herr v. Eck.
Sein Sohn Alfons und sie waren die einzigen ihm wirklich Nahestehenden, die seinem Sarge folgten. Alfons stand damals im dreißigsten Lebensjahr. Auch er war Offizier, trat aber auf Wunsch seines sterbenden Vaters nach dessen Tode aus und bewirtschaftete sein Erbe. Er verkehrte mit nur wenigen Menschen. Seine Nachbarn aus den Gewerken, die einst Ecksches Eigentum gewesen, sagten ihm nicht zu, und so beschränkte er sich auf etliche Grazer Familien, mit denen er schon von früher her bekannt war.
Zu diesen gehörte auch General Labriola, der ein ziemlich geselliges Haus führte. Labriola, schon seit langem Witwer, hatte seine Schwägerin bei sich, sein einziges Kind, die Baronesse Simonetta, befand sich in einem Schweizer Pensionat. Trotzdem der General ein strenger und etwas steifer Herr, seine Schwägerin Gräfin Vivaldi eine stille, kränkelnde Dame war, hatten sie immer viel Besuch in ihrer herrlich gelegenen Villa Romana, denn die Gräfin verstand es, trotz ihrer Kränklichkeit eine gewisse frohe Stimmung um sich zu verbreiten, und Labriola ließ im Salon von seiner allzu großen militärischen Strammheit nichts merken, da war er nichts als der liebenswürdige Hausherr, der es an nichts fehlen ließ, um sein Heim seinen Gästen angenehm zu machen.
Schon Hans v. Eck hatte sich im Hause des einstigen Kameraden recht wohl befunden, wiewohl er niemals zu diesen Intimen gehört hatte, Alfons aber konnte sich bald zu diesen rechnen. Er wurde Labriolas Partner beim Schachspiel und fehlte fast bei keinem der Empfänge, die monatlich in der Villa Romana stattfanden.
Es war kein Wunder, daß Alfons auch bald der erklärte Liebling der Gräfin geworden war, der er stets die zartesten Aufmerksamkeiten erwies. Überdies war er ein blendend schöner Mensch mit bezaubernden Umgangsformen.
Simonetta kam als siebzehnjähriges Mädchen wieder in ihr Vaterhaus. Natürlich war dies für Alfons kein Grund, diesem jetzt fernzubleiben. Er kam sogar noch öfter als sonst, und die jungen Leute kannten sich kaum vier Wochen, da waren sie schon Brautleute.
Selbstverständlich war von nun an die reizende Braut der Mittelpunkt des Hauses, aber sie machte sich diesen Umstand niemals in unfeiner Weise zunutze. Sie hatte ja ein gutes Herz.
Nicht einmal der Hausarzt, Doktor Malten, mit dem sie in ewiger Fehde lebte, zweifelte daran. Nur wenn sie in dem ihr anerzogenen Hochmut über die bürgerlichen Frauen scharf urteilte, wies er sie kühl zurück. Überhaupt gebrauchte er ihr gegenüber oft die Redensart: »Davon verstehen Sie nichts,« und der Titel »Baronesse« den er dieser keineswegs verbindlichen Redewendung folgen ließ, klang mehr ironisch als achtungsvoll.
Ernstlich böse aber wurde er nur einmal auf Simonetta, als sie, umgeben von einem Kreis ähnlich gesinnter aristokratischer Freundinnen, über die Reizlosigkeit der arbeitenden Frauen gespöttelt hatte.
Da war er scharf aufgefahren, und diesmal gebrauchte er jene ungalante Redewendung im Plural. »Darüber sollten die Damen überhaupt nicht reden,« sagte er kalt, »denn von diesem Kapitel des menschlichen Lebens verstehen Sie alle miteinander nichts.«
Man schwieg empört, beschämt oder erheitert, je nachdem man Malten unterschätzte, hochachtete oder für ein Original hielt.
Simonetta schwieg aus Empörung.
»Ich muß mich nämlich der arbeitenden Frauen annehmen,« setzte Malten seinen ersten Worten hinzu, »und ich tue es aus warmem Herzen, denn eine von diesen Frauen ist meine Mutter, die vornehmst empfindende Frau, die ich kenne. Sie war vor ihrer Verehelichung eine Maschinennäherin.«
Die jungen Damen, von denen einigen Malten, der schon sehr gesuchte Arzt, nicht uninteressant vorkam, suchten ihm durch Liebenswürdigkeiten zu beweisen, daß sie ihn begreifen konnten, und Dora v. Criric, die Tochter eines pensionierten Obersten, die auch für originell galt, sagte in ihrer flotten Art: »Recht hat er, der Doktor. Davon verstehen wir nichts. Wir verstehen überhaupt nichts, als uns zu unterhalten und uns zu pflegen, und trotzdem sind wir gerade auch keine Schönheitsgalerie.«
Simonetta aber war böse über ihn, und der Doktor erst recht über sie.
Nach und nach lernten sie einander freilich besser kennen, und wenn sie sich auch stritten, so tat nur die Baronesse es zuweilen ernstlich ärgerlich, er nur noch mit Humor, denn er hatte Blicke in ihre Seele getan und wußte nun schon, daß diese im Grunde gut und edel war.
Seit sie sich mit Eck verlobt hatte, war er zuweilen recht nachdenklich geworden.
Gräfin Vivaldi merkte das, und Malten tat ihr leid. Sie war seither nur noch gütiger gegen ihn.