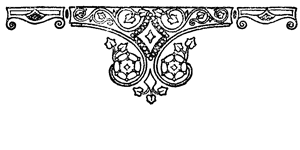|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
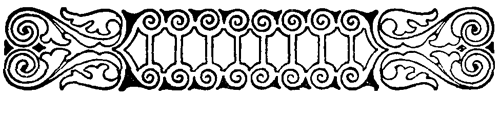
Der alte Detektiv hatte, nachdem er den Sekretär für den roten Merkur interessiert, ein Gasthaus betreten, um ein zweites Frühstück zu nehmen. Er nahm sogar ein sehr ausgiebiges ein, denn er war schon jetzt davon überzeugt, daß er heute zu seinem Mittagsmahl nicht kommen werde.
Während des Essens war er sehr nachdenklich. Aber es war jetzt nicht mehr der rote Merkur, der sein Denken in Anspruch nahm. Vor einer Stunde war er mit sich selbst im Kampfe gewesen, ob er sich diese große Seltenheit nicht selbst kaufen solle, denn die Mittel dazu hätte er ja gehabt, und außerdem war er, der ganz allein in der Welt stand, niemandem Rechenschaft über die Verwendung seines Geldes schuldig.
Da begegnete er einem Krüppel. Es war eine wahre Jammergestalt, und es war nicht daran zu zweifeln, daß des armen Menschen Tasche ebenso leer war wie sein Magen. Der lenkte den braven Müller von seinen Gedanken ab. Er griff in seine Börse, ging dem Mann, der schon an ihm vorbeigehumpelt war, nach und steckte ihm verstohlen zwei Kronen in die Hand.
Der arme Mensch war zuerst ganz verblüfft und wollte sich dann sehr erfreut bedanken, aber Müller raunte ihm eindringlich zu: »Machen S', daß Sie weiterkommen! Sehen S' denn nicht, daß dort ein Wachmann steht?«
Der Mann schaute sich verstohlen um und humpelte dann gehorsam weiter, froh, daß der Wachmann ihm den Rücken zuwandte, den Vorgang nicht gesehen und ihn also nicht aufschreiben konnte.
Müllers Kampf um den Merkur war endgültig ausgekämpft. Es gab ja so viele arme Leute!
Er verweilte etwa eine Stunde in dem Lokal, dann ging er nach dem fünften Bezirk, nach dem Haus, in dem die Schubert gewohnt hatte.
Den Schlüssel zu ihrer Wohnung hatte er, seit er den Fall übernommen, immer bei sich.
Er war jetzt so allein, wie man allein sein muß, wenn man über etwas Bestimmtes so recht ungestört nachdenken will.
Als er gekommen war, hatten ein paar Kinder im Hofe gespielt. Jetzt war auch das Geräusch, das diese gemacht, verstummt. Da kam Müller das Verlangen, noch einmal den Garten zu durchsuchen. Die Leute im Hause waren jetzt sicherlich beim Essen, da blieb er also auch draußen im Garten ungestört. Und heute schien die Sonne, war es überall so hell, vielleicht entdeckte er etwas, das ihm letzthin bei dem mit Schneegewölk bedeckten Himmel entgangen war.
Müller verschloß also die Wohnung und begab sich in den Garten.
Gegen den Hof hin war dieser mit einem einfachen Eisengitter abgeschlossen. Zu dessen Tür führten zwei Stufen hinaus. Sie waren noch mit dem Schnee bedeckt, der letzthin gefallen war, und es war niemand seither in dem Garten gewesen. Die Schneeschicht vor und hinter seiner Tür war ganz glatt.
Müller betrat den kleinen Garten, der an zwei Seiten von einer mäßig hohen Planke und in seinem westlichen Winkel von fenster- und türlosen, stockhohen Mauern abgeschlossen war.
Es befand sich in ihm eine jener kleinen, halboffenen Holzhütten, die man mit dem merkwürdigen Namen »Lusthaus« belegt hat.
Das Lusthaus dieses bescheidenen Gartens hatte einerseits einen Teil der erwähnten Mauer, anderseits einen Teil der Holzplanke zum Hintergrunde. Es standen etliche Stühle und ein Tisch darin. Von einer schon recht alten Waldrebe war es dicht umrankt. Im Sommer mußte es in dem Häuschen ganz dunkel und kühl sein.
Nun, kühl war es heute auch darin, aber dunkel nicht, denn die Sonne schien hell und fand leicht ihren Weg durch das dürr gewordene Laub.
Müller setzte sich und überschaute den Garten. Er hatte ein Knie über das andere geschlagen und die verschränkten Hände darum geschlungen. Das war die Stellung, die er gern einnahm, wenn er sich ungeniert fühlte und längere Zeit auszuruhen gedachte.
Aber diesmal sollte er nicht lange in dieser seiner Lieblingsstellung bleiben.
Am Garten gewahrte er nichts, das seine Aufmerksamkeit erregte. Was da draußen vor ihm lag, war alles mit Schnee bedeckt. Gerade nur in dem Winkel, in welchem das Häuschen stand, hatte die Sonne gestern und heute den Schnee zum Schmelzen gebracht, da lag das blendende Licht hell auf dem Kies des Gartengrundes. Müller sah eine Stecknadel aufblitzen, die noch nicht ganz verrostet war, und sah die Schatten vom Winde bewegter Ranken in einer gewissen Regelmäßigkeit über diesen hellen Boden wandern, und dazu hörte er das leise Rauschen der Klematisranken, die sich an der Planke rieben.
Da gewahrten seine guterzogenen Augen etwas, das in seinem guterzogenen Hirn bestimmte Gedanken erregte. Sie gewahrten ganz deutlich den Schatten einer alten, schon bleistiftdicken, abgerissenen Ranke, die irgendwo eingeklemmt sein mußte, denn sie hatte nicht viel Bewegungsfreiheit. Wie ein dünner Finger bewegte sie sich hin und her, der lockt und winkt.
Müllers Augen suchten die Ranke, welche diesen Schatten warf, und als er sie gefunden hatte, bog er sie zu sich herunter.
»Ah!« sagte er und ließ sie wieder emporschnellen.
Was Müller zu seinem Ausruf bewog, war die Wahrnehmung, daß die Ranke an ihrer Bruchstelle ganz frisch aussah. Er stellte einen der Stühle knapp an die Planke und schaute hinüber, und dann rief er noch einmal: »Ah!«
Angestrengt sah er auf das Bündel ganz ineinander verflochtener Klematisranken, welches jenseits der Planke niederhing und dessen Enden auf einem großen Kohlenhaufen lagen, deren es da drüben eine Menge gab.
Müller hatte einen Bauplatz vor sich, den ein Holzhändler zur Unterbringung seiner Vorräte gemietet hatte.
Da gab es hochaufgeschichtete Partien von Brennholz und ganz ansehnliche Berge von Koks und verschiedener Arten von Kohlen. Jener Kohlenhügel, auf welchen die Enden der Klematisranken gefallen waren, unterschied sich in etwas von den anderen, regelmäßig geformten. Seine ehemals auch regelmäßige Form zeigte ganz besonders auf ihrem einst scharfen Grat eine etwa meterbreite Einsenkung, die sich auf der Außenseite des Hügels bis zu seinem Grunde hinabzog.
»Da also, mit Hilfe der zähen Ranken, ist er hinübergesprungen,« dachte Müller – und sprang auch hinüber. Auch er hatte in etliche der noch reichlich vorhandenen Ranken gegriffen und war so ganz leicht hinübergekommen, und zwar ganz genau an derselben Stelle, an welcher die ehemalige Form des Kohlen-Hügels schon von einem daraus Gesprungenen zerstört worden war.
Wieder gab ein Teil der Kohle nach und glitt mit Müller bis auf den Grund hinab.
Müller war nicht zu Fall gekommen. Er schaute sich jetzt genauer um und überlegte. »Warum ist der Mann nicht durch das Haustor entwichen? Hat er zu wenig Geduld gehabt, um dessen Freiwerden abzuwarten? Oder hat ihn das Grauen vor seiner Tat am Warten gehindert? Jenseits dieses Platzes gibt es nur wieder Bauplätze, da war ein Entkommen wohl sicherer. Aber da mußte er zweimal eine Planke passieren. Und dieser Platz ist gut verwahrt. Da ist an den drei äußeren Seiten die Planke mit dreifachem Stacheldraht unübersteigbar gemacht. Und der Stacheldraht ist nirgends entfernt. Wie hat der Kerl da hinüberkommen können? War vielleicht damals das Tor offen? Gegen halb sieben ist die Tat geschehen. Da hat man vielleicht noch hier gearbeitet. Aber da war ja wieder die Gefahr des Erwischtwerdens. Halt – was ist das?«
Müller unterbrach seine Erwägungen. Dicht am Kohlenhaufen, den er heruntergerutscht war, befand sich auch eine Art Hütte, ein kaum zwei Meter breiter und nicht viel höherer Holzverschlag, auf dem ein schon windschief gewordenes Dach saß. Das Holz dieses Verschlages war schon fast schwarz und da und dort mit schmutziggrünem Moos und gelblichen Flechten bedeckt.
Aber nicht auf diesen malerischen Ansiedelungen hafteten Müllers Augen jetzt wie gebannt. Nicht ihretwegen tat er die paar Schritte auf das Häuschen zu.
Eine Schnur hatte es ihm angetan, eine aus weißem und rosa Garn gedrehte Schnur, die da lustig im Winde baumelte und deren aufgelöste Enden wieder für sich ihr Spiel trieben. Daß diese Enden sich nicht noch weiter auflösen konnten, dafür war durch einen dicken Knoten gesorgt worden, der in die Schnur geknüpft worden war und der jetzt wie toll im Winde hin und her hüpfte.
Müller griff nach der Tür der Hütte. Sie war unverschlossen. Die Hütte war der Aufbewahrungsort für eine Menge Schaufeln und anderer Werkzeuge, die, wie ihr Aussehen bewies, schon lange nicht benützt worden waren. Da, wo das Dach der Hütte begann, zeigte sich eine kleine Vertiefung, und aus dieser hing etwa spannlang die Schnur nieder.
Müller griff ohne Mühe bis weit hinein in den Raum, in den man, auf dem Boden stehend, nicht schauen konnte. Jetzt fühlte er etwas Weiches unter seinen Fingern. Er faßte es an und zog es hervor.
Es klirrte, und dieses Klirren kam aus einem halbarmlangen Sack von Hirschleder, in dessen Zug die Schnur eingezogen war, deren eines Ende das Vorhandensein des Sackes verraten hatte.
Müller legte ihn auf den Boden und schwang sich dann zu der kleinen Dachnische hinauf. Sie enthielt nichts mehr, als was sich naturgemäß vorfinden mußte, viel Staub und etliche Spinngewebe. Und auch in dem unteren Teil des Verschlages entdeckte Müller nichts, das mit dem Schubertschen Fall in Verbindung gebracht werden konnte.
Nachdem er den ganzen Platz auf das genaueste durchsucht hatte, öffnete er den Ledersack. Er fand in ihm, worüber er sich gar nicht wunderte, denn er hatte es erwartet, die geraubten Eßbestecke der Schubert. Er ließ den Sack in den Garten hinübergleiten und kletterte ihm nach. Bis spät abends blieb er in der Wohnung der Ermordeten.
Als er sie verließ, war er höchlich befriedigt. Den Ledersack hatte er in eine Zeitung eingeschlagen. Er wollte ihn aufs Gericht bringen, empfand jedoch, daß es für ihn an der Zeit sei, etwas Warmes in den Leib zu bekommen.
Der lange Aufenthalt in der ungeheizten Wohnung hatte ihn recht durchkältet. Er nahm also seinen Fund mit nach Hause.
»Leider ist nur das Eßzeug darin,« sagte Müller zu der immer noch wie erstarrt dastehenden Anna, »ich hatte nämlich gehofft, daß der Schurke alles übrige auch in den Sack gesteckt habe, aber das Geld und sicher auch noch anderes, für ihn viel Wertvolleres hat er mitgenommen.«
»Was denn noch?« fragte Anna mit fliegendem Atem.
»Briefe.«
»Briefe?«
»Ich habe Ursache, es anzunehmen. Aber jetzt will ich mir's erst schmecken lassen. Bitte, liebe Anna, läuten Sie der Frau Petz.«
Wenige Minuten später saß er bei seinem Abendessen. Er aß so gemütsruhig, als habe er alle seine Gedanken bei den Speisen, die Frau Petz aufgetragen hatte.
Es war fast zehn Uhr geworden, als Müller sich seine Zigarre anzünden konnte. Dann sagte er zu Anna: »Sie müssen heute noch ein bißchen bei mir bleiben.«
»Gerne.«
»Und müssen mir nachdenken helfen. Es handelt sich hier nämlich ganz bestimmt nicht um einen Raubmord.«
»Aber der Täter hat doch auch geraubt! Sie haben doch eben selber die geraubten Bestecke gefunden!«
»Die er zurückgelassen hat, an einem Ort, von dem er annahm, daß sie dort nicht sogleich gefunden werden würden.«
»Und jetzt schon liegen sie da! Der Mensch hat sie also doch schlecht versteckt.«
Müller verneinte und schilderte Anna, wo er den Sack gefunden, und was dessen Versteck sonst noch verraten hatte.
»Also hat er doch eine Dummheit gemacht!«
»Da sieht man, daß Sie noch nie einen umgebracht haben,« erwiderte Müller lachend. »In solcher Lage übersieht man halt fast immer Kleinigkeiten.«
»Und die verraten einen dann.«
»Und die verraten einen dann!«
»Ob es nicht ein Kohlenarbeiter gewesen ist?«
»Daran habe ich von jenem Moment an gedacht, als ich den Sack unter den Fingern fühlte. Aber später bin ich von diesem Gedanken wieder abgekommen.«
»Es ist Ihnen wohl eingefallen, daß es ein eleganter Herr in einem hellen Winterrock war?«
»Darauf gebe ich nicht viel.«
»Nicht? Es haben ihn doch die zwei Frauen gesehen!«
»Meine liebe Anna, wenn Sie wüßten, wie wenig solche Zeugenaussagen zuweilen wert sind, und was für eine große Rolle anderseits der Zufall im Leben spielt, würden Sie sich auf so etwas nicht berufen.«
»Weshalb ließen Sie also den Gedanken an einen Kohlenarbeiter fallen?«
»Aus einem triftigen Grunde.«
»Der Täter konnte aber doch nicht über den Stacheldraht hinwegflüchten, und zum Haustor ist er nach Ihrer Meinung auch nicht hinaus.«
»Er hat beides nicht nötig gehabt. Das Tor des Holzplatzes hat zu jener Zeit offen gestanden.«
»Wie können Sie das wissen?«
»Der Pächter des Platzes hat es mir gesagt.«
»Ah, der Herr Kreh, der sein Geschäft in unserer Gasse hat?«
»Derselbe. Der Mörder Ihrer Tante ist also dort hinausgegangen.«
»Und hat ihr Geld mitgenommen.«
»Auch mitgenommen, möchte ich sagen.«
»Auch?«
»Frau Schubert hat ihre Wertpapiere – es wird sich wohl um solche handeln – vermutlich mit wichtigen Briefen zusammen aufgehoben gehabt.«
»Mit was für Briefen? Was für wichtige Briefe kann sie denn gehabt haben?«
»Ihre Tante war, soweit ich sie kenne, eine in moralischer Beziehung tadellose Frau.«
»Das war sie sicherlich.«
»War sie es immer?«
»Aber Herr Müller! Wie kommen Sie denn da zu einem Zweifel?«
»Ach zweifle ja gar nicht in Wirklichkeit daran, daß diese Frau ihr ganzes Leben lang ehrbar gewesen ist. Auch damals – auf dem Gute Pachern.«
»Sie zweifeln schon wieder!«
»Nein, Anna – mein Wort darauf! Ich denke nur Gutes von der Toten. Ich bin so fest wie Sie selbst davon überzeugt, daß Frau Schubert niemals in einem anderen Verhältnis zu ihrem damaligen Dienstgeber, dem Herrn v. Eck, gestanden hat als in dem Verhältnis einer braven Dienerin zu ihrem guten Herrn. Deswegen eben ist mir etwas aufgefallen.«
»Wann?«
»Heute vormittag – bei Friebel.«
»Aber –«
»Ich habe bei diesem zuerst an weiter nichts als an den roten Merkur gedacht. Friebel hat aber auch die Marken, die Ihre Tante ihm samt den Umschlägen gab, vor mir ausgeleert. Während er dann schrieb, habe ich, nur um die Zeit hinzubringen, diese Umschläge angesehen. Es waren ihrer achtunddreißig, alle tragen die Adresse Ihrer Tante, und siebenundzwanzig davon – merken Sie gut auf – siebenundzwanzig davon tragen eine Krone und die Buchstaben H. v. E. Das hat mich nachdenklich gemacht. Warum hat Herr v. Eck so lebhaft mit seiner ehemaligen Dienerin korrespondiert? Es pflegen solche Herren sonst doch nicht mit ehemaligen Dienstboten in einem so lange dauernden Briefwechsel zu stehen. Der letzte der Umschläge trägt im Poststempel die Jahreszahl 1900. Die beiden haben einander also fast bis zum Tode des Herrn v. Eck geschrieben.«
»Im Januar 1901 ist Herr v. Eck gestorben,« warf Anna ein. »Ich war erst kurz bei der Tante und weiß es noch wie heute. Gerade am Neujahrstag ist ein Telegramm gekommen. Am 2. Januar ist die Tante abgereist, und am 6. Januar, am Dreikönigstag, ist Herr v. Eck begraben worden.«
»So – so,« sagte Müller gedankenvoll und fuhr dann fort: »Können Sie sich denn gar nicht vorstellen, was die miteinander gehabt haben?«
»Nichts, gar nichts weiß ich. Die Tante hat mich nie in ihr früheres Leben eingeweiht. Es kann aber schon ein Geheimnis darin gewesen sein. Nur hat sie es in sich verschlossen, wie sie ja überhaupt auch ihre kleinsten Geheimnisse immer sorgfältig für sich behalten hat.«
Müller erhob sich. »Ist das zweifellos die Handschrift der Toten?« fragte er und legte ein Briefblatt vor Anna hin.
Es befand sich darauf nur ein Datum, eine Überschrift und der zwei Zeilen lange Beginn eines Briefes. Es stand da: »Wien, an: 19. Oktober 19O7. Hochverehrte gnädige Frau Gräfin. Es drängt mich, bevor es zu spät dazu ist, noch einmal von der peinlichen Sache –«
An dieser Stelle hatte die Feder gespritzt, das Briefpapier war also unbrauchbar geworden.
Anna nickte. »Ja, das hat die Tante geschrieben,« sagte sie. »Dieser Brief hätte zweifellos der Gräfin Vivaldi zukommen sollen.«
»Es ist also wahrscheinlich, daß Frau Schubert einen anderen Brief an die Gräfin abschickte.«
Jetzt stand auch Anna auf. »Und was hat das mit dem Verbrechen zu tun?« fragte sie gespannt.
Müller zuckte die Achseln. »Vielleicht nichts,« sagte er gleichmütig, »vielleicht auch sehr viel. Aber jetzt wollen wir schlafen gehen.« Er reichte seinem Schützling die Hand, besann sich aber wieder und sagte dringlich: »Nachdenken, mein Kind, fleißig nachdenken! Vielleicht kommt doch etwas in Ihrem Gedächtnis zum Vorschein, was mir dienen kann. – Gute Nacht! Ich muß morgen wieder zeitig heraus.«
Richtig saß er am nächsten Morgen schon um sieben Uhr am Frühstückstisch. Je eine Nummer sämtlicher in Wien erscheinenden Abendblätter lag vor ihm. Er hatte der Frau Petz den Auftrag gegeben, ihm die Zeitungen zu besorgen, denn er hatte an alle diese Blätter eine Anzeige aufgegeben und wollte sich davon überzeugen, daß sie, wie er angegeben hatte, auch richtig heute schon erschienen sei. Es war der Fall. In allen Zeitungen stand die Anzeige: »Jüngerer, eleganter Herr in hellem Überrock gesucht. Ist vielleicht zugereist. Hatte am Abend des 30. November vermutlich Kohlenspuren an sich. Auskünfte über ihn erbittet man unter J. M. an die Expedition.«
Müller pflegte sich sonst stets erst um halb acht Uhr zum Frühstück zu setzen. Er wunderte sich also nicht, als Anna ins Zimmer trat.
»Sie sind heute noch da? Das ist recht,« rief er ihr entgegen.
»Ich werde halt heute eine Viertelstunde später kommen,« meinte Anna, die schon zum Ausgehen fertig war, »ich habe es nicht versäumen wollen –«
»Was wollten Sie nicht versäumen?«
»Was gibt es denn?«
»Mir ist etwas eingefallen.«
Müller legte das Eierlöffelchen wieder hin, das er soeben zur Hand genommen, und deutete auf den Stuhl neben sich.
»Nun?« sagte er.
Anna setzte sich. »Ich habe fast nicht geschlafen in dieser Nacht. Immer habe ich grübeln müssen, und da ist mir eingefallen, daß die Tante einmal, wie sie so schwer krank war, eine seltsame Rede geführt hat. Es ist gerade der Doktor weggegangen gewesen, und ich hatte mich wieder zu ihr gesetzt. Da hat sie mich ängstlich angeschaut und hat gefragt, ob der Doktor vielleicht gesagt habe, daß ihr Kranksein schlecht ausgehen könnte, und da habe ich sie getröstet, und zum Schluß habe ich gesagt, was mir wirklich von Herzen gekommen ist, daß sie gewiß noch lang leben werde, schon meinetwegen würde ich darum beten, und der liebe Gott würde es mir ja nicht antun, daß ich ganz allein auf der Welt bleiben müsse. – Damals habe ich nämlich meinen Otto noch nicht gekannt,« erklärte Anna schmerzlich lächelnd. »Da hat mich die Tante gestreichelt und hat gesagt: ›Ich weiß es, Kind, daß du mich liebhast, und daß du um mein Leben betest, freilich, wenn dein Gebet erhört wird, wird das jemand sehr gegen den Strich gehen.‹ War das nicht eine seltsame Rede? Schaut das nicht aus, als ob sie einen Feind gehabt hätte? Mir ist die ganze Geschichte entfallen gewesen, und es ist gerade, als ob Sie, Herr Müller, sie heraufbeschworen hätten.«
»Was jemand sehr gegen den Strich gehen wird,« wiederholte Müller und versank in Nachdenken, in ein so tiefes Nachdenken, daß er Ort und Zeit darüber vergaß. Er saß mehrere Minuten ganz regungslos da, dann erhob er den Kopf und sah Anna, die sich auch nicht geregt hatte, noch vor sich sitzen. »So, Kind, jetzt gehen Sie nur,« sagte er, ihr die Hand reichend.
Als sie draußen war, nahm er den Löffel wieder zur Hand und aß seine inzwischen kalt gewordenen Eier.
Dann setzte er ein ziemlich langes Telegramm auf und verließ das Haus.
Das Telegramm ging nach Graz. Es war an einen ehemaligen Kollegen Müllers, an einen gewissen Mittermayer gerichtet.
Den Tag brachte Müller auf den Wiener Bahnhöfen zu, wo er danach forschte, ob nicht ein Herr mit einem hellen Überrock und etwaigen Kohlenspuren abgereist sei.
Er hatte mit dieser Nachforschung gar keinen Erfolg. Er wunderte sich auch nicht darüber.