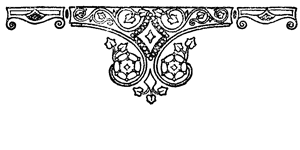|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
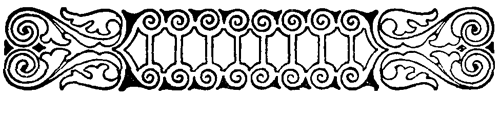
Baronesse Simonetta, Sie mißverstehen mich wieder einmal gründlich.«
»Wollen Sie damit sagen, daß Sie viel zu hoch reden, als daß unsereins Sie verstehen kann?«
»Sie wissen genau, daß ich das nicht sagen will. Ihr Mißverstehen ist Absicht. Ich sagte nicht, daß alle, die kein Wappen haben, Edelmenschen seien, sondern daß dies leider nur nicht alle seien, die ein Wappen besitzen. Ich unterstand mich ferner zu bemerken, daß Ahnenreihen allein mir nicht imponieren.«
»Mir schon.«
»Das weiß ich. Sie sind ein Vöglein, das immer auf dem Stammbaum sitzt.«
»Sie sind unausstehlich, Doktor.«
»Finden Sie? Nun ja, ich bin blond und neige zum Dickwerden, außerdem heiße ich Urich Malten, schlechtweg Malten, und darf dieses Mangels wegen nicht einmal das kleinste Krönchen in meine Socken sticken lassen.«
»Von Socken spricht ein feiner Mann nicht zu einer Dame.«
»Richtig. Feine Männer zeigen sich dafür den Damen auf dem Tennisplatz in einem Anzug, in dem man höchstens seinen Barbier empfangen sollte.«
»Das verstehen Sie einfach nicht. Sie sind –«
»Ich bin rückständig. Sie haben mir das schon oft genug gesagt. Das bringen die Umstände so mit sich. Wir kleinen bürgerlichen Leute müssen halt so viel arbeiten, daß wir keine Zeit haben, gleichen Schritt zu halten mit den hochgeborenen Herren, die sonst nichts zu tun haben, als ihr Wappen blank zu erhalten. Meinen Sie übrigens nicht, daß wir für heute genug über dieses Thema geredet haben?«
»Übergenug. Und da Sie nicht davon zu überzeugen sind, daß –«
»Daß adelig und edel gleichbedeutend ist? – Nein, davon bin ich nicht zu überzeugen. Ich bin schon zu alt für solche Märchen. Leute, die bald vierzig sind, haben schon viel zu viel Einblick in das wirkliche Leben, um noch an schöne Trugbilder zu glauben. Aber jetzt machen wir wirklich Schluß. Die Gräfin wird sich schon über uns ärgern.«
Die Streitenden waren ein hübsches junges Mädchen und ein stattlicher blondbärtiger Herr. Sie befanden sich in einem eleganten Salon, in dessen behaglichster Ecke eine überschlanke ältliche Dame, ganz in schwarzen Samt gekleidet, in einend tiefen Sessel ruhte.
Das war die Gräfin Julia Vivaldi, die Tante des jungen Mädchens. Sie war immer leidend, aber trotzdem von einer gewissen stillen Heiterkeit, die wie ein bißchen Sonnenschein auf ihrem kleinen, welken Gesichtchen lag, ein Sonnenschein, von dem niemand wußte, woher er eigentlich kam, denn die Gräfin hatte eine überaus unglückliche Ehe hinter sich, in der sie über zwanzig Jahre die betrübende Rolle aller jener Frauen hatte durchführen müssen, deren Männer Spieler und Wüstlinge sind. Graf Vivaldi, der schließlich in einem Zweikampf gefallen war, hatte also seiner Witwe keineswegs ein sonniges Leben bereitet, dessen Nachschein noch vorhielt. Es war wohl auch nur ein Abendrot, das die sich immer gleich bleibende Güte ihres Schwagers, bei dem sie seit dem Tode ihres Mannes lebte, über sie ausbreitete.
»Sie ist unsäglich wohlwollend, dankbar und – schwach,« hatte Doktor Malten, der seit etwa zehn Jahren Hausarzt in der Villa Romana war, seiner Mutter die Gräfin geschildert. »Sie ist eine jener Frauen, die zum Anlehnen geschaffen sind, sie hat aber zwanzig Jahre lang allein im Sturm stehen müssen. Das hat sie gebrochen. Sie ist jetzt nur noch der Schatten einer Frau, aber ein Schatten, von welchem Wärme ausgeht.«
Doktor Malten hatte die Gräfin damit sehr richtig geschildert. Sie war nie jemandem ernstlich böse, sie war es auch jetzt nicht, als die beiden Streitenden für eine Weile die Streitaxt begruben, die sie, seit sie einander kannten, gar fleißig schwangen. Die Gräfin richtete sich ein wenig auf und ließ die Hände mit dem Strickzeug in den Schoß sinken.
Lächelnd schaute sie auf Malten, der zu ihr herüberkam, dann auf Simonetta, die noch ärgerlich war, und die den langen Stiel der Rose, die sie einer vor ihr stehenden Vase entnommen hatte, zwischen ihren schlanken Fingern herumwirbelte.
»Müßt ihr denn immer streiten?« sagte die alte Dame mit ihrer lieben, müden Stimme.
»Nun ich fange nicht an!« verteidigte sich Malten.
»Aber Sie reizen mich absichtlich!« rief Simonetta zornig herüber.
»Womit hat er dich denn heute gereizt? Etwa damit, daß er mir die häßliche Geschichte aus dem adeligen Klub erzählte? Er hat mir ja auch erzählt, daß er die Kopfverletzung eines Maurers verbinden mußte, die der Arme bei einer Schlägerei davongetragen hat.«
»Der Arme!« spöttelte Simonetta. »Betrunken war er, noch dazu vom Schnaps betrunken.«
»Zu Champagner hat's ihm nämlich nicht gereicht,« warf Malten trocken ein.
»Schon wieder ein Hieb! Nun ja – Sie, verehrter Doktor und Demokrat, gönnen den oberen Zehntausenden eben ihr Leibgetränk nicht.«
»Er platzt ja beinahe vor Neid,« bemerkte die Gräfin lächelnd.
»Im Gegenteil!« rief Malten. »Niedrig von Geburt, wie ich's bin, freue ich mich selbstverständlich über den reichlichen Champagnerverbrauch und was dazu gehört, denn ich bin ja Arzt im vornehmen Villenviertel – vergessen Sie das nicht, Baronesse! – Aber was arbeiten Sie denn da Umfangreiches, Gräfin?« Bei dieser Frage ließ er sich neben der alten Dame nieder und strich über ihr hellrotes Gestrick hin. »Wie weich das ist!«
»Es muß weich sein, denn nur Weiches macht warm.«
»Was wird es denn?«
»Eine Hausjacke.«
»Gräfin tragen doch sonst nie Rot!«
»Für Ihren Liebling, Doktor, für die Schneiderin strickt sie,« rief Simonetta herüber.
»Für Fräulein Roller? Ah, das ist lieb von Ihnen, Gräfin, daß Sie sich so viele Mühe für die Arme geben, die immer Putz für die anderen macht und an sich selber gar nicht denken kann! Und solch ein schönes Stück soll sie haben! Die anderen ›wohltätigen‹ Damen verstricken meist nur harte, billige Wolle.«
»Da wär's mir um meine Finger leid,« sagte die alte Dame.
Eilig kam Simonetta herüber und setzte sich an der Gräfin freie Seite. »Warum lügst du denn, Tante? Sag, warum lügst du?« rief sie heftig aus. »Deine Finger hast du nie geschont. Malten selbst sagte es mir, daß du einst daheim gearbeitet hast wie ein Weib aus dem Volke. Wie kannst du ihm jetzt so etwas vormachen wollen? – Glauben Sie es ihr nicht, Doktor! Nur ihrer Armen wegen nimmt sie so gute Wolle und macht aus jeder ihrer mühseligen Arbeiten ein Luxusstück. So ist's, du dummes, gutes Tantchen, das nicht einmal ordentlich lügen kann!«
Doktor Malten und die Gräfin schauten einander lächelnd an.
Aber das Helle in des Doktors Gesicht verlor sich sofort wieder, wohl nur deshalb, weil der Diener eben einen Herrn anmeldete, der dicht hinter ihm eintrat.
»Herr v. Eck!« hatte Domenico Loteta, der Kammerdiener des Hausherrn, gemeldet.
Herr v. Eck war ein ausfallend schöner Mann. Er besaß jene dunkle Schönheit, die den Frauen ganz besonders gefährlich ist. Sogar die schwarze Locke, die sich eigensinnig über der hohen Stirn kräuselte, fehlte nicht, und ein ideales Schnurrbärtchen war ebenfalls vorhanden. Ja, Alfons Eck v. Pachern war ein schöner Mensch. Es war begreiflich, daß er seine Eroberungen dutzendweise machte, und kein Wunder, daß Simonetta Labriola di Malfettani, des reichen Generals Labriola einziges, verwöhntes Töchterlein, sich in Eck verliebt hatte und seine Braut geworden war. Alfons kam fast täglich von seinem Gute nach der Stadt und zeigte sich niemals ohne einige der herrlichen Blumen, in deren Zucht sein Gärtner ein Künstler war.
Heute überreichte er Simonetta einen Strauß glutroter Nelken und legte der Gräfin zwei herrliche Dijonrosen auf den Schoß.
»Es ist schrecklich kalt,« sagte er, »und ich habe die Dummheit gemacht, selbst zu kutschieren, trotzdem ich wußte, daß ich erkältet bin. – Fühlen Sie einmal, Doktor, mir ist's, als ob ich schon Fieber hätte.«
»Freilich fiebern Sie,« sagte der. »Bei diesem eisigen Wind hätten Sie besser daheim bleiben sollen.«
»Wofür ich aber danke,« fiel die Baronesse lebhaft ein. »Ich hab' dich ja schon zwei Tage nicht gesehen.«
»Tatsache! Zweimal vierundzwanzig Stunden habe ich dich vernachlässigt!« scherzte Eck. »Wirst du mir verzeihen können? – Ach, Netta,« fuhr er mißmutig fort, »wenn du wüßtest, wie viele Arbeit ich jetzt habe! Den ganzen Tag bin ich im Wald. Nur gut, daß du mich nicht siehst. Wie ein Strolch sehe ich aus in meiner Waldtracht.«
»Du kannst immer nur gut aussehen,« sagte Simonetta zärtlich.
»Oder wie ein verkleideter Prinz,« ergänzte die Tante.
»Schon der kostbare Ring verrät ihn,« setzte Malten hinzu. – »Jetzt aber, Baronesse, kredenzen Sie mit viel Liebe und wenig Rum Herrn v. Eck eine Tasse recht heißen Tee und schicken Sie ihn dann bald heim. – Ihnen aber,« wandte er sich an den jungen Gutsherrn, »rate ich, bis auf weiteres den Wald zu meiden. Die kalte Nässe kann Ihren Zustand ernst machen, und Sie haben es ja nicht nötig, sich eine Influenza anzuzüchten.«
»Lieber Doktor, drei Tage müssen Sie mich noch machen lassen. Wir sind dann wohl fertig mit dem Bestimmen der Bäume, die gefällt werden sollen.«
»Wenn Sie sich nichts sagen lassen, kann ich nicht helfen. Ich empfehle mich jetzt. – Für die rote Jacke, Gräfin, muß ich Ihre Hand küssen. – Und Sie, Baronesse, erhalten Sie mir Ihre Feindschaft!«
Im Begriff, das Zimmer zu verlassen, wurde er aufgehalten. Der General war, sichtlich aufgeregt, eilig hereingekommen. Er hielt eine Zeitung in der Hand.
»Bleiben Sie noch, Doktor,« sagte er. »Es wird Sie auch interessieren. Denkt euch, was geschehen ist! Ein Mord wurde begangen in Wien, ein Raubmord an einer, die wir alle kennen – an der armen, alten Schubert.«
»An meiner Resi!« schrie Simonetta auf.
»An Frau Schubert?« rief erschrocken der Doktor.
»An unserer Therese?« sagte Herr v. Eck, der ebenfalls heftig erschrocken war.
Sie alle drängten sich an den General heran, der ihnen nun laut den Bericht in der Zeitung vorlas.
Die beiden Damen waren am meisten erregt. Sie hatten die Schubert vor ein paar Wochen erst besucht, als sie in Wien gewesen waren, um einige Einkäufe zu machen. Sie hatten die brave Alte sehr gern gehabt, die Simonettas Kindheit behütet und des Generals Wirtschaft so lange Jahre treu und eifrig geführt hatte.
»Wie aufopfernd hat sie den Herrn General bei dem letzten Gichtanfall noch gepflegt!« sagte der Doktor. »Und so bescheiden war sie und so unermüdlich tätig.«
»So war sie auch, als sie noch in Pachern war,« sagte sichtlich bewegt der junge Gutsherr.
»Eine stille, ja merkwürdig stille Person war sie,« meinte der Doktor nachdenklich. »Mir war sie eigentlich niemals ganz sympathisch – vielleicht ganz ohne Grund. Ich habe sie allerdings weniger gekannt, als die Herrschaften sie kannten.«
»Sie hatte jedenfalls viele gute Eigenschaften,« bemerkte der General. »Eines an ihr habe freilich auch ich nicht gern gesehen. Sie hat immer das Bestreben gehabt, eine Rolle zu spielen. Nun, jeder hat seine Fehler. Jedenfalls ist es furchtbar traurig, daß sie auf eine so schreckliche Art aus dem Leben hat gehen müssen.«
Seufzend faltete er die Zeitung zusammen und begleitete den sich nun auch von ihm verabschiedenden Malten bis an die Tür.
Während des ganzen Abends wurde von nichts mehr als von dem Verbrechen und von den vielen guten Eigenschaften der alten Schubert gesprochen. Simonetta hatte darüber ganz vergessen, ihren Bräutigam zeitig heimzuschicken. Erst nach dem Abendessen fiel ihr das Gebot des Doktors ein.
»Daß du morgen ja nicht ausgehst!« sagte sie dringlich beim Abschied. »Jetzt, da du diese Aufregung gehabt hast, bist du noch empfindlicher. Ich will dich lieber ein paar Tage entbehren. Oder vielleicht kommen Tante und ich zu dir hinaus. Einen Kranz aber schickst du jedenfalls morgen der Resi. Tante und ich werden ihr einen Erikakranz schicken, die hat sie immer so gern gehabt. ›Ein Zauber ist in ihnen. Es sind Glücksblumen,‹ hat sie oft gesagt.« Simonetta schluchzte auf. »Ach, jetzt werden sie ihr kein Glück mehr bringen!«
»Rege dich doch nicht auf, Liebling!« bat Alfons, das Mädchen leidenschaftlich umfangend. »Wie soll ich es denn zu Hause aushalten, wenn ich dich so traurig weiß! Aber weißt du, zu mir hinauskommen darfst du nicht. Ich kann dir nicht versprechen, daß du mich antriffst. Ich werde des Holzverkaufes wegen vielleicht doch wegfahren müssen. Übermorgen abend bin ich hoffentlich schon wieder bei dir. Und den Kranz vergesse ich nicht. Felber hat noch viele weiße Rosen, die schicke ich ihr. Also, Herz, leb wohl! Wirst du mich immer, immer gern haben?«
Er zerdrückte die zarte Gestalt seiner Verlobten fast in seinen Armen.
»Aber Alfons!« ermahnte Simonetta den Ungestümen und entzog sich ihm. »Heute wenigstens solltest du ruhiger sein!«