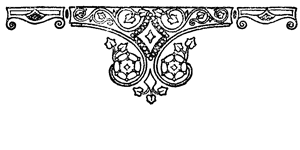|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
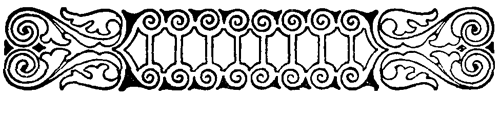
Die Umgebung von Bruck an der Mur ist nicht gerade großartig, aber sie ist lieblich, und die dunklen Wälder, die rings die Höhen bedecken, geben der Gegend einen Einschlag von Ernst, der ihr recht gut steht.
Etwa eine Gehstunde von Bruck liegt das Dorf St. Florian. Es liegt auch von Kapfenberg, der Bruck zunächstgelegenen Station der Südbahn, etwa eine Gehstunde fern. St. Florian duckt sich zu Füßen eines ziemlich hohen, steil abfallenden Berges und läßt sich sozusagen außerdem noch behüten von dem uralten, schönen Bau, der, ein wenig höher gelegen als das Dorf, auf dieses niederschaut.
Dieser altersgraue Bau mit den derben Ecktürmen und den ebenso derben Wirtschaftsgebäuden, die ihn umgeben, ist das Gut Pachern. Die Landstraße führt daran vorüber, und unterhalb der weiten, sanft abfallenden Wiesen und Felder, in deren Mitte es steht, fließt ein Wildbach, der weiter unten eine Mühle treibt, die auch schon viele hundert Jahre alt ist und einst zum Gut Pachern gehört hat.
Das Schloß selbst grenzt an einen schönen, großen, sich bis zum Bach hinunterziehenden Garten. Zum Dorfe hat man vom Schloß aus fast zwanzig Minuten zu gehen.
Pachern ist kein Prachtbau, hat aber dennoch einige architektonische Schönheiten, seinen von wohlgeformten Säulen getragenen offenen Gang, in welchem die Zimmer des ersten und einzigen Stockwerkes münden, und seine zwei Ecktürme, welche achteckige Räume umschließen, deren Fenster eine herrliche Fernsicht vermitteln. Auch schöne Kreuz- und Rippengewölbe gibt es in Pachern, und die kleine Schloßkapelle besitzt einen Flügelaltar, dessen Schnitzarbeit von der Hand eines unbekannten, aber jedenfalls großen Künstlers herrührt.
Pacherns größter Reiz jedoch liegt in der Natur, von der es umgeben ist. Auch jetzt, in körnigen Schnee gebettet, von einem lichtblauen Himmel überwölbt, in dessen unendlichen Tiefen es silbrig schimmert, bietet diese stille Gebirgslandschaft ein wunderschönes Bild.
Einer aber freut sich der Winterpracht nicht. Es ist das noch dazu einer, der dazu hinausgezogen ist, diese Pracht zu genießen.
Es ist ein Schiläufer. Er sitzt auf einem an der Straße liegenden Felsstück. Die Schneeschuhe, die Lenkstange und sein Rucksack liegen neben ihm. Er selber ist soeben dabei, seine linke Hand zu untersuchen.
Einmal schaut er flüchtig auf. Ein Rabe ist an ihm vorbeigestrichen. Am Bache unten hackt ein Fischer das Eis auf. Sein Angelzeug liegt neben ihm. Sonst ist nichts Lebendiges ringsum.
Doch da regt sich in der Ferne etwas. Auf der Straße kommt ein Reiter daher. Ganz langsam reitet er, wohl mehr seinem Fuchshengst als sich selber zuliebe. Nach einer guten Weile erst kommt er an dem Schiläufer vorbei.
Der untersucht noch einmal die Gelenke seiner Hand, dann steht er ein wenig mühsam auf, wirft sich den Rucksack um, hängt die Schneeschuhe über die Schulter und geht auf das Dorf zu, das schon sichtbar ist.
Das Schloß liegt noch etwa hundert Schritte vor ihm. Da kommt hinter ihm ein kleiner Bube daher. Der Reiter reitet gerade neben ihm.
»Du, Kleiner,« ruft der Reiter, »geh nur in die Küche. Sie sollen dir was Gutes geben. Sag ihnen auch, der gnädige Herr käme sogleich heim«
Da setzt sich das Büblein eilig in Trab und läuft in das Schloß hinauf.
Das liegt jetzt schon dicht vor dem verunglückten Schneeschuhläufer, neben dem der Reiter herreitet.
Der Schiläufer weicht ihm ein bißchen unbehilflich aus, bleibt dann stehen, wischt sich das Gesicht ab, klemmt die Lippen ein und stützt sich dann schwer auf seinen Lenkstock.
Der Reiter hält an. »Haben Sie sich verletzt?« fragt er.
»Gestürzt bin ich, und mir scheint, ich habe mir die linke Hand verstaucht.«
»Das ist fatal. Aber Sie gehen auch etwas mühsam.«
»Stimmt,« gibt der andere mit einem Lächeln zu. »Das hat aber mit meinen Schiern nichts zu tun. Es hat mich nur plötzlich ein Hexenschuß gepackt.«
»Auch schlimm!« erwidert der junge Reiter, springt vom Pferd und steht schon neben dem anderen. »Ruhen Sie ein wenig bei mir aus. Vielleicht wird Ihnen besser.«
»Wie käme ich dazu?«
»Genau so, wie ich dazu käme, wenn mir bei Ihrem Hause so etwas passierte.«
»Da müßten Sie nach Brandenburg kommen.«
»Ich hab' es schon erkannt, daß Sie da oben zu Hause sind.«
»Spreche ich noch so stark Dialekt?«
»Kaum wahrnehmbar – aber doch.«
»Und ich bin schon seit Jahren so selten daheim.«
»Sie reisen viel?«
»Ja – und denken Sie, zumeist meiner Sportliebhabereien wegen – au!«
»Gehen wir langsamer. Wollen Sie meinen Arm nehmen? – So! Jetzt wird es besser sein. – Matthias!«
Diesen Namen rief der junge Mann zum Bach hinunter.
Daraufhin kam der Fischer herauf. »Was wünschen der gnädige Herr?« fragte er.
»Den Rucksack und die Schneeschuhe dieses Herrn tragen Sie ins Haus. Frau Huber soll das grüne Turmzimmer heizen lassen.«
Der Mann ging eilig davon, um den Auftrag auszuführen.
Es war entschieden Bewegtheit in der Stimme des Fremden, als er, dem liebenswürdigen Schloßherrn ernst in die Augen schauend, sagte: »Ich bin mehr als nur verwundert über Ihr so gütiges Entgegenkommen. Gestatten Sie mir, mich Ihnen vorzustellen – v. Schleinitz, Gutsbesitzer.«
»Eck v. Pachern,« sagte der andere, den Hut lüftend. »Es freut mich, einen Gast zu bekommen. Die Winter sind ein wenig eintönig hierzulande. Sie sehen, meine Einladung geschah aus reinem Egoismus.«
»Das habe ich natürlich sofort angenommen,« sagte Schleinitz, lächelnd den Scherz aufnehmend, und ließ sich nun ohne weiteres ins Schloß und in einen großen, hallenartigen Raum führen, zu dem man von der Gartenseite her über eine niedrige Freitreppe gelangte.
Schleinitz ließ sich mit einer gewissen Vorsicht in einen Sessel nieder, den der junge Hausherr ihm vor den riesigen Ofen schob. »Da haben Sie es aber schön!« sagte er. »Es muß überhaupt in dem prächtigen Bau behaglich zu leben sein.«
»Zurzeit nicht besonders,« entgegnete Eck etwas melancholisch, »und ich weiß auch nicht, ob das jemals anders werden wird.«
»Sie sind Junggeselle?« erkundigte sich der Gast.
Eck bejahte. »Ich lebe schon verschiedene Jahre wie ein Mönch hier. Ich habe fast keinen Verkehr als den mit meinen Dienstleuten, und die vergnügten Stunden, die einem diese bereiten, die kennt man ja. Übrigens bin ich seit einem halben Jahr Bräutigam.«
»Da gratuliere ich. Da wird's ja bald anders werden.«
»Es ist mir auch zu gratulieren,« rief Eck, und sein schönes Gesicht erhellte sich für einen Augenblick. Dann freilich zog die Wolke des Schwermutes wieder darüber hin.
Um diesen plötzlichen Stimmungswechsel zu bemänteln, benutzte Eck eine Bewegung seines Gastes. »Bitte,« sagte er, »wollen Sie einmal das Bein ausstrecken?«
»Danke, es ist schon gut so. – Aber Sie werden jetzt wissen wollen, wie ich alter Brandenburger in Ihr eigentlich weltfern gelegenes Tal komme.«
»Wenn Sie es mir sagen wollen, wird es mich interessieren.«
»Erstens bin ich ein Freund alter Burgen und Schlösser. Und da ich in Laibach einen Bekannten besuche, habe ich auf meinem Weg – ich war nämlich ein paar Wochen auf dem Semmering – mir angeschaut, was eben zu sehen war, und habe dabei auch vielfach meine Schier benützt. Mein Gepäck habe ich vorausgesandt. Es ist mir übrigens sehr angenehm, daß Sie keine Damen im Hause haben, denn in meiner Touristentracht könnte ich mich ihnen ja kaum zeigen.«
»Das hat bei uns nichts zu sagen.«
»Nun, ich hoffe, Sie nur ein paar Stunden belästigen zu müssen.«
»Werden Sie heute schon in Laibach erwartet?«
»Das nicht. Man kennt dort meine Ankunftszeit noch nicht.«
»Nun also. Da ruhen Sie sich vorerst ein paar Tage hier aus. Man kann doch seinen Bekannten nicht mit einem Hexenschuß ins Haus fallen.«
»Hierherein bin ich jedenfalls damit gefallen, und hier bin ich sogar ganz fremd.«
»Sie werden sich bei mir bald wie daheim fühlen, denn Sie werden bemerken, daß ich mir meine volle Freiheit wahre. Ich werde mich nur sehr wenig um Sie kümmern.«
»Also wollen Sie mich tatsächlich über Nacht behalten? Wohl täte es mir schon.«
»Ich werde Sie einfach nicht fort lassen, solange Sie nicht wieder ganz wohl sind, denn meine Braut, die in Graz lebt, und die ich sonst jeden zweiten Tag sehe, macht einen Besuch in Klagenfurt.«
»Da können Sie mich also zur Gesellschaft brauchen! Nun gut – ich bleibe. Aber, besonders lustig bin ich nicht – darauf mache ich Sie aufmerksam!«
»Gerade jetzt könnte ich einen Lustigmacher gut brauchen,« entgegnete Eck, seltsam lächelnd. »Schade also, daß Sie nicht von dieser Art sind!«
Schleinitz strich sich über den schmerzenden Rücken. »Daran ist eben das Alter schuld,« meinte er, »das Alter, das mich noch immer nicht recht vor Torheit schützt. Ich sollte wirklich damit aufhören, Sport zu treiben, aber ich habe eben damit nie aufgehört, und von lieben Gewohnheiten läßt man nicht so leicht. – Was haben Sie denn dort stehen? Den schlanken Krug meine ich. Das ist wohl bosnische Arbeit?«
»Ja – und es ist ein schönes Stück. Ich hab' es mir im alten Han in Sarajewo selbst ausgesucht.«
»Ah – Sie waren in Bosnien? Wahrscheinlich als Offizier?«
»Ja. Aber meistens in ganz entlegenen Bergnestern. Wir hatten oft nichts als Schaffleisch zu essen. Aber es war doch schön dort. Nie mehr werde ich so ganz frei wieder sein wie dort!«
»Sie lieben die schrankenlose Freiheit?«
»Ich weis; nicht, woher ich es habe, denn hier und wo ich immer lebte, habe ich doch eigentlich nichts, als das reinste Philistertum um mich gehabt.«
»Vielleicht war einer Ihrer Vorfahren ein Raubritter,« scherzte Schleinitz.
Aber er hatte kein Glück mit diesem Scherz. Sein Gastgeber sah plötzlich recht ernst aus.
Schleinitz war jedoch ein Weltmann. Er schien die kleine Verstimmung nicht zu bemerken, redete von etwas anderem, und so kamen die beiden Herren schnell wieder zu Dingen, die jedem von ihnen genehm waren.
Dann wurde gemeldet, daß es im grünen Turmzimmer schon warm sei.
»Es ist nämlich noch gar nicht recht kalt dort gewesen,« erklärte Eck. »Gestern noch hatte ich Gäste. Meine Braut und ihre Tante waren hier. Die junge Dame huldigt nämlich dem Rodeln, und ich habe ihr eine fast fünf Kilometer lange Bahn von bester Beschaffenheit herstellen können.«
»Das ist ja eine ideale Bahn!«
»Nahezu. Sind Sie auch Rodler?«
»Nein – das nicht. Und Sie?«
»Gewiß. Aber gestern kam es doch zu keiner Fahrt.«
»Weshalb nicht?«
»Es ist plötzlich ein derartiger Sturm in unser Tal hereingebrochen, daß wir einfach nicht ins Freie gehen konnten.«
»Aber früher haben Sie doch schon gerodelt?«
»Es war noch kein Wetter dazu,« sagte Eck.
Er sagte es erst nach einer kleinen Pause, denn er hatte sich, von Schleinitz abgewendet, damit beschäftigt, den Handschuh aufzuheben, den er eben von der Hand gezogen hatte, und der ihm entfallen war.
»Bei uns auf dem Semmering war gerade das richtige Wetter dazu.«
Schleinitz erhob sich vorsichtig und ging dem Stubenmädchen nach, das, um ihm den Weg zu weisen, an der Tür stehen geblieben war.
»Um ein Uhr ist Speisestunde,« bemerkte Eck, hinter ihm hergehend. Seine Stimme klang schon wieder freundlich.
Eine Stunde verstrich schnell, und bei Tisch gab es ein sehr angeregtes Gespräch. Besonders der hereingeschneite Gast hatte viel zu erzählen. Er war weit herumgekommen in der Welt, und Österreich kannte er in fast allen seinen Teilen. Auch Bosnien und sogar den Garnisonsort, in welchem Eck jene köstliche Freiheit genossen, von welcher er vorhin geschwärmt hatte, und dessen Name erst jetzt genannt worden war, kannte er. Für Schleinitz hatte die Rassenverschiedenheit der Angehörigen des österreichischen Kaiserstaates einen so großen Reiz, wie er erklärte, daß er zumeist deshalb dieses Land bereiste, welches schon seiner Bodenbeschaffenheit halber so interessant war. Und wie geistreich wußte er die Eindrücke zu schildern, die er erhalten hatte!
Nur vergaß er dabei zu essen. Und als Ecks immer wiederkehrende Aufforderungen kaum einen Erfolg hatten, mußte der Gast zugeben, daß es ihm in letzter Zeit überhaupt an Eßlust mangle.
Den Nachmittag verbrachte der junge Gutsherr auswärts.
Lisi, das Stubenmädchen, welches dem Gast den Kaffee in sein Zimmer brachte, war recht redselig, vielleicht deshalb, weil sie so selten Gelegenheit hatte, mit jemand anderem zu sprechen als mit der einsilbigen Wirtschafterin und dem Küchenmädchen, das ein einfältiges Ding war. Zudem munterte sie der freundliche Gast zum Reden auf, indem er so recht gemütlich allerlei Fragen an sie stellte, wie lange sie schon hier diene, und ob sie angenehme Dienstgenossen habe.
»Fad ist's halt hier,« meinte sie, »namentlich wenn der gnädige Herr wegfährt. Da hört man dann überhaupt kaum einen Laut im ganzen Schloß.«
Ob denn Herr v. Eck viel reise, erkundigte sich der Gast und erfuhr, daß jener jeden zweiten Tag zu seiner Braut nach Graz fahre, und daß er kürzlich auch sonst zweimal verreist gewesen sei – einmal nicht gar lange, einmal aber ein paar Tage. Da hatte er etwas in Triest zu tun gehabt.
»Aber nicht nur wegen des Holzverkaufes ist er hingefahren,« sagte das Mädchen.
Sie redete überhaupt in einigermaßen gereiztem Tone, wenn sie von ihrem Gebieter sprach, und Schleinitz, offenbar ein Menschenkenner, glaubte schon zu wissen, weshalb ihre Seele da jedesmal aus dem Gleichgewicht kam.
Er hatte bei Tisch einen heißen Blick bemerkt, den die hübsche Person verstohlen auf ihren Herrn warf, und anderseits hatte er wahrgenommen, daß dieser Lisi mit vollkommener Gleichgültigkeit behandelte.
»Es kann Ihnen doch vollständig gleich sein, weshalb Ihr Herr dahin oder dorthin reist,« meinte Schleinitz, Lisi lächelnd und mit sichtlichem Wohlgefallen betrachtend, was das Mädchen noch gezierter machte, als es ohnehin schon war.
»Mir kann es freilich gleich sein,« entgegnete sie in vielsagender Weise, »ob aber auch seiner Braut? Die Baronesse Simonetta hat viel Temperament. Ob die so ruhig zuschauen wird über diese heimlichen Fahrten nach – Triest?«
»Ihr Herr reist doch gewiß nicht heimlich,« warf der Gast ein. »Mir scheint, Sie sind eine kleine, romantische Person, deren Phantasie von diesen mittelalterlichen Mauern zu sehr angeregt wird.«
»Da irren sich der gnädige Herr aber sehr,« fiel ihm das Mädchen in die Rede. »Nicht heimlich soll er reisen? Ist es etwa keine Heimlichkeit, wenn einer sagt, er geht nach Graz, und derweil schleicht er sich nach Kapfenberg und fährt nach der entgegengesetzten Seite?«
»Mein schönes Kind, ereifern Sie sich doch nicht so sehr!« mahnte der Gast. »Warum sind Sie denn überhaupt so erzürnt gegen Ihren Herrn?«
»Weil er mich heute früh wieder vor allen heruntergeputzt hat,« brach das Mädchen los. »Und noch dazu wegen nichts und wieder nichts. Ich habe auch sofort gekündigt. Ach brauche mich keine Schnüfflerin heißen zu lassen.«
»Schnüfflerin! Das ist freilich ein starker Ausdruck!«
»Nicht wahr? Und was hab' ich denn getan? Seinen Schreibtisch hab' ich abgestaubt, und er war noch dazu dabei. Am Fenster hat er gestanden und hat seine Uhr aufgezogen. Da frag' ich ihn, ob ich die Goldschmiedadresse, die auf dem Tisch gelegen ist, wegwerfen kann. Da hätten Sie ihn sehen sollen! Wie ein Wilder ist er auf mich zugestürzt und hat mir die Karte aus der Hand gerissen. Ich bin hinausgelaufen, er aber mir nach, und da ist das Geschimpf losgegangen. – Und er war doch bisher ein so ruhiger Herr!« sagte die Leidenschaftliche, plötzlich aufschluchzend. »Aber in letzter Zeit ist er wie ausgewechselt. Und ich hab' ihm doch von seinem Umberto nichts heruntergebissen!«
»Von was für einem Umberto?« fragte Schleinitz.
»Na – der Name ist halt auf der Karte von dem Goldschmied gestanden.«
»Ah so!« machte Schleinitz und sagte dann: »Sie, liebes Kind, mir scheint, es tut Ihnen schon leid, daß Sie gekündigt haben.«
Der Herr hatte das sehr wohlwollend gesagt. Des Mädchens Lippen fingen zu zucken an.
Aber Lisi mochte stolz und trotzig sein. Sie wurde schnell wieder ruhig und rief: »O ich gehe – ich gehe schon! Wenn die junge Frau da sein wird, könnt' ich es doch nicht mehr aushalten, denn –«
Lisi lachte hysterisch auf, wischte sich die Tränen ab und lief hinaus.
Schleinitz sah ihr lächelnd nach. »Armes Ding!« murmelte er. »Es wäre ja ein Wunder, wenn du dich nicht in ihn verliebt hättest! Er ist wohl so ziemlich der schönste Mann, den ich je gesehen habe.« –
Nach einer Weile holte Lisi das Kaffeegeschirr. Schleinitz hatte wieder sehr wenig Appetit gehabt.
Nun, es war kein Wunder, daß ihn in diesem Hause jeder Bissen würgte, denn Vornehmheit und Herzlichkeit hatten ihm das Tor geöffnet, und er war im Namen der Gerechtigkeit hierher gekommen, um zu ergründen, ob der Herr dieses Hauses – ein Mörder sei!
Herr v. Schleinitz, der brandenburgische Gutsbesitzer, war Joseph Müller, der alte Detektiv.
Er hatte einen unerwartet raschen Erfolg zu verzeichnen. Schon der erste Blick auf Eck, der, vom Pferde springend, auf ihn zutrat, hatte ihm gesagt, daß er den vor sich habe, der der letzte gewesen, der in der Schubert brechende Augen gesehen. Ecks Rock war nicht geschlossen, seine Weste und die Uhrkette waren sichtbar gewesen. Diese Uhrkette stellte ein etwa zentimeterbreites Band dar, darin kurze, feine, wie Fragezeichen gewundene Formen und winzige Kügelchen sich befanden. Die hübsche Kette war aus Gold. Es war eine kurze Kette, die man Chatelaine nennt, und an ihr baumelte ein Anhängsel. Es hatte die Form eines Vierblattes. Es bestand ebenfalls aus tiefgelbem, mattem Golde, und auf einem der vier Blätter lag ein Brillant als Tautropfen.
Bis zu dieser, Müller gar nicht mehr überraschenden Entdeckung war alles genau so verlaufen, wie er es sich schon bei seiner Abfahrt von Wien vorgestellt hatte.
Er war in Gesellschaft eines Buches gereist, für dessen Inhalt er vierundzwanzig Stunden vorher noch auffallend wenig Interesse gehabt hatte, den er aber jetzt während der Fahrt fast auswendig lernte, um bei einem etwaigen Gespräch sich keine Blöße in bezug auf die Technik des Schilaufens zu geben. Seine Fahrt währte übrigens nicht lange. Er stieg mit seiner fast leeren Reisetasche schon in Mürzzuschlag aus und begab sich dort in ein Touristenausstattungsgeschäft, das er im Sportanzug eines Schiläufers verließ, um mit dem nächsten, südwärts dampfenden Zug weiter zu fahren. Seine Reisetasche, die seine gewöhnliche Kleidung enthielt, hatte er nach Bruck aufgegeben. Am nächsten Vormittag simulierte er, nachdem er von einem sicheren Versteck aus Ecks Wegritt von Pachern beobachtet hatte, zu rechter Zeit einen Unfall und führte die erste Begegnung mit dem jungen Schloßherrn herbei.
Hätte es sich nicht so gefügt, so wäre Müller eben auf irgend eine andere Weise nach Pachern und mit Alfons v. Eck zusammengekommen. Das alles hatte ihm nicht die geringste Sorge gemacht, das gehörte zu seinem Beruf, zu diesem oft so schwierigen Beruf, der Männer mit scharfen Sinnen und geschultem Denken erfordert.
Nicht aber erfordert er Männer mit warmen Herzen und mit einem Bildungsgrad, der sie befähigt, alles Menschliche zu verstehen. Und weil Müller solch ein Mann war, fing jetzt, da alles wie am Schnürchen ging, da eigentlich nur noch zuzugreifen war, die Schwierigkeit für ihn an.
Denn der, den er verfolgte, dem er mit kaltem Blute nachgespürt hatte, der war ihm gütig entgegengekommen, wie einen Bruder hatte der ihn behandelt.
Ja, jetzt fingen für Müller erst die Schwierigkeiten seines Berufes an, und am liebsten hätte er Pachern wieder fluchtartig verlassen.