
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
In der Jul-Nacht eines Jahres, das kein Jornandes, kein Eugippius nennt, das kein Geschichtsforscher kennt, standen hinter den Toren des Castrum vindobonense die römischen Wachtposten.
In weiten Mänteln vermummt, mit beschneiten Helmen, froren die Südländer im Boreas, der über sie hinfuhr und sie in Schneewehen hüllte.
Lichtlose nordische Nacht lag auf dem Standlager. Als des Winters erster Schnee gefallen, waren auf den Bergwegen gegen Norden Patrouillen erwürgt worden, römische Reiter waren nicht mehr ins Lager zurückgekehrt, und unlängst wurde eine Kohorte durch Markomannen vernichtet.
Dumpfe Ruhe und Barbarenschreck waren im Römerlager, und jeder Krieger lauschte gegen Osten, von wannen Schauervolles kommen mochte.
Es kam.
In der Jul-Nacht flogen Raben krächzend von ihren Nestern im Donauwalde, und Wölfe duckten sich ins vereiste Gestrüpp, denn sie sahen lange, dunkle Reihen fellbekleideter Männer durch den Wald ziehen. Die Barbaren kamen.
Ihre Kolonnen schlichen wie schwarze Schlangen über das Eis der Donau und krochen zu den Mauern der Lagerfestung empor. Ungesehen in der Nacht, ungehört im Schneesturm.
Die Römer bemerkten sie erst, als das Tor bei dem Hafen in Splitter barst ... Da, wo die Via praetoria, die von der Mitte des freien Platzes ins Lager gegen Osten lief, die Festungsmauer an der Donau erreichte, bog ein schiefer, schmaler Weg im rechten Winkel gegen rechts hin davon ab. Zwischen zwei hohen Mauern senkte er sich zum Hafentor hinab.
Dorthin, wo später der Rote Turm stand. Auf diesem Ausfallswege hob der Kampf an. Schreien durchlief das Lager, Tubizene bliesen, im Schneesturm und in der Nacht wurde der schmale Weg zur Blutrinne.
Heute heißt er Seitenstettengasse.
Und da, wo die Markomannen über erschlagene Römer in das Lager drangen, da, wo die Via praetoria die Vernichtung in das Lager führte, ist heute die Judengasse. Heute sagen wir die Judengasse.
Ehemals war sie eine Gasse unter andern ihresgleichen, unter andern Judengassen ohne besonderen Namen; nur die Häuser in ihnen trugen die Namen ihrer Besitzer.
So war es, ehe um die Mitte des 14. Jahrhunderts das Ghetto entstand.
Mit den ältesten Beziehungen der Juden zu dem Orte, an dem Wien entstanden ist, haben sich Geschichtsschreiber wenig befaßt.
Den Römern waren die Juden zu gering, um sie, wenn es sich nicht um Geld, um Steuern und Tribut handelte, zu beachten, und im Mittelalter – auch später noch – bewirkte das Echo der vier Silben »Kreuziget ihn!«, daß jeder die Juden mied – der kein Geld brauchte.
Und die Juden selbst taten nichts, daß sich Kunst- und Literaturforscher um ihre Geschichte bemühten. Sie bauten keine Pyramiden, keine chinesische Mauer, sie dichteten keine Odyssee, kein Nibelungenlied, denn all derlei wäre vergänglicher gewesen als Geld, und selbst das größte Kulturwerk der Juden, ihre geschriebene Geschichte, die Bibel, die merkwürdigerweise alle Christenkinder des Erdteiles auswendig lernen mußten, reicht nicht in die Römerzeit und berichtet nichts über die Besiedlung Europas durch die Juden.
Ist es nicht wahrscheinlich, daß lange bevor die Römer und deutsche Halbwilde auf dem Boden Wiens wohnten, jüdische Händler auf unserem Grunde einen Stützpunkt für die phönizischen Abenteurerzüge auf dem Wege durch die Urwälder nach der Bernsteinküste schufen?
Gibt es nur eine Beweis-, nicht auch eine Indiziengeschichte? Freilich, zünftige Professoren würden die letztere nicht gelten lassen. Wohl gibt es auch eine lächerliche Karikatur der Historia mundi, wie sie in Hagens »Chronik« vorkommt. Da wird erzählt, daß ein Mann, Abraham von Theomanaria, geboren Anno 810 nach der »Sündflut«, in ein Land an der Donau kam, das nach einem Juden den Namen Judaysapta führte!
Wie lange immer die Juden in Wien gewesen, in der Judengasse waren sie schon lange vor den mehreren, nie völlig ausgeführten Vertreibungen, und auch nach der letzten im Jahre 1670.
Und seltsam – kein Haus in der alten Gasse ist älter als 200 Jahre, obwohl die Patina der meisten Häuser – hier ist sie nicht Edelrost – ihrem Aussehen nach tausendjährig sein könnte. Bauformen sind bessere Zeitmesser als der Verfall ...
Zwischen hohen, düsteren Mauern liegt der schmale Straßengrund in ewigem Dämmern; die Sonne des Mittags erreicht ihn nicht. Die Kühle der Keller liegt auf den Gehwegen und steigt zu den Stockwerken hinauf, und feiner antiquarischer Geruch, das Bukett alter, verschwitzter Kleider, die mit Essenzen und Mixturen geputzt worden, dringt aus finsteren Verkaufsläden und schwer vergitterten Fenstern in die Gasse.
Wo der verlängerte Fleischmarkt die Judengasse trifft, steht ein hohes Haus. Vor 90 Jahren mag sein Äußeres vornehm gewesen sein und zu grauen Seidenzylindern und zu Damenkleidern von Gros de Tour und Häubchen von Tüll Illusion gepaßt haben; heute erscheint das Haus als kokette Ruine. Der Mörtelverputz fehlt vom Erdgeschoß bis zum Dache, die Ziegel liegen bloß, und die Wände erinnern an anatomische Tafeln, die hautlose Muskelmenschen darstellen. Das Haus ist geschunden; über den Fenstern aber prangen in Halbkreisfeldern verschlungene Eichenkränze, wie wir sie auf alten Stammbuchblättern sehen, und stumme, steinerne Lyren, deren jede in der Gasse der Altkleiderhändler anmutet wie eine Toga neben Schwimmhosen.
Naive könnten erwarten, in der Judengasse Häuser nationaljüdischen Stils, alte Reste alter Zeiten in alttestamentarischer Bauweise, zu finden. Solche hat es nie gegeben, und die Häuser der Judengasse sind teils in der nichtssagenden Art alter Zinshäuser, teils im guten Alt-Wiener Stil erbaut.
An der linken Ecke des »Lazenhofes«, wie sonderbarerweise eine Sack-, beziehungsweise Seitengasse der Judengasse benannt wurde, weil sich dort einst der Lazenhof befand, steht ein interessantes Haus. Der Barockstil zeigt sein Alter an. Es steht in den besten Jahren. Aber die Cheopspyramide trägt weniger Schmutz und sieht jünger aus als seine Mauern.
Gewiß hat der persönliche Geschmack seines Besitzers das Haus in seinem heutigen Zustand gelassen, denn geputzt und hell getüncht würde es den Charakter der Judengasse verändern. Zwischen zwei Fenstern des zweiten Stockwerkes steht in einer seichten Nische eine lebensgroße Statue Unsrer lieben Frau. Das Steinbild und sein ganzes ornamentales Beiwerk ist tief dunkel wie die Wand, von der es sich unterscheidet. In steinerner Ruhe fleht die Madonna auf das Feilschen zu ihren Füßen nieder, und an den offenen, trüben Fenstern neben ihr sind viele alte Hosen, Spenser und Sakkos an den Fensterrahmen und Riegeln und vom Fensterbrett herabhängend als Schaustücke angebracht. Wer denkt da bei der Madonna im Grauen nicht an die »Madonna im Grünen«?
Die Fenster in der Judengasse scheinen nicht gemacht zu sein, damit sie Luft und Licht in Zimmer einlassen, sie sehen aus, als sollten sie das unheimlich kalte, tiefe Dunkel muffiger Räume auf die Straße schaffen und diese damit ausfüllen bis zu den Dächern.
Gewiß trifft ein Vorwurf wegen der Düsterheit der Gasse, die ja in der alten Bauart ihre Ursache hat, nicht die jüdischen Händler in den schwarzen Gewölben.
Wo der Durchbruch gegen die Rotenturmstraße Licht in die Judengasse wirft, stand ein uraltes Haus, der Dreifaltigkeitshof.
Schon im Jahre 1326 wurde geschrieben, daß ein Wiener Bürger in diesem Hause eine Kapelle vergrößern ließ, und im Jahre 1345 gehörte es der wohlangesehenen Bürgersfamilie der Chranesten. Obwohl das Haus oft renoviert worden ist, sprach sein Alter aus finstern Winkeln, blinzelten verschlafen Jahrhunderte aus seinen kleinen Fenstern, und der vielwinklige Hof mit dem holperigen Pflaster mutete an wie eine Rumpelkammer der Zeit, und es war, als habe diese Zeit alle Bauformen, sobald sie unmodern geworden waren, im Dreifaltigkeitshofe deponiert.
Wer durch den dämmerigen, nieder gewölbten Toreingang den Hof betrat, fühlte sich in einem Zwinger. Hohe Mauern mit kleinen Fenstern und großen fensterlosen Stellen umgaben den Hof, in dem unter dem einzigen Dachgiebel ein drei Stockwerke hoher Vorbau war.
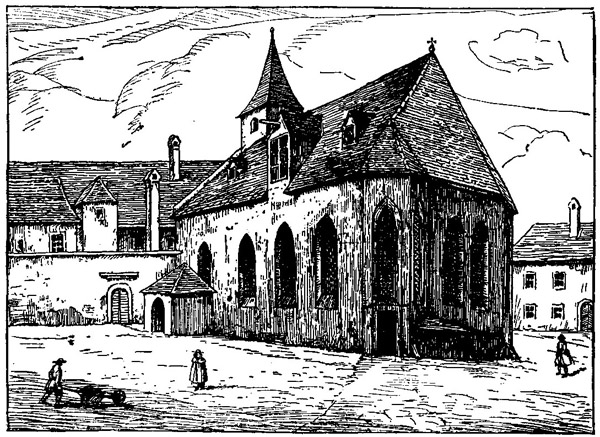
Er barg ehedem die Kapelle »Zur heiligen Dreifaltigkeit«, die dem Hause ihren Namen gab. Wie alt mag das Kammerhaus – so hieß früher dieser Hof – gewesen sein, wenn die Kapelle in ihm schon 1204 durch den Passauer Bischof Wolfker von St. Stephan eximiert wurde?
Die Namen Gottfrieds des Stadtkämmerers und seiner Frau Goldrun, dann Friedrichs des Streitbaren und König Otakars knüpfen sich an das Haus. Kaiser Josef II. hob 1780 die Kapelle auf. Die Verfallene, die Entweihte haben wir noch gesehen. Im Hofe, der Toreinfahrt gegenüber, war eine niedere, mit vier kleinen Tafeln verglaste Tür. Hinter ihr war Nacht und am Boden eine Falltür. Und dann kam eine Treppe, eng und finster, die abwärts führte, tief hinab, und wer sie tastend bis zu ihrem Grunde niederstieg, der trat in der Rotgasse in das Licht.
Im Gebiet der Judengasse, dem heutigen »Lazenhofe«, einer finsteren, schluchtähnlichen Seitengasse der Judengasse, stand das Haus des berühmten Doktors und Geschichtsforschers Wolfgang Laz.
Die Geschichte dieses einst mit Kunstschätzen angefüllten Hauses liegt offen vor uns, und weil sie klar ist, ist sie lang.
Da, wo in grauen Zeiten die niederen Judenhäuser standen, auf dem heutigen dunkeln Boden der Judengasse, mag eine Sage entstanden sein, deren Kern ein Nützlichkeitsgedanke ist und die in einer jüdischen Legendensammlung eines Rabbi aus Groß-Mostry zu lesen war. In der Judengemeinde waren in alten Zeiten, als die Ruprechtskirche noch vom Friedhofe umgeben war, zwei Männer wegen ihres Reichtums und ihrer Habsucht bekannt.
Der eine war Manasse ben Asoph. Ihm war Geheimes kund und Verborgenes offenbar, und was an Übeln der Leiber litt und wer Gebreste hatte, ging zu Manasse und wurde geheilt.
Der andere hieß Achitob und war Händler.
Als Manasse ben Asoph noch in Bologna war (wo er gelernt hatte, lebte und dort keinen Armen besucht und geheilt, sondern seine Wissenschaft nur um hohen Preis angewendet hatte), erschien ihm in einer Nacht ein Bote Eloas, der sprach: »Manasse ben Asoph! Mich schickt der Herr, der dir die Seele gegeben hat und der sie richten wird. Mich schickt Jehova, der deinen ersten Gedanken weiß und deinen letzten richten wird, der deine Wissenschaft und deine Habsucht kennt, und spricht zu dir: »Du sollst jedem, der dich bittet, von deiner Kunst und deiner Wissenschaft geben, was du kannst, und sollst keinen Lohn begehren. Und jeder, der dir vertraut, wird gesund werden, und du sollst leben, so lang du willst.«
Manasse dachte über das Gesicht nach. Ein beliebig langes Leben und der Ruhm, der beste Arzt im Erdkreis zu sein, der Gedanke erfüllte ihn mit Entzücken.
Aber auf Gold, auf Reichtum verzichten zu sollen? Manasse wollte die Worte des Engels erproben. Keiner der Kranken, die er behandelte, starb, und jeder gab ihm als Dank ein Geschenk.
Als Manasse nach Wien kam, siedelte er sich nahe bei St. Ruprecht an, und die Gaben derer, die er geheilt hatte, waren zahlreich und wertvoll, und er verbarg sie irgendwo in seinem Hause.
Seine Nachbarn meinten, daß er sie in Gruben in seinem Keller verwahre. Je reicher Manasse wurde, desto kleiner erschien ihm die Dankbarkeit der Geheilten, und desto größer wuchs seine Habgier.
In einer bösen Winternacht kam Achitob, der reiche Geizhals, zu ihm und begehrte Hilfe für sein krankes Töchterlein Hagar. Asoph wußte, daß Achitob sehr reich war, wußte aber auch, daß er noch geiziger als reich war, und Asoph meinte von Achitobs Dankbarkeit nichts erwarten zu dürfen; deshalb sagte er: »Es tut mir leid, daß deine Tochter krank ist. Hörst du aber den Regen an die Fenster klopfen? Ich fürchte die Nässe!« Da legte Achitob 20 Pfennig auf den Tisch und sagte: »Nimm das Geld und komm schnell!« Manasse sagte: »Nein, hörst du den Sturm? Ich fürchte ihn und bin alt.« Achitob legte noch 20 Pfennig auf den Tisch und sagte: »Manasse, ich bitte dich, höre mich. Hagar wird sterben, komm schnell.« Manasse antwortete: »Nein! Hörst du den Donner? Ich fürchte das Gewitter.« Da legte Achitob einen Säckel voll mit Pfennigen vor Manasse und sagte: »Manasse, höre mich! Hagar wird sterben, wenn du nicht zu ihr kommst. Höre meine Bitte! Nimm deinen Mantel und komme!« Manasse sagte: »Nein! Dein Kind ist sehr krank, aber du bist sehr reich. Ist dir deine Tochter nur einen Säckel Pfennige wert?« Da erbleichte Achitob, sein Geiz erstickte seine Tränen und verzweifelt schrie er: »So will ich beten, und Jehova wird billiger sein als du, den ich verfluche.« Achitob, der Geizige, ging zu beten, denn Gebet ist billiger als Geld. Da kam der Engel des Herrn zum zweiten Male zu Manasse. Sein Antlitz leuchtete wie Blitze, und seine Stimme war wie der Donner im Gebirge, und er sprach: »Manasse ben Asoph! Du hast keinen Preis von Achitob gefordert, aber du hast um Dankbarkeit gehandelt. Jehova wird des Geizigen Gebet nicht erhören, und Hagar wird sterben, und Achitob wird an ihrer Bahre sterben. Und du, Manasse, mußt sterben in dieser Nacht noch, und der Herr wird dich richten, ehe die Sonne aufgeht.« Da verschwand der Engel.
Manasse stieg tief hinab in das Gewölbe, in dem er seine Schätze verborgen hatte, und keiner der Juden sah ihn mehr und keiner fand seine Leiche und seinen Reichtum.
Diese Sage hat nicht Wiener Lokalfarbe, sie könnte in Sevilla und in Krakau entstanden sein und zeigt nur nationales Denken, nicht örtliche Anlehnung. – –
Von Schätzen im Erdenschoß der Judengasse handelt auch eine Begebenheit aus der letzten Jahrhundertwende.
Damals hob in der Judengasse ein Munkeln und Tuscheln und Kopfschütteln an, weil der und jener und viele bemerkten, daß der Hausmeister eines Hauses in der erwähnten Gasse über seine Verhältnisse lebte. Hundert Vermutungen wurden laut. Der Hausmeister blieb zugeknöpft und praßte weiter.
In einer Stunde starken Trinkens redete er in geheimnisvoller Weise von einem tiefen Keller und einem goldenen Ritter.
Da nahm Fama ihre Tuba und blies. Im Rathause hörte man etwas davon, an zuständiger Stelle nahm man die Sache nicht gleichgültig auf, und die zuständige Stelle war diesmal nicht das Steueramt, sondern das Historische Museum der Stadt Wien. Natürlich glaubte dort niemand an einen goldenen Ritter. Konnten aber nicht in der Judengasse Dinge von archäologischer Bedeutung, von lokalhistorischem Werte verschleppt worden sein?
Die Museumsleitung nahm mit dem maßgebenden Hausherrn Fühlung, und obwohl der Hausmeister seine größeren Ausgaben mit alten Ersparnissen erklärte, stiegen der Hausherr und der Direktor der städtischen Sammlungen Johann Probst mit Arbeitsleuten in den Keller hinunter, wo ein Suchen und Untersuchen begann. Das erste Kellerstockwerk bot nichts Bemerkenswertes. Man stieg in den zweiten, den tieferen Keller. Er war leer bis auf riesige Schleier von Spinnennetzen, die von der niederen Decke bis zum Boden hingen. Allerdings fanden die Suchenden, daß die Spinnenschleier an einer Stelle beseitigt worden waren. Und an dieser Stelle klang es hohl unter den Füßen. Sollte ein noch tieferer Keller vorhanden sein? Die Arbeiter begannen unter der behördlichen Leitung zu graben. Schon die ersten Krampenhiebe verrieten, daß man über einem Hohlraume stand. Nach wenigen Minuten fiel da, wo gegraben wurde, ein Stein in eine unbekannte Tiefe hinab. Sand rieselte ihm nach und ein schwarzes Loch lag zu Füßen der Arbeiter. – Da verbot der Hausherr weiteres Graben mit dem Hinweis auf die Gefährdung der Bausicherheit des Hauses. Was mag in dem tiefsten Keller verborgen sein? ... Manasses Reichtum gehört der Sage an.
Des Hausmeisters Schätze sind hypothetisch, aber wahrscheinlich ist, daß ein Kleinod irgendwo in einem verschütteten Brunnen der Judengasse liegt. Der Juden Richter Hirschl Mayer wurde im Jahre 1667 wegen großer Unterschleife verhaftet und für immer aus Wien verbannt. Als er lange danach als Greis fühlte, daß er sterben müsse, sprach er in der Verbannung brechenden Herzens davon, daß er 3000 Dukaten und eine Perlenschnur in einen Brunnen geworfen habe, ehe er in Wien in den Kerker geführt worden war.
Wäre es zu verwundern, wenn heutzutage nächtlicherweile in tiefen Kellern der Judengasse ein heimliches Graben und geheimes Suchen und Forschen und Bohren begänne? Und fänden die Sucher nichts andres im tiefsten Gewölbe: im verborgensten Winkel fänden sie die blaue Blume der Romantik ...