
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Er hieß Wilhelm Meier, aber er nannte sich Cosimir Amadaeus. Der Amadaeus war zu Mozarts Ehren da, das begriff ich; aber ich verstand den »Cosimir« nicht recht.
»Es ist ein Druckfehler,« sagte ich, »Sie meinen gewiß Casimir.«
Aber er protestierte energisch; er meinte gar nicht Casimir, sondern Cosimir – und das war zu Cosimas Ehren und ad majorem gloriam des Hauses Wahnfried.
Er war ein starker Fünfziger, aber die grauen Locken waren schwarz gefärbt. Er hatte viele Locken; etwas unregelmäßig freilich – es waren überall dazwischen kleine kahle Stellen. Seine Finger waren auch schwarz, weil er sich immer in die Locken greifen mußte und weil die abfärbten.
Er war der Vertreter des musikalischen Deutschlands im Auslande.
Ich kannte ihn schon seit manchem Jahr. Ich traf ihn einmal in Paraguay, dann in Freemantle in Westaustralien. Und jetzt wieder in Indien.
Wie er mich sah, flog er auf mich zu. Wie ein Fußball, in raschen, scharfen Stößen. Denn Cosimir Amadaeus ist klein und sehr rund; dabei hat er eine außerordentliche Muskelkraft, in den Fingern nicht weniger wie in den Waden. Ich wußte natürlich, was er wollte – – ein Konzert. Aber ich kannte das; ich hatte mich früher einmal, in Brasilien, breitschlagen lassen, in einem seiner Konzerte mitzuwirken – vor Niggern und Indios in allen Schattenfarben!
Ich dankte; ich bliebe nur einen Tag noch in der Stadt, sagte ich. Und er meinte, das mache gar nichts, wir würden gleich am nächsten Abend konzertieren. Er habe ein großartiges Publikum, nur Europäer. Aber ich blieb hart: stockheiser sei ich. – Oh, das macht erst recht nichts – kein Mensch würde es merken.
Er redete zwei Stunden auf mich ein und aß dabei mein Abendessen und trank meinen Whisky. Am nächsten Morgen war er wieder im Hotel, redete weiter und verzehrte mein Frühstück. Ich mußte ihm schließlich zehn Eintrittskarten, zu fünf Rupien eine, abkaufen, und er erklärte, das sei nur ein sehr schäbiger Ersatz. Ich war sehr geschmeichelt und dankte ihm.
Schon zum Tiffin war er wieder da, und nun ließ er mich nicht mehr aus; er wollte sicher sein, daß ich wenigstens als Zuhörer dabei sein sollte. Er probierte meinen Frack – aber der paßte ihm Gott sei Dank ganz und gar nicht. Cosimir bedauerte das sehr – vielleicht könne man ihn noch umändern lassen, meinte er –
* * *
Der Hotelsaal war voll, das ist wahr. Aber – Europäer waren nicht da, nur Halfcasts und Natives. Ich wollte mich drücken in der Tür; ich behauptete, daß ich meinen Malariaanfall herannahen fühlte. Aber das half gar nichts; er schleppte mich an die Bar und wir tranken acht Whiskys – ich einen und er sieben. Das sei das Beste gegen Fieber, erklärte Cosimir, und zugleich das Beste, um gut zu spielen. Dann erwischte er den Manager des Hotels – mit dem zusammen trank er noch sechs Whiskys.
Auf dem Programm stand: »Herr« Cosimir Amadaeus. Er hat mir früher einmal auseinandergesetzt, wozu das »Herr« gut ist: es ist das unfehlbare Zeugnis für das musikalische Genie. Unsere Diplomaten im Ausland nennen sich nicht mehr Graf und Freiherr, sondern Mons. le Comte und Mons. le Baron, unsere jungen Kaufleute aber heißen ganz gewiß Mister Lehmann und Mister Müller. Die Ritter von der Palette, die ich da draußen traf, waren zu Don Eduardos und Don Gustavos geworden – – nur der Musiker hält Deutschlands Fahne hoch und bleibt der »Herr«. Und – was noch seltsamer ist – auch der Fremde wird ihn überall »Herr« anreden, nie ihm den Titel seiner Sprache: Mister oder Don, Senhor oder Monsieur geben. Denn für den Musiker ist der »Herr« ein Ehrentitel: er beweist, daß sein Träger aus Deutschland kommt, dem großen Mutterlande aller Musik. Das weiß alle Welt. Der »Mister« Amadaeus kann irgendein Nichtskönner sein – der »Herr« Meier aber ist unter allen Umständen ein genialer Künstler.
Das Konzert begann. Ein anglo-indischer Gesangverein – an dem alles indisch und gar nichts englisch war – sang: »Sailing, sailing«; dann verabfolgte eine sehr dunkle Lady: »Home, sweet home« und ein gestreifter Jüngling das unvermeidliche: »Suwanee river«, das er einen »Comic song« nannte. Und dann kam Herr Cosimir Amadaeus –
Er spielte – – aber natürlich! – eine Lisztsche Ungarische Rhapsodie, dann ein Chopinsches Nocturne Und – natürlich! – Saint-Saëns' Danse Macabre – –
Herr Cosimir war betrunken, das läßt sich nicht leugnen. Er spielte abscheulich; die zweite Ungarische wurde zu einer Cosimirschen Improvisation und die Gondoliera, die er, wie gewöhnlich, zugab, schien viel mehr von Sousa als von Liszt zu stammen. Cosimir schlug daneben, daß es eine Lust war, nahm zwei Tasten auf einmal und verpaßte konsequent den Baß.
Aber das alles machte gar nichts. Die schwarzen Ladies und Gentlemen sahen wohl, wie Herr Cosimir auf seinem Stuhle hin- und herrutschte, sie begriffen ganz gut, daß er zuviel getrunken hatte. Um so mehr aber bewunderten sie seine Kunst. Sie sahen nur auf seine Hände, und die tanzten und hupften höchst vergnüglich auf der Klaviatur herum. Sie alle hatten zu Hause einen Phonograph, manche ein Pianola, der eine und andere sogar ein Orchestrion. Nun, was diese Instrumente konnten – das machte hier ein Mensch! Ein einzelner Mensch – war das nicht bewundernswert? Und er machte es, obwohl er augenscheinlich stark betrunken war. Gipfel des Genies!
Allerdings – er war auch »Herr« Cosimir.
Nach dem Konzert gab es ein kaltes Büfett, das irgendein brauner Bewunderer von Cosimirs Kunst gestiftet hatte. Der Virtuose aß ungeheuer viel; alles, was übrig blieb, ließ er sich sorgsam in Papier wickeln und nahm es mit nach Hause –
* * *
Solange ich in der Stadt blieb, erschien Cosimir regelmäßig bei mir zum Frühstück; zum Tiffin und zum Dinner kam er sehr selten; nur, wenn er gerade nicht irgendwo eingeladen war. Es war einer seiner Grundsätze, niemals etwas für Essen und Trinken auszugeben. Und Einladungen hatte er natürlich in Hülle und Fülle, da er seelenruhig in alle Häuser von Eingeborenen ging – wenn diese nur ein wenig Geld hatten. Er nannte das »ein modern denkender Mensch sein«; jeder kleine Bürger zu Hause, der von seiner Ofenbank aus auf die Gleichberechtigung aller Menschenrassen schwört, hätte seine helle Freude an ihm gehabt. Die Europäer freilich, die dort waren, waren weniger entzückt von ihm.
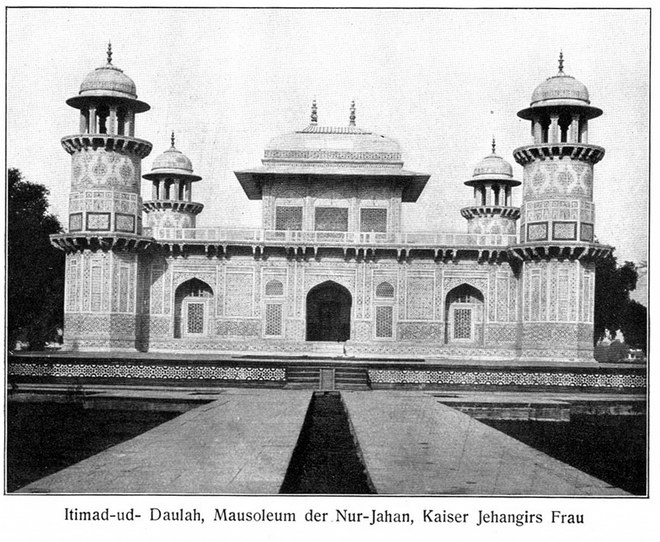
Aber wenn ihm einer ins Gewissen redete: »Schämst du dich nicht?« – dann fuhr sich Cosimir durch die gefärbten Locken und sagte: »Die Kunst verbindet alle Menschen.« Dann war er der weltfremde Künstler, der im Traumland lebt und nichts weiß von dem Trachten und Streben der bösen Menschen.
Jede Stadt war ihm gut für ein paar Monate. Er gab in dieser Zeit ein halbes Dutzend Konzerte, in Hotels und bei Privaten – dann ebensoviel in der Nachbarschaft. Stets: unter liebenswürdiger »Mitwirkung« von Mrs. X und Mr. Y –, das waren die Leute, die ihm das Haus voll machen mußten. Dazu gab er Stunden, nicht unter fünf Rupien – in wenigen Wochen konnten seine braunen Schüler und Schülerinnen alle Kunst Beethovens lernen. Seine Stunden legte er meist vor irgendeine Mahlzeit – er kam dann spät und blieb dafür lange: ein ganz kleines Weilchen am Klavier und eine gute Zeit am gedeckten Tisch.
Seine Taktik war immer dieselbe. Kam er in eine neue Stadt, so suchte er zuerst die Deutschen auf; dann gab er ein Konzert im »Deutschen Klub«. Und bei diesem Konzert war er nie betrunken. Er spielte seine besten Sachen, nahm sich tüchtig zusammen und gab recht Anerkennenswertes. Und wenn er auch kein Paderewski war, kein Sauer und kein Feruccio Busoni, so war er doch sicher etwas Besonderes für die ausgehungerten Ohren der Europäer. Man nahm ihn gut auf und war froh, daß er da war. Dann gab er ein öffentliches Konzert – im Hotel. Dahin kamen auch die Eingeborenen – und ihre Bewunderung war grenzenlos. Für sie war »Herr« Cosimir stets der Inbegriff aller Musik. So saß er im Sattel in dieser Stadt – für acht bis zehn Wochen.
Als er wegging, schrieben die »Independent Times«: »Ein schwerer Verlust wird morgen unsere Stadt betreffen: Herr Cosimir Amadaeus wird uns wieder verlassen. Mit ihm zog der Frühling in unsere Hütten – nun er scheidet, wird trüber Nebel uns umfangen. Nie werden wir seine heilige Kunst vergessen; nur ein Wunsch haftet in unseren Seelen: möge der auserwählte Künstler wiederkommen! Herr Amadaeus folgt einer dringenden Einladung des Vizekönigs nach Kalkutta, von dort aus wird er das »Heilige Land« bereisen und darauf in den Hauptstädten Europas seine erhabene Kunst zeigen. Vale!«
Die letzten Zeilen stammten natürlich von Cosimir, sie kehrten in fast allen Abschiedsrufen der Nativepresse wieder. Es waren natürlich nur fromme Wünsche; nie hatte Cosimir eine Einladung des Vizekönigs erhalten, und vor den »Hauptstädten Europas« wird er sich schwer hüten. Nur das »Heilige Land« – das ist wohl denkbar! Aber das alles macht einen ausgezeichneten Eindruck, und in der nächsten Stadt wird Cosimir den Boden wohlvorbereitet finden.
* * *
Er hieß Wilhelm Meier, und er nannte sich Herr Cosimir Amadaeus. Aber er ist nicht ein einzelner – er ist der Typ einer ganzen Gattung. Er heißt auch Schulze und Bauer und Schmidt, und man trifft ihn überall in der Welt.