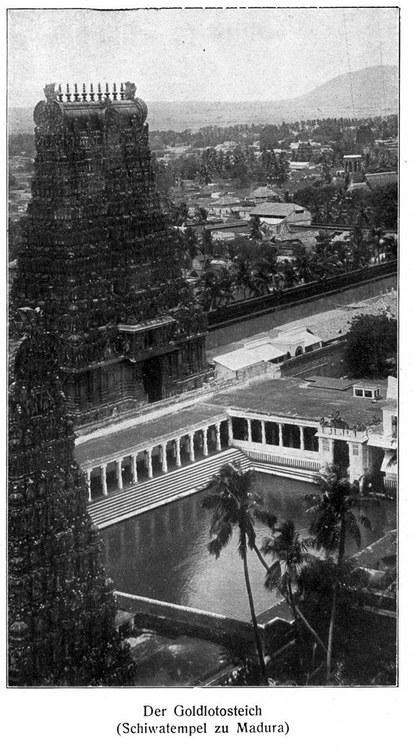|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Ich habe, als ich vor einigen Monaten von meiner Indienreise zurückkehrte, in einer ganzen Reihe deutscher Städte Vorträge gehalten. Mit Lichtbildern natürlich – ohne die geht's ja nicht mehr. Ich sagte zu Beginn meines Vortrages – es war immer derselbe, und er hing mir bald genug zum Halse heraus – den verehrten Damen und Herren, daß ich durchaus nicht deshalb mich auf das Podium stelle, weil ich mich so gerne reden höre, auch nicht deshalb, weil ich der Ansicht sei, nun endlich den mystisch-magischen Schleier, der über dem Wunderlande Indien liege, lüften zu können. Sondern daß ich das nur aus dem recht prosaischen Grunde tue, weil mir dieses Geplauder Geld eintrage ...
Dann lachten die Leute. Sie hielten das für einen guten Witz. Wenn sie nur wüßten, wie bitter ernst es mir war! Ich benutzte eben, recht kaufmännisch und gemein, die günstige Kombination, daß gerade der deutsche Kronprinz auch in Indien herumreiste, und daß also Indien »aktuell« war. Oder vielmehr: die Konzertdirektion, die mich für meine Vortragsreise engagierte, benutzte diese Aktualität – ich selbst kann nicht einmal dieses Verdienst für mich in Anspruch nehmen. Ich tat eigentlich nichts – als für das Geld, das ich bekam, mich ein paar Wochen lang Abend für Abend zu prostituieren.
Mein Herr Konzertdirektor, Gott segne ihn, war damit recht zufrieden, weil es ihm Geld einbrachte, und mein Herr Verleger, Gott schütze ihn gleichfalls, war nicht minder zufrieden, weil ja doch diese Vortragsreise notwendigerweise auch für meine Bücher ein wenig Reklame machen mußte.
Was mich betrifft, so war ich natürlich auch zufrieden – aber ganz selbstverständlich! Ich halte es zwar für eine Infamie, daß ein schaffender Künstler gezwungen ist, um das Leben, das für seine Kunst das einzig mögliche ist, führen zu können, sich öffentlich zur Schau zu stellen. Ich bin auch der Meinung, daß es eine Gemeinheit ist, wenn ein Dichter jahraus, jahrein Zeitungsartikel schreiben muß, in denen er naturgemäß von aller Kunst sich möglichst weit fernhalten soll.
Ich empfinde beides als regelrechte Prostitution. Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen dem Weib, das gezwungen ist, seinen Leib dem »Publikum« zu verkaufen, und dem Künstler, der eben diesem Publikum in den Blättern oder auf den Brettern fürs Geld Späße vormachen muß.
Und doch bin ich, und durchaus bewußt, noch dankbar genug für dieses Geld, das ich mit solcher Prostitution erwerbe, bin dankbar den Redakteuren, die meine Aufsätze veröffentlichen, dankbar dem Konzertagenten, der mich auf Tournee schickt, dankbar endlich dem Publikum, das meine Aufsätze liest und meine Vorträge besucht.
Denn nur dadurch ist es mir möglich gemacht, die Reisen zu machen, die Lande zu sehen, das Leben zu führen, aus dem meine Kunst Wurzel schlägt. Und mit dieser Kunst mache ich kein Geschäft. Ich verschenke sie. Was mir meine Kunst einträgt, das ist so lächerlich gering, daß ich kaum meine Zigaretten damit zahlen kann ...
Ich tröste mich. Wie mir ergeht es ja allen andern deutschen Dichtern. Die einen hungern. Die andern sind zufällig selbst reich oder haben reiche Frauen. Die dritten quälen sich nebenher in irgendeinem bürgerlichen Berufe. Und die übrigen prostituieren sich, so oder so, wie ich es tue.
Das deutsche Volk beachtet uns nicht? Aber gewiß beachtet es uns. Jeder Redakteur tut für uns, was er nur kann. Man schreibt über uns, man erwähnt uns überall. Und aus dem Publikum kommen sehnsüchtige Briefe, man quält uns um Autogramme, beruft uns in alle Wohltätigkeitskomitees. Man übersetzt uns auch, macht uns berühmt in zwei Dutzend Sprachen. Wenn wir sterben, widmet man uns lange Nachrufe, stiftet dem einen und andern gar ein steinernes Bild. (Mir freilich gewiß nicht – ich bin in Düsseldorf geboren!)
Aber man denkt nicht daran, unser Leben menschenwürdig zu machen. Man gibt freilich Geld genug aus für Bücher – aber nur für Unterhaltungslektüre. Unsere Bücher – borgt man sich aus oder bekommt man als Freiexemplare.
* * *
Ich merke: ich bin wieder zurück im lieben Vaterland; bin recht weit abgekommen von – Indien. Draußen nämlich bin ich – immer mit dem Gelde, das ich zu Hause so jämmerlich sauer zusammenscharrte, draußen bin ich ein Sahib. Bin ein großer Herr. Gehe meinen Weg, meinen ureigenen Weg, bin mein eigener Herr und lebe mein Leben. Bin nicht mehr Zeitungskuli und vagierender Vortragsreisender, wie zu Hause. Ich werde mir freilich den Luxus nie gestatten können, ein »eigen Heim zu haben und eine Familie zu gründen«. Aber ich darf mir dafür erlauben, Träume zu träumen, die kein anderer vor mir je zu träumen wagte ...
* * *
Dies Buch, über alles verehrter Leser, enthält gewiß nicht solche Träume. Die müssen Sie schon in meinen andern Büchern suchen, in den Büchern, in denen ich Sie gar nicht verehre, in denen Sie mir, verzeihen Sie, ganz ungeheuer gleichgültig sind. Diese Blätter aber sind eigens für Sie geschrieben, sind ein Gemisch aus meinen Zeitungsaufsätzen und meinen Vorträgen. Und darum muß ich hier höflich sein: bitte, treten Sie ein, verehrtester Herr, allerreizendste Dame, bitte, kaufen Sie, bitte, lesen Sie! – Indien! Wunderland! Höchst aktuell! Der Kronprinz war auch da! – Und dann die Bilderchen! Und das alles nur für fünf Mark fünfzig! Rein geschenkt! Hereinspaziert, meine Herrschaften!
* * *
Was mir Indien ist – steht freilich nicht auf diesen Seiten. Wen das interessiert, der mag es vielleicht später einmal lesen, in irgendeinem höchst absurden Roman, irgendeiner wilden, allzu seltsamen Geschichte – die gute Bürger nicht lesen werden, weil sie ihnen die vollverdiente Nachtruhe rauben würden.
Und trotzdem – auch ihr mögt diese Blätter lesen, ihr paar Menschen, die ihr mich liebt, und die ich nicht kenne. Denn seht: niemand kann aus seiner Haut heraus.
– Ich habe einmal versucht, einen Kitschroman zu schreiben – natürlich um Geld zu verdienen – so einen regelrechten, jämmerlich abgeschmackten Klischeezeitungsroman. So einen, wie sie unsere »beliebten Romanschriftsteller« mit Leichtigkeit in ein paar Wochen herunter diktieren. Aber es ging nicht. Ging absolut nicht. Ich mühte mich und quälte mich ab – völlig vergebens. Man muß eben bleiben bei seinem Leisten. Und so, glaube ich, steht auch in diesem Buche manches, das meine Art trägt – trotz der Zwangsjacke des »Feuilletons«. Manches Bild, das Sie in keinem »Indienbuche« finden werden, manche kleine Silhouette, die ich allein sah: mit meinen Augen.
* * *
Ums Himmels willen, wenn Sie nach Indien reisen, Verehrteste, begnügen Sie sich nicht mit diesem Buche! Nehmen Sie Murray. Der ist wirklich ganz unentbehrlich. Ich habe, und nicht ohne Absicht, nicht einmal irgendeinen »Reiseweg« in diesen Blättern durchgehalten. Ich plaudere jetzt von Ceylons versunkenen Städten und gleich darauf von den hübschen Nautchgirls, jetzt von allerlei sonderbaren Heiligen und dann wieder von herrlichen Tempeln in Agra oder Benares.
Ich will hier keine Ordnung, verehrte Leser, will weder Ihre ethnographischen noch Ihre geographischen, weder Ihre religionsphilosophischen, noch Ihre kunsthistorischen Kenntnisse bereichern. Ich will weiter nichts, als Ihnen ein paar Ausschnitte, ein paar rasche Bilder geben, die immerhin darnach angetan sein mögen, Sie, Hochverehrte, einen raschen Blick in das merkwürdige Wunderland tun zu lassen, das wir Indien nennen. Und will Ihnen ein wenig Lust machen zu reisen ...
Wien, im April 1911.