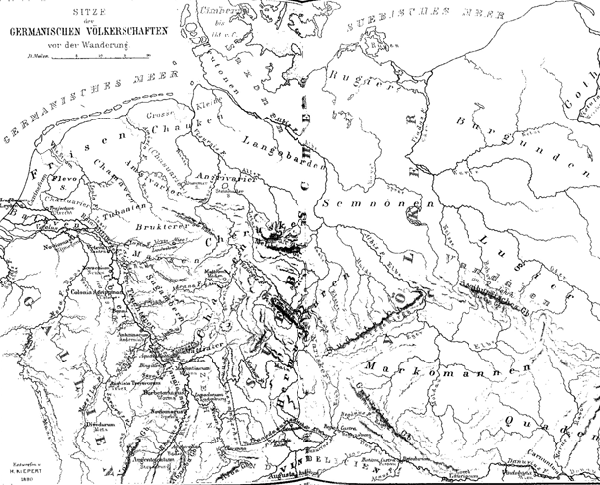|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Unzweifelhaft war die Geschlechterverbindung älteste, aber nur vorgeschichtliche Grundlage Vergl. Wilda, Strafrecht der Germanen. Halle 1842 – v. Sybel, Entstehung des deutschen Königtums. Frankfurt a. M. 1848. – Dahn, Fehdegang und Rechtsgang der Germanen. Bausteine II. Berlin 1880. (Ursprünglich unstreitig die reine natürliche Geschlechtsverbindung. Daß diese späterhin auch, durch die Aufnahme Fremder – fingierter Gentilen – in das Geschlecht, sich erweitern konnte, ist nicht nachweisbar. D.) der germanischen Verfassung.
So entschieden dies der lange Zeit herrschenden Ansicht, daß der Germanen älteste Volkseinteilung auf räumlichen Verbänden, Markgenossenschaften, Gauen usw. beruht habe, widerspricht, so vermittelt doch die naturgemäße Entwicklung des Volkslebens beide. Man gibt zu v. Sybel, S. 31., daß die Geschlechtsverbände nach der Ansiedlung im römischen Reiche unpraktisch wurden, diese Verfassung daher in der merovingischen Zeit in allen Punkten der räumlichen und monarchischen gewichen sei: aber es steht fest, daß dies keineswegs sprungweise, sondern ganz allmählich und daß es schon viel früher geschehen sei.
Schon im ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung finden wir häufige Umsiedlungen, Auswanderungen, Eroberungen durch einzelne Völker oder Völkerteile; schon vom Ende des zweiten an beginnt aber jene großartige Völkerbewegung, die sich, aus Ost und Nord vom baltischen bis zum schwarzen Meere heranwogend, zunächst an der damals noch unerschütterlichen Grenze Roms bricht und vorübergehend ablagert, immer aber in kriegerischer Unruhe verharrt, Raubzüge und Ausbreitungsversuche nach jeglicher Richtung aussendet. Zu gleicher Zeit entstehen im Innern überall neue Namen für neue Gruppen, Mischungen und Bündnisse, aber auch Trennungen der alten Genossenschaften: manchmal fließen auch bloße Gefolge verschiedenartiger Völker in monarchische Einheit, wenigstens vorübergehend, zusammen.
Wer kann in solchem Treiben Bewahrung der Geschlechtsverfassung in alter Reinheit für möglich halten? (Schon bei der dauernden Ansiedelung trat an ihre Stelle der Gemeindeverband, ohne freilich sehr wichtige Nachwirkungen des Sippeverbandes auszuschließen. D.)
Die neue, durch Bedürfnis gebotene Gliederung mußte, wenn auch der alten sich möglichst anschließend, derselben neue Elemente zuführen; der räumliche Verband ward nunmehr, wie vormals der geschlechtliche, der naturgemäße, daher der vorherrschende, in welchem sich jener früher oder später endlich ganz verlor. Vergl. v. Sybel über die Gegyldan König Alfreds und die Vicini Chilperichs. Gerade übrigens, daß die Geschlechterverfassung in isolierten, vom Strome der Umwälzung und Neugestaltung nicht berührten Stämmen und Gegenden, z. B. in den Ditmarschen, sich länger erhielt, erklärt ihren Untergang unter solchen Verhältnissen, wie sie bei den übrigen Germanen stattfanden.
In der Geschlechtsverfassung nun wurzelte ursprünglich auch die Gliederung der Germanen in Dorfgemeinden (Vicus, Villa), Centenen oder Hunderte und Völkerschaften (civitas, gens). Schwankend ist die Bedeutung von: »pagi« in den Quellen: häufig, bei Tacitus mindestens, Gaue, Bezirke, in welche die Völkerschaft zerfiel: aus ihnen sind die »Gaue« der karolingischen Zeit meist entstanden. Kein Zweifel aber besteht darüber, daß auch Verbindungen mehrerer Einzelvölker, z. B. der Chauken und Cherusker, zu einer größeren Gemeinheit, sei es als freier Bund oder durch faktische Übermacht eines derselben, schon damals vorkamen.
Der Geist, der diese Formen beseelte, war durch und durch der der persönlichen Freiheit, der Selbstregierung im vollsten Sinne des Worts; das Gemein- oder Staatsleben war im engsten Kreise, höchstens noch dem des Gaues, am vollständigsten entwickelt, weiter hinauf loser, die Zentralgewalt am schwächsten.
Daher Sorglosigkeit für das Allgemeine bei höchster Vorliebe für das lokale und persönliche Interesse, Widerwille gegen jedes Eingreifen der Staatsgewalt über das Unerläßlichste hinaus als ein Hauptcharakterzug erscheint.
Landesherrschaft im späteren, Königtum im modernen Sinne war damit unvereinbar. Könige wie Grafen, wo und wie sie bestanden, waren stets nur Organe des Gemeindewillens, weshalb ihnen denn auch keinerlei Strafgewalt zustand, welche vielmehr nur die Volksversammlung hatte: in einzelnen Fällen war der Priester die Strafe zu vollstrecken berechtigt, nicht als eigentliche Pön oder auf Geheiß des Feldherrn, sondern gewissermaßen als Gebot der Gottheit. (Tac. G. c. 7.) Die von Tacitus den Priestern beigelegte Strafgewalt widerspricht allen sonstigen Berichten Cäsars (de bello gall. VI, 23), wonach (außer der Volksversammlung) nur dem Kriegsbefehlshaber das Recht über Leben und Tod zustand. Tacitus verwechselt Urteilsfindung und Urteilsvollstreckung: (nur letztere kam (manchmal) den Priestern zu. D.). Daß übrigens der Volksversammlung (concilio) volle Strafgewalt, selbst für Todesstrafe zustand, sagt Tacitus c. 12 ausdrücklich. Obwohl dessen Ausdruck übrigens ebensowohl auf die Versammlung des Gaues als der Centene zu beziehen ist, so war doch letztere nur bis zu einer gewissen Grenze strafberechtigt.
Ebenso tief aber wie die Volksfreiheit und der Stolz hierauf wurzelte in den Gemütern auch freie Ehrfurcht für Adel und Verdienst. Solcher Auszeichnung gebührte das erste Wort in der Volksversammlung: aber die Häupter leiteten mehr durch Überredung, als durch Befehl, mehr durch Persönlichkeit, als durch Amtsgewalt.
Könige aus andern Geschlechtern als den durch Adel und Herkommen dazu berufenen zu nehmen, widerstritt des Volkes Gefühle. Die Cherusker ziehen Italicus, den Fremden, den Römling, seines Geschlechtes halber, allen Eingeborenen vor. Aber keine Erblichkeit der Würde im modernen Sinne bestand: Bestätigung der Volksgemeinde gab immer die Vollmacht: stets fand Wahl unter desselben Geschlechtsgenossen statt. (Hauptwerk über den germanischen Adel: Konrad (von) Maurer, über den ältesten Adel der germanischen Stämme. München 1849. Der Adel (nobiles, nobilitas) hatte ein höheres Wehrgeld und das nächste (moralische) Anrecht auf die Krone nach dem königlichen Geschlecht. Tatsächlich wurden wohl auch in den sogenannten republikanischen Staaten die Grafen meist aus dem Adel gewählt, wo tatsächlich meist, aber nicht immer, die Gefolgsherren Edle waren; principes ist der Ausdruck des Tacitus nicht für den Adel, sondern für Gaugrafen, Gaukönige und Gefolgsherren. D.) Kriegsbefehl, Richtertum und priesterliche Funktionen vereinigten sich ursprünglich in derselben Person. Besondere Herzöge, für deren Wahl die Kriegstüchtigkeit entschied, kamen nur ausnahmsweise, namentlich bei Bündnissen vieler Gaue einer Völkerschaft oder gar mehrerer Völkerschaften vor. Beispiele dafür sind Armin a. 9, Brinno, Civilis a. 68. 69, Chnodomar a. 357.
Die Abteilung der Geschäfte war einfach, die Gemeindeversammlung zugleich Gerichtshof, auch jede feierlicher Anerkennung und Beglaubigung bedürfende Handlung, wie Wehrhaftmachung, Verlobung, Eigentumsübertragung, vor sie gehörig. An die Versammlung der ganzen Völkerschaft gelangten nur Angelegenheiten der Völkerschaft und Streitigkeiten mehrerer Gaue untereinander. Geringere Angelegenheiten wurden von den Gaukönigen und Gaugrafen und den Vorstehern der Centenen allein erledigt. Wichtigeres beschloß überall die Gemeinde.
Der Einfluß des Grundbesitzes auf Volksrecht und höhere Geltung ist bestritten. Unstreitig war seit dem Übergang zu seßhaftem Ackerbau der Besitz von Sondereigen Bedingung des Vollbürgerrechts. Daß edlere Geschlechter zu immer größerem Grundbesitz gelangten und Reichtum das Ansehen erhöhte, kann, sobald Sondereigen einmal eingeführt war, der Natur der Sache und der Geschichte der Folgezeit nach, nicht bezweifelt werden.
Also entwickelte sich aus der Geschlechtsverbindung heraus die germanische Verfassung.
Persönliche Freiheit und Selbstregierung über alles, eine noch auf wenige Zwecke gerichtete, mit wenigen Mitteln ausgerüstete Staatsgewalt: nur die Sitte räumte einzelnen Geschlechtern höheres Ansehen freiwillig ein. Kein auf eigenem Recht beruhendes, vom Volke sich trennendes oder gar diesem entgegentretendes monarchisches oder aristokratisches Prinzip, vielmehr dieses alles unmittelbar aus dem Volke großgewachsen, alle Kraft nur aus ihm saugend.
Einfach und naturgemäß war diese Verfassung: daher auch der anderer kräftiger und edler Völker ähnlich, wie dieselbe bei solchen, welche höhere Kultur nicht erreicht haben, z. B. im Kaukasus, einem Teile von Persien, Hochindien und Arabien, in manchen Grundzügen wenigstens, heute noch besteht.
Wo eines Volkes Trieb und Sitte unverrückt sehr stark auf ein Ziel hindrängt, da muß notwendig auch Kunde der Mittel, Geschick der Ausführung dafür vorhanden sein. So bei den Germanen für den Krieg.
Dieser aber erschien in doppelter Gestalt: Volkskrieg, als Nationalaufgebot für Gemeinzwecke, und Raub- oder Kriegszüge einzelner Scharen für Sonderzwecke, teils gegen äußere Feinde, Kelten, Römer, Slaven, auch gegen Germanen feindlicher Stämme oder Gaue, teils im Solde und Dienste fremder Völker. (Caes. VI, 23. Tac. Germ. c. 14.)
Letztere, namentlich jene Raubzüge (latrocinia) außerhalb der Grenze (und nie gegen Stämme, mit welchen der Heimatstaat des Gefolgsherren in Frieden und Freundschaft lebte, D.), meist gewiß Überfälle, erforderten kundige, kühne Anlage des Führers, unbedingten Gehorsam der Truppe. Beides findet sich auch in der Räuberbande. Aber der Adel des Volkscharakters adelte auch dies Verhältnis. Eine freie Kampfgenossenschaft bildete sich unter einem Haupte: gleich heilig waren die Pflichten beider Teile, des Führers gegen sein Gefolge und dieses gegen ersteren. Kriegsrosse, Waffen, Nahrung, so weit nötig, gibt der Führer. Als schimpflich gilt, wenn er an Heldentum von den Genossen übertroffen wird, schimpflich, wenn letztere gegen ihn zurückbleiben. Höchste Schmach aber ist es für den Genossen, aus der Schlacht, in welcher der Gefolgsherr fiel, überlebend heimzukehren. Nicht bloß einfache, – selbstverleugnende Treue für jenen ist der Gefolgen Gelübde. So schildert Tacitus die Gefolgschaft: der Ausdruck, weil das schöne Bild seine Seele ergriff, vielleicht etwas zu blühend, das Wesen sicherlich scharf getroffen.
Daß das Gefolgswesen dem Gemeinwesen untergeordnet war, ist nicht zu bezweifeln; auch im Frieden wurden Gefolgschaften gehalten.
Gefolgsherr konnte der Natur der Sache nach nur der Vermögendere sein: der freien Ehrfurcht der Germanen gegen die edelsten Geschlechter entsprach überdies die Neigung, sich vorzugsweise dem Sprößling eines solchen anzuschließen. Zu behaupten indes, daß niemals ein nicht Edler durch Verdienste und Vermögen zum Gefolgsführer sich habe aufschwingen können, halten wir für entschieden irrig. Daß ferner alle Gaukönige, wohl auch viele Grafen, eine Gefolgschaft hatten, ist nicht zu bezweifeln, daß aber lediglich das Amt, nicht auch Besitz und Geburt die Möglichkeit dazu gewährt habe, scheint uns der Natur der Sache zu widersprechen.
Sicherlich unwahr ist es, daß alle späteren Eroberungen nur durch Gefolge bewirkt wurden, höchst wahrscheinlich aber, daß letztere, wenn auch nicht ohne Ausnahme, doch in der Regel dabei mitgewirkt, in vielen Fällen den ersten Anstoß gegeben haben.
So viel vom öffentlichen Leben der Germanen.
Wir schließen diesen Abschnitt mit kurzer Zusammenstellung des Gesamtbildes.
Einfach im höchsten Grade, wild, zum Teil grausam, waren die Germanen, für das Notwendige voll Geschick.
Beschränkt in diesem Sinne, aber kraftvoll ihre beginnende herbe Kultur: ungleich höher, den Keim großer Zukunft in sich tragend, ihre Kulturfähigkeit. Reger Sinn für höhere Bildung, vor allem in Kriegs- und Staatskunst.
Hang zur Untätigkeit, bei Haß friedlicher Ruhe; Krieg das Spiel ihrer Phantasie (und Hauptinhalt ihrer Volksdichtung D.); Erwerb durch Kampf ihres Strebens stolzestes Ziel.
Trunk, Spiel, jähe Hitze Nationalfehler; auch durch fremdes Gold leicht verführbar, aber dem Truge, dem Verrat, zugleich der Verderbnis überbildeter Völker in tiefster Seele widerstrebend (ohne im Kampf für die Freiheit gegen ein furchtbar überlegenes Kulturvolk die dämonische Arglist des Barbaren zu entbehren: Armin. D.). Gemildert, geadelt die Wildheit durch zwei echt germanische Züge: tiefe, reine Verehrung der Frauen und selbstaufopfernde Treue im Kriege.
Im öffentlichen Leben unbändiger Stolz persönlicher Freiheit, bei angeborener freier Achtung für den aus dem Volke hervorgewachsenen Adel und das Königtum.
Der Kreis der Unterwerfung unter einen Gesamtwillen ungemein beschränkt, aber geordneter, bewußter Gehorsam für das Notwendige. Je enger, desto inniger die Verbindung; je weiter, desto loser. Vorübergehende Verbindungen einzelner Völker Verbrüderungen in der Gefahr: von dem Bewußtsein weiterer, nationaler Einheit nur schwache Spuren.
Im Kriegswesen zwei Formen: der gemeine Heerbann und das Gefolgwesen, nicht in feindlichem Gegensatze, sondern eng verbunden.
Auf einzelne der angeregten Fragen muß nun noch näher eingegangen werden.
Zu den bedeutendsten Ergebnissen neuester Forschung im Gebiete deutschen Altertums gehört unstreitig die richtigere Feststellung des bildenden Urprinzips der germanischen Verfassung. Hat man dies bisher nach Moser, der dabei jedoch nur sein Land vor Augen hatte, fast ausschließlich in den räumlichen Verbänden der Markgenossenschaften und Gaue gefunden, so haben nunmehr besonders Wilda und v. Sybel überzeugend nachgewiesen, daß auch bei den Germanen, wie bei allen Völkern, deren Anfange zu unserer Kenntnis gelangt sind, die geschlechtliche Verfassung nicht nur der räumlichen vorausgegangen sei, sondern erstere auch noch zu Cäsars und selbst zu des Tacitus Zeiten in mehr oder minder lebendiger Wirksamkeit bestanden habe. Nicht aber, daß sich beide Ansichten wie Wahrheit und Irrtum absolut ausschlössen: denn auch die alte Schule hat einen Einfluß weiterer und engerer Stammverwandtschaft nicht geleugnet: nur über die relative Wichtigkeit des einen wie des andern Prinzips in Maß und Zeitdauer kann sich der Streit noch bewegen.
Ist hierin sonach der Boden für die Vermittlung gefunden, so mag auch wohl die neue Schule von dem Vorwurf, in der Konsequenz ihrer Ansicht etwas zu weit zu gehen, kaum ganz freigesprochen werden.
So geht v. Sybel (S. 3 bis 11) zu weit, wenn er allen Germanen zu Cäsars Zeit Sondereigen an Grund und Boden entschieden abspricht und dies grundsätzlich, wiewohl den Fortschritt zu mehrerer Stetigkeit des Besitzes anerkennend, auch noch von des Tacitus Zeit behauptet: besonders aber legt er dieser Voraussetzung zu viel Gewicht bei.
v. Sybel beruft sich auf die bekannten Stellen Cäsars: a) von den Sueben IV, 1: privati ac separati agri apud eos nihil est; neque longius uno anno remanere uno in loco incolendi causa licet, b) von den Germanen im Allgemeinen VI, 22: neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios, sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum, qui una coierunt, quantum et quo loco visum est, agri attribuunt, atque anno post alio transire cogunt.
Aus Tacitus bezieht er sich nur auf Germ. c. 26: Agri pro numero cultorum ab umversis in vices occupantur; und: Arva per annos mutant et superest ager, weder diese Stelle übrigens vollständig noch die parallele Kap. 16 überhaupt anführend.
Wer Cäsars Schriften, Lebensgeschichte und große Persönlichkeit lebendig vor Augen hat, bewundert mit Recht den Geist, hält aber nicht am Worte der Darstellung fest. Wie kann man von dem Staats- und Kriegsmanne, welcher, der Welt Geschicke in seinem Busen wälzend, daneben in einzelnen kurzen Stunden der Muße seine Begegnisse und Wahrnehmungen niederschreibt, systematische Vollständigkeit und eine Feile des Ausdrucks auch nur erwarten, welche des Bildes Detailwahrheit selbst nach Jahrtausenden noch über jeden Zweifel erheben könnten?
Man hat bisher ziemlich allgemein angenommen, daß Cäsar vollständiger und genauer über die Sueben als über die nichtsuebischen Germanen unterrichtet gewesen sei, was v. Sybel (S. 1 und 5) in Abrede stellt, weil er auch mit Usipiern, Tenchterern, Ubiern und Sugambrern gekämpft habe.
Abgesehen von dem Irrtum rücksichtlich der Ubier, welche dessen Bundesgenossen, nicht Feinde waren, schlug aber Cäsar jene übrigen Völker nur aus Belgien, in das sie räuberisch eingefallen waren, wieder hinaus, das Gebiet der Sugambrer, von den Bewohnern verlassen, betrat er nur einmal auf wenige Tage (IV, 19), die Usipier und Tenchterer, seit drei Jahren landflüchtig, hatten damals selbst noch keine Heimat.
Nachrichten konnte er von Gesandten, Gefangenen, Nachbarn auch über diese Völker wohl einsammeln: in näherem, bleibendem Verkehr hat Cäsar unter allen nichtsuebischen Völkern allein mit den Ubiern gestanden. Gerade diese aber bezeichnet er (IV, 3) als Ausnahme von der Regel: ein blühendes Gemeinwesen, mildere Sitten, Anflug gallischer Kultur, bei denen übrigens, eingekeilt zwischen Rhein und drängenden Sueben, nicht einmal die Möglichkeit eines jährlichen Wechsels der Wohn- und Kultursitze denkbar war.
Über Cäsars Quellen absprechen zu wollen, wäre Torheit; in dessen Kommentarien über den gallischen Krieg aber findet sich kein Grund, gleich sichere und vollständige Kunde über Nicht-Sueben als über Sueben bei ihm vorauszusetzen.
Nichtsdestoweniger ist gerade das Gesamtbild, welches er (VI, 21 bis 23) von den Germanen im Allgemeinen entwirft, mit Tacitus verglichen, bewundernswürdig, wenn man es nur im Ganzen und Großen erfaßt, nicht aber am Buchstaben ängstlich festhält.
So bezweifelt z. B. wohl Niemand, daß die bekannte Stelle VI, 21, wo Cäsar den Germanen Priester und Opferkultus scheinbar ganz abspricht, nach strengem Wortlaut unrichtig, wohl aber relativ, d. i. in der aufgestellten Vergleichung mit den Galliern, richtig ist. Wenn derselbe ferner, Kap. 22, von den Germanen überhaupt ganz bestimmt sagt: agriculturae non student, so ist auch dies wiederum nur relativ, sowohl den Galliern als den sonstigen Erwerbszweigen ersterer, Jagd und Viehzucht, gegenüber, zu verstehen, da Cäsar nicht nur an derselben Stelle bald darauf, sondern auch an vielen andern, z. B. I, 28. n, 1. 4. 7. 8. 19, direkt oder indirekt von deren Ackerbau spricht. (VI, 29 quod, ut supra demonstravimus, minime omnes Germani agriculturae student heißt aber: »Alle tun es nicht«: keineswegs: »nicht alle tun es.« D.)
Dieser Bemerkungen ungeachtet kann eine gewisse (weiter unten näher zu erläuternde) Begründung der v. Sybelschen Meinung durch Cäsar nicht in Abrede gestellt werden.
Desto weniger steht ihm Tacitus zur Seite, in welchem v. Sybel zwar die Spur des Kulturfortschrittes während anderthalb Jahrhunderten, zugleich aber doch auch die Fortdauer der cäsarischen Grundregel erkennt.
Diese letztere enthält nun zwei Sätze:
a) Es gibt bei den Germanen nur Gemeinde-, kein Sondereigen an Grund und Boden, von ersterem aber wird jedem Genossen durch die Obrigkeit ein Teil zur Bebauung überwiesen.
b) Diese Verteilung gilt nur auf ein Jahr, nach dessen Verlauf der Ort wieder verlassen werden muß.
Letzterer Wechsel scheint nämlich, den Worten nach, wie v. Sybel annimmt, allerdings auf den Wohnplatz sich zu beziehen, so daß die ganze Ansiedlung jährlich verlegt würde. Es ist aber auch mit dem Wortlaute nicht unbedingt unvereinbar, jenen Wandel auf die Kulturfläche zu beschränken, dergestalt, daß das Dorf zwar beibehalten, jährlich aber ein anderer Teil der Flur in Kultur genommen ward.
Die Wahrheit liegt unstreitig in der Mitte; nicht selten mochte, in der ersten Periode noch halb nomadischen Schweifens wenigstens, das erste, öfter gewiß nur das letzte stattfinden. Eine feste Regel war hier kaum denkbar, absurd wenigstens wäre, eine Pedanterie des Prinzips anzunehmen, welche die Gemeinde gezwungen hätte, den noch unkultivierten besseren Boden in der Nähe des Dorfes zu verlassen und dies ganz abzubrechen, um in entfernterem schlechtem eine neue Wohn- und Kulturstätte aufzuschlagen.
Cäsar schrieb hier undeutlich, weil die Sache selbst fester Bestimmung nicht fähig war.
Vergleichen wir nun den Inhalt seines Berichts im Einzelnen mit Tacitus, so wird zuvörderst Satz a) der Mangel an Sondereigen durch das von der Bauart der Germanen handelnde Kap. 16 der Germ. dieses letztern, welches v. Sybel ganz beiseite läßt, entschieden widerlegt, indem die Worte: colunt discreti ac diversi ut fons, ut campus, ut nemus placuit, und bald darauf: suam quisque domum spatio circumdat das Bestehen von unbeweglichem Sondereigen unzweifelhaft ergeben.
Diese Stelle würde aber auch mit Punkt b) Cäsars, dem jährlichen Wechsel der Wohnplätze, unvereinbar sein, daher Tacitus, wenn die Stelle Kap. 26 diesen bestätigte, wie v. Sybel annimmt, sich selbst widersprechen.
Dem steht aber zuvörderst die unsichere Lesart der Hauptstelle entgegen.
Der Bamberger Codex hat: Agri – ab universis vicis occupantur, der Leydener in vicem. Andere haben per vices, was schon ältere Ausleger, wie Colerus, Pichena, Cluver und Conring, für Schreibfehler hielten, weshalb sie: »per vicos« lasen.
Gerlach und v. Sybel (so auch Müllenhoff in seiner Ausgabe: vgl. die umfangreiche Literatur über die Frage bei Baumstark, Erläuterungen zur Germ. des Tac. D.) nehmen in vices für das Richtige an, Waitz dagegen bleibt (D. Verf.-Gesch. I, auch noch 3. Aufl. Kiel. 1880. 1. S. 145) bei vicis stehen. Beruht nun offenbar die ganze Spitze des Sybelschen Beweises auf der Lesart: in vices, so ist dessen Fundament unsicher, weil diese eben nicht feststeht.
Faßt man Sinn und Zweck der Stelle, wie des Tacitus Schreibart ins Auge, so ist offenbar vicis oder per vicos dem in oder per vices vorzuziehen (? D.) Tacitus strebt bei so gesuchter Kürze vor allem durch Gegensätze sich verständlich zu machen. Ein solcher ist auch hier, wenn man liest: »Agri pro numero cullorum ab universis vicis (oder per vicos) occupantur, quos mox inter se secundum dignitatem partiuntur, facilitatem partiendi camporum spatia praestant,« bestimmt und vollständig vorhanden; es ist die Gesamtheit, welche er den Einzelgenossen gegenüber stellt, wobei der Kreis ersterer notwendig näherer Bezeichnung bedurfte, damit man wisse, es sei die Gemeinde des vicus, nicht des pagus oder der civitas, von welcher er rede.
Bei der andern Lesart würde letztere, gleichwohl wesentliche, Bestimmung ganz fehlen, noch dringender aber den Autor der Vorwurf treffen, eine Tatsache von höchster praktischer Wichtigkeit, den jährlichen Wechsel der Wohnplätze, der seinem früheren Anführen, Kap. 16, geradezu widerspräche, durch das bloße Einschiebsel von zwei Worten schwankender Deutung: in vices ausgedrückt zu haben, ein Mißbrauch der Kürze, von dem sich bei all dessen Vorliebe für solche gewiß kein Beispiel finden wird.
Daß aber dessen folgende Worte: arva per annos mutant, et superest ager, sich nicht auf Wechsel der Wohnplätze, sondern nur der Ackerfläche, d. i. der unter den Pflug zu bringenden Länderei beziehen, beruht, nach dem gewöhnlichen Sinne von arvum, Acker, Saatfeld, wie dies Tacitus anderwärts selbst braucht, z. B. Ann. XIII, 54 von den Friesen: »semina arvis intulerant« außer Zweifel.
In der ganzen Stelle daher wiederum einer seiner Gegensätze; der erste Teil handelt von der Niederlassung, die sich bei wachsender Volksmenge und Lichtung der Wälder von Zeit zu Zeit wiederholte, was dessen »occupantur« außer Zweifel setzt, die zweite dagegen von der fortdauernden Benutzungsweise der einmal eingenommenen Flur.
Bestätigt sich hiernach durch Tacitus, wenn man diesen nicht eines direkten Widerspruchs mit sich selbst zeihen will, keineswegs Cäsars Bericht in dem Sinne, welchen v. Sybel ihm beilegt, so wende ich mich nun
zu dem Versuche, beide zu vereinigen, und deren richtigem Verständnis Bahn zu brechen.
Abstrakten Voraussetzungen für Geschichtliches von Grund aus Feind, kann ich doch die Bemerkung nicht unterdrücken, daß es zu den auffälligsten Widersprüchen gehören würde, wenn ein Volk so seltener Kulturfähigkeit, wie das germanische, das den Ackerbau, wenn auch nicht vorzugsweise liebte, doch kannte und schätzte, nach mehreren Jahrhunderten noch nicht bis zur ersten unentbehrlichsten Kulturstufe – dem Begriffe des Eigentums an Grund und Boden – gelangt sein sollte, was ich jedoch nicht als Beweis für mich, nur als entfernten Zweifelsgrund gegen die andere Meinung, vorausschicke.
Was ich in einer früheren Schrift (zur Vorgeschichte deutscher Nation, Leipzig 1852) umständlich darzutun gesucht, die Einwanderung der Germanen von Asien her, wird von der weit überwiegenden Mehrzahl der Forscher ohnehin nicht bezweifelt; auch daß die Sueben länger in halbnomadischer Sitte verharrend in ihrem kriegerischen Schweifen früher und weiter als jene nach Süden und Westen vorgedrungen sind, dürfte kaum erheblichen Widerspruch finden.
Daß nun letztere während der Wanderzeit kein festes Sondereigentum an Grund und Boden, vielmehr nur an fahrender Habe, zumeist Vieh besaßen, liegt auf der Hand. Nur ganze, kleinere oder größere Gemeinheiten bedurften gemeinsamer Lagerplätze und Weidebezirke, welche sie anderen Gemeinheiten gegenüber als Eigentum ansprachen, wie dies alles heute noch bei den Beduinen stattfindet.
Also Cäsars Bericht enthält für die Wanderzeit volle ursprüngliche Wahrheit. Der Übergang aus dieser zu festerer Seßhaftigkeit mußte aber naturgemäß ein höchst allmählicher sein, einiger Feldbau, zum Gewinne des nötigen Winterfutters, schon während des Wanderzuges selbst, zumal auf der Straße nördlich der Karpaten (vergl. m. Schr.) betrieben werden. Nicht Weichsel, Oder oder Elbe aber konnte die Grenze bilden, wo mit einem Male Sitte und Lebensweise plötzlich umschlug, zumal der Sueben Sinn und Kriegslust immer weiter vordrängte.
Selbst abgesehen von Cäsars Versicherung daher ist es höchst wahrscheinlich, daß der alte Gebrauch mindestens bei den Südsueben, mit denen derselbe gerade in die nächste und meiste Berührung kam, im Wesentlichen noch zu dessen Zeit fortdauerte, indem die Weite des Gebiets, das sie im Fortschritte der Eroberung eingenommen, und die Waldwüste zu immer neuen Ansiedlungen fast unbeschränkten Raum darboten.
Untersuchen wir aber genauer den materiellen Inhalt von Cäsars Bericht, so finden wir, daß er nur das Sondereigentum, keineswegs aber den Sonderbesitz der Einzelnen leugnet, indem kaum zu bezweifeln ist, daß das Land, welches jedem Geschlecht oder jeder Familie (cognatio) von der Obrigkeit angewiesen ward, auch innerhalb dieser zu weiterer Verteilung unter die einzelnen Hausväter gelangte. Der hiernach allein verbleibende Unterschied ist der zwischen Eigentum und Besitz, dominium und possessio, welcher für den rechtskundigen Römer, der ja auch am ager publicus nur eine possessio kannte, so verständlich als wichtig war. Bei den Germanen nun war ursprünglich alles unstreitig Gemeindeland, ager publicus, woran der einzelne daher nur Sonderbesitz hatte. Im alten germanischen Rechtsleben waren bereits Formen des Eigentums und dinglicher Rechte in faktischer Übung.
Jeder Hausvater empfing, was er für seinen Haus- und Viehstand bedurfte, zu freier, unbeschränkter Verfügung. Rückte die Gemeinansiedlung weiter, ward die alte Kulturfläche gegen eine neue vertauscht, so mußte er freilich folgen, erhielt aber sofort anderwärts wieder, was er brauchte. Ob als bloßer Nutznießer oder als Eigentümer, das war praktisch dasselbe: das einzige, was wahrhaft praktisch gewesen sein würde – Beschränkung im Umfange des Besitzes oder Gleichheit der Teile, ohne Rücksicht auf Ungleichheit des Bedürfnisses und selbst wohl des Standes – kam nicht in Frage, indem Cäsar davon gar nichts, Tacitus aber, selbst anderthalb Jahrhunderte später, gerade das Gegenteil sagt.
Scharf und richtig daher hat Cäsar, wie immer, eine höchst eigentümliche, dem Römer frappante, Erscheinung des germanischen Lebens aufgefaßt: genauere Ausführung des Bildes konnte, indem er die ganze Schilderung der Germanen, mit Reflexionen und geschichtlichen Notizen vermischt, in etwa sechzig Zeilen zusammendrängte, gar nicht in seinem Plane liegen.
Nur darin trifft ihn der Vorwurf der Flüchtigkeit und Ungenauigkeit, daß er in dieser Stelle ohne irgendeine Beschränkung auf Zeit, Gegend und einzelne Völker von den Germanen ganz im Allgemeinen redet, während er den größten Teil des innern Landes gar nicht genau kennen konnte, gerade auf das einzige nicht-suebische Volk aber, welches er genauer kannte, die Ubier, nach seiner eignen Schilderung derselben, seine Beschreibung nicht paßt.
Fassen wir nun die Frage, bevor wir zu Tacitus übergehen, von der landwirtschaftlichen Seite auf.
Die erste Grundlage jedes ökonomischen Systems ist selbstredend das Verhältnis des Grundbesitzes zu der Volkszahl und zu dem, teils durch diese, teils durch andere Momente bedingten, Erzeugungsbedarf an Getreide. Bei den Germanen jener Zeit bestand nun Überfluß und ergiebigere Naturkraft des jungfräulichen Bodens auf jener Seite, beschränkter Getreidebedarf bei dünner, erst nach der Seßhaftigkeit stark steigender Bevölkerung (deren Hauptnahrung überdies die Produkte ausgebreiteter Viehzucht und unbeschränkter Jagd gewährten) auf dieser Seite.
Bei solchem Verhältnis war ein Wirtschaftssystem, dem unserer Schlag- oder Koppelwirtschaft (welche bei großem Grundbesitz, dünner Bevölkerung und starker Viehzucht heute noch die rationellste ist) ähnlich, das einzig natur- und zweckgemäße, zumal bei dem damaligen Fruchtbarkeits- und Feuchtigkeitsgrade üppiger Graswuchs auf den Brachschlägen gesichert war. Wie man in Mecklenburg und Holstein jetzt noch (1860) bei zehnjährigem Turnus vier bis fünf Brach- und nur fünf bis sechs Fruchtschläge hat, so vielleicht bei den Germanen, wenn sie so lange in der Flur verweilten, ein bis höchstens zwei Getreideschläge innerhalb derselben Zeit.
Sie säten nur in die Ruhe, mußten daher alle Jahre das Ackerfeld wechseln; das ist es, was Tacitus in den Worten: »arva per annos mutant« ausdrückt.
Bei dieser Wirtschaftsweise war die Frage, ob dem einzelnen Eigentum oder nur Nießbrauch an seiner Länderei zustand, offenbar eine völlig müßige. Daß aber Niederlassung und Wechsel der Schläge nicht nach individueller Willkür, sondern gemeindeweise, nach fester Ordnung erfolgte, war nicht Folge des unentwickelten Begriffs von Sondereigen, vielmehr durch eben jenes System geboten, weil die Lichtung der Wälder nur in größeren Bezirken zweckmäßig geschehen, die Gemeindeweide aber nicht durch einzelne Ackerfelder unterbrochen werden konnte.
Dies ebenso einfache als weise Wirtschaftssystem (das übrigens nicht Dreifelderwirtschaft, wie der Philologen und Historiker Unkunde häufig angenommen hat, sondern gerade das Gegenteil einer solchen war) beruhte aber auf dem anfänglichen Überfluß an Land.
Wie jedoch einerseits die Bevölkerung sich mehrte, andererseits die vordringende Eroberung, nach West und Süd wenigstens, durch Rom abgeschnitten ward, mußte die ursprüngliche ganz extensive Wirtschaft immer mehr einer intensiven weichen, der Getreidebau durch Düngung und Nachflucht gesteigert werden. Dabei ist zunächst in das Auge zu fassen, daß die ausgebreitete, mit Milch- und Käsewirtschaft (Cäsar VI, 22) verbundene Viehzucht der Germanen, bei des Landes Klima, notwendig eine Art von Einstallung und Fütterung über Winters voraussetzte, des Volkes praktischer Verstand aber unstreitig sehr früh schon die große Nutzfähigkeit des gewonnenen Düngers erkannte. Düngung und Nachfrucht aber mußte Sondereigen voraussetzen oder mindestens sofort herbeiführen, weil es widersinnig gewesen wäre, mehrerer Kultur sich zu befleißigen, ohne deren Frucht für sich zu ernten.
Dieser Fortschritt aber mußte, der Natur der Sache gemäß, ein sehr langsam-allmählicher sein: die Bestimmung eines festen Zeitpunktes für dessen Eintritt ist daher schlechterdings unmöglich.
Den Schlüssel der Entwicklung finden wir mit großer Sicherheit in den agrarischen Verhältnissen der späteren, ja selbst der neuesten Zeit.
Diese gewähren uns zuvörderst durch eine Reihe von Tatsachen neuen zuverlässigen Beweis dafür, daß in der Urzeit Gemeindeeigentum, nicht Sondereigen, die Regel bildete. Vielmehr: Gemeinde-(Staats)Eigentum war allerdings bei jeder Landnahme das erste, dann aber erfolgte, seit dem Übergang zu seßhaftem Ackerbau, von Staats wegen Zuteilung in das Sondereigen. (D.) Diese Tatsachen sind folgende:
1) Die bis auf die neueste Zeit in jedem Dorfe mit den seltensten Ausnahmen vorhanden gewesenen, teilweise noch vorhandenen, mehr oder minder ausgedehnten, bisweilen die Sonderbesitzungen an Areal übersteigenden Gemeindegrundstücke, meist Weiden, hier und da aber auch Holzungen.
Diese können nur entstanden sein, entweder:
a) aus dem ursprünglichen Gemeindeeigentum an der ganzen Flur, oder
b) aus späterer Zusammenlegung von Sondergrundstücken zu Gemeindeeigentum.
Bildung von Gemeindegrundstücken durch spätere Zusammenlegung erscheint aber, abgesehen von dem Mangel jeder Spur in den Quellen darüber, jedem, der mit agrarischen Verhältnissen irgendwie vertraut ist, so unwahrscheinlich, so unnatürlich, daß daran gar nicht zu denken ist. Bewährt die ganze Kulturgeschichte immerwährenden, wenn auch oft kaum merklichen Fortschritt in dem wichtigsten aller Nationalgewerbe – dem Landbau, wann, wie und aus welchen Gründen ließe sich ein so ungeheurer Rückschritt, und zwar, was die Hauptsache ist, in so allgemeiner Weise erklären? Daß eine solche Zusammenlegung namentlich nicht aus dem Bedürfnis der Gemeindeweide, d. i. des Hütens des Sonderviehes durch einen Gemeindehirten, hervorgegangen sein könne, beweist das folgende.
2) Neben den Gemeindegrundstücken bestand überall bis auf unsere Zeit zugleich die Koppelhut, nach welcher alle Sondergrundstücke, außer den Gärten, dem Weiderecht der Gesamtheit unterworfen waren, welches in Verbindung mit angemessenem Wechsel von Frucht- und Brachschlägen innerhalb der Flur, überall die Möglichkeit ausreichenden Weideraums gewährte. Nur einem Zwange war der Sondereigner dabei unterworfen, dem nämlich, daß er seinen Wirtschaftsturnus dem Allgemeinen unterordnen mußte, also seine Saaten z. B. nur in den Flurteil bringen durfte, der nach dem herkömmlichen Wechsel im Allgemeinen dazu bestimmt war – eine Regel, welche, im Wesentlichen wenigstens, noch zu unseren Zeiten bestand.
Weniger schlagend, aber gewiß auch mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ist auch die Koppelhut aus dem ursprünglichen Eigentume der Gemeinde an der Gesamtflur abzuleiten. Auch der in späteren Perioden deutscher Geschichte entstandene landesherrliche Forstbann läßt sich zum Teil daraus erklären, daß in größeren Forsten noch kein Sondereigentum stattfand.
3) Die erste Ansiedelung konnte auf doppelte Weise erfolgen:
a) in geordneter, so daß die Gesamtheit zuerst die ganze Flur in Besitz nahm, dann sie unter die Einzelgenossen verteilte, wie dies Cäsar a. a. O. und Tacitus Germ. Kap. 26 ausdrücklich berichten;
b) in regelloser, daß der einzelne nach Art der amerikanischen Squatters für sich nahm, was ihm beliebte.
Daß nun bei den Germanen ersteres stattfand, beweist die wichtige Tatsache, daß die Sonderbesitzungen in der Regel bis auf die neueste Zeit nirgends geschlossene Ganze bildeten, sondern in allen Teilen der Flur zerstreut lagen, was infolge der Bodenverschiedenheit offenbar aus dem Grundsatze möglichst gleichmäßiger Beteiligung der einzelnen an dem bessern und geringeren Boden hervorgegangen ist. Diese Tatsache ist, da eine selbständige Sonderansiedelung mit so zerstreuten Ländereien undenkbar, an sich eine schlagende, bedarf daher nicht erst der Bestätigung durch die von Olufsen und Hannsen aus nordischen Verhältnissen geschöpfte Darstellung des Agrarwesens der Vorzeit (s. Falks N. Staatsb.-Magazin IV. und VI.), welche dasselbe für den Norden umständlich dartut.
Führt uns diese Betrachtung sonach mit zweifelloser Gewißheit auf Cäsars Grundregel zurück, die uns bereits aus historischen Gründen gesichert schien, so ist nun Anlaß und Fortgang der Abweichung von jener, d. i. des Übergangs von Gemeinde- zu Sondereigen, zu untersuchen.
Der erste Schritt zu diesem war unzweifelhaft die Stabilität der Gemeindeansiedelung überhaupt, des vicus. Volle Wahrheit konnte Cäsars Bericht nur für die Periode des Wanderns, des kriegerischen Schweifens haben, von der Strabo sagt, »sie leben in Hütten, die sie jeden Tag Der griechische Ausdruck: εφήμερον έκουσι παράσκευον (Strabo VII, § 1, S. 290, Casaub.) hat offenbar nicht den Sinn eines täglichen Abbrechens, sondern nur den einer vorübergehenden Aufschlagung: es ist indes die gewöhnliche Übersetzung beibehalten. neu errichten«.
Wann diese Stabilität eintrat, wissen wir nicht: entscheidend dafür war, für die Südsueben wenigstens, unstreitig der Zeitpunkt, wo, nächst dem Rheine, die Donau und der Nieder-Main unter August Roms Grenze wurden, deren Schweifen nach West und Süd daher eine Schranke gesetzt ward. Kein Zweifel aber, daß im innern Lande, namentlich bei den Westgermanen, wie wir dies von den Ubiern mit Sicherheit wissen, auch schon zu Cäsars Zeit, weit mehr feste Ansiedelungen der Gemeinden, vici, stattfanden, als dessen Bericht andeutet.
Waren aber die Dörfer feststehend, dann sicherlich auch die Häuser mit deren nächster Umzäunung, daher Haus, Hof und Garten erster Gegenstand von Sondereigentum.
Die zweite Stufe, Sondereigentum an Saatfeld, muß mindestens, nach obigem, gleichzeitig mit dem hochwichtigen Kulturfortschritte zur Düngung und Nachfrucht entstanden sein, wobei nur zu berücksichtigen ist, daß dieser wegen geringen Getreidebedarfs ursprünglich gewiß nur auf einen sehr kleinen Teil der Gesamtflur sich beschränkt haben mag, im Laufe der Zeit aber immer weiter sich ausdehnte, namentlich daher, zu Ausfütterung des Viehes über Winter, auch auf Wiesen sich zu erstrecken begann.
Die dritte entscheidende Stufe muß durch die Entwicklung des Rechtssatzes, daß der Nutzanteil am Gemeindegut Pertinenz des Sondereigentums an Hof- und Ackerfeld sei, eingetreten sein. Das Sondergut konnte nämlich ohne einen solchen Anteil gar nicht landwirtschaftlich bestehen, derselbe muß daher in jedem Falle mit vererbt und, soweit Veräußerung statthaft war Diese Frage gehört bekanntlich zu den schwierigsten des alten Rechts. Eichhorn D. St. u. K. G. I, § 67 nimmt für die Periode der Volksrechte die Zulässigkeit der Veräußerung von Allod, wiewohl unter großer Beschränkung an. (Offenbar traten die Veräußerungsbeschränkungen erst ein, nachdem Grundbesitz das wichtigste Vermögen und Voraussetzung für das Vollrecht in Gemeinde und Staat geworden war. D.), auch mit verkauft worden sein. Wann jener Rechtssatz sich gebildet, wissen wir nicht, nur daß er gleichzeitig mit der Veräußerungsfähigkeit überhaupt entstanden sein müsse, steht nach obigem fest.
Forschen wir nun, bis zu welcher Stufe der Fortschritt Es kann nicht auffallen, daß auch bei der immer weiter fortschreitenden Verteilung der Gemeindeländereien unter die einzelnen immer noch Gemeindeeigentum übrig blieb, da ja das Teilungsprinzip beim Austun des Landes an dieselben gewiß nicht bloß die Größe des gesamten Gemeindelandes, sondern principaliter das Bedürfnis des einzelnen war. Auch liegt es nahe, daß eben wegen dieses Bedürfnisses, also aus Utilitätsrücksichten, regelmäßig solches Gemeindeeigen reserviert wurde. Dieses reservierte Gemeindeeigen ist auch gleich von vornherein oder später bei der Konsolidierung des Sondereigens gewiß ausdrücklich zu dem Zwecke reserviert worden, die Nutzungen desselben wiederum den einzelnen zukommen zu lassen (Entwicklung der Allmende), und so wurde dann der Nutzungsanteil des einzelnen am reservierten Gemeindeeigen schließlich Pertinenz des konsolidierten und begrifflich entwickelten Sondereigens. D.) zu des Tacitus Zeit gediehen war, so bedarf zuvörderst die Stelle Germ. Kap. 16: colunt discreti ac diversi etc., welche auf Sonderansiedelung nach Art der Squatters schließen läßt, und deren scheinbarer Widerspruch mit Kap. 26 der Erwähnung.
Tacitus ist insofern, als er hier scheinbar von einer allgemeinen Sitte der Germanen redet, von einer ungenauen Ausdrucksweise nicht freizusprechen, da dieselbe schon damals gewiß nur eine provinzielle gewesen ist. Flossen ihm aber gerade aus der betreffenden Gegend, dem Schauplatz der letzten Römerkriege, die meisten Nachrichten zu, war er dabei über die Grenze jener Sitte selbst ungewiß, so ist dessen Ausdruck, bei dem er übrigens direkte Versicherung der Allgemeinheit derselben vermeidet, ebenso erklärlich als verzeihlich; nicht unrichtig, nur ungenau, weil er das Genauere nicht kannte. Keineswegs aber folgt aus jener Stelle notwendig Wegfall des Gemeindeverbandes überhaupt: – (spricht doch auch Tacitus an derselben Stelle (und sonst noch oft) von Dörfern (vici) der Germanen: er wußte also, daß Hof und Dorfsiedlung nebeneinander vorkamen – D.), vielmehr haben wir vorauszusetzen, daß zuerst eine größere Gemeinheit, vielleicht die Centene, einen weitern, das Bedürfnis der Genossen übersteigenden Raum einnahm, innerhalb dieses aber die Sonderansiedlung, wiewohl sicherlich auch nach leitenden Grundsätzen, jedem zu freier Auswahl gestattete, wie denn noch heute die Einzelhöfe in Westfalen in größere Gemeindeverbände – Bauernschaften – vereinigt sind.
Von besonderer Wichtigkeit ist aber des Tacitus Bericht über die Verhältnisse der servi Germ. Kap. 25. Wenn derselbe hier von letzteren sagt: Suam quisque sedem, suos penates regit. Frumenti modum dominus, aut pecoris, aut vestis, ut colono injungit: et servus hactenus paret, hiernach also schon die Knechte damals ein beschränktes höriges und zinspflichtiges Peculium erlangt hatten, so ist am Sondereigen der Freien noch zu zweifeln in der Tat unmöglich.
Aus diesen Gründen und aus dem Gesamtbilde, welches Tacitus in seiner Germania und Geschichte von den Zuständen jener Zeit entwirft, worin sich nirgends eine Spur des an sich so auffälligen Mangels an jedem unbeweglichen Sondereigentum findet, dürfen wir mit Recht folgern, daß dies zu dessen Zeit nicht nur allgemein bis zur ersten, sondern auch gewiß schon vorherrschend bis zur zweiten Stufe, dem partiellen Sondereigentum an Ackerland, fortgeschritten war, wogegen ich über die dritte und letzte nicht einmal eine Vermutung wage.
Dies alles führt mich nun zu dem Schluß, daß
Bei der Untersuchung über Fürsten, Adel und Privatgefolge der Germanen fragt es sich vor allem:
Beide fahren auf die Grundfrage zurück: ob und welche Vorzüge der Geburt bei den Germanen galten.
Die Vertreter dieser oder jener Meinung genau zu klassifizieren, würde, zumal bei deren Spaltung im einzelnen, so schwierig als unnötig sein: indes vertreten Eichhorn und v. Savigny mehr die aristokratische, Waitz (Deutsche Verfassungsgeschichte I. 3. Aufl. 1. S. 281 und: »über die principes in der G. des Tac.« Forsch, zur D. G. II. S. 387 f.) und Paul v. Roth (Geschichte des Benefizialwesens, Erlangen 1850) mehr die Auffassung, welche im Prinzipate nichts als ein von der Gemeinde übertragenes Amt erkennt, während Löbell (Gregor von Tours) und Wilda (Strafrecht) mehr in der Mitte stehen.
Zu I
Nicht auf dem Boden der Auslegung allein kann die Frage entschieden werden, was unter dem germanischen Prinzipat zu verstehen sei. Wir haben jedoch diese zuerst nach den Quellen zu erörtern.
a) Erörterung der Streitfrage nach den Quellen
Beide Teile gründen ihre Ansicht auf Tacitus, aus denselben Worten zum Teil Entgegengesetztes schließend: nirgends Gewißheit, überall nur Vermutung mit mehr oder minder Wahrscheinlichkeit.
Prüfen wir indes die Hauptgründe.
1) Von größter Wichtigkeit ist zunächst, welchen Sinn Tacitus im Allgemeinen mit dem Ausdrucke princeps verbinde, und zwar:
Der Ausdruck princeps bedeutet bei Tacitus stets:
Denjenigen, welcher in einem gewissen Kreise der Erste ist, oder auch nur vor anderen hervorragt, z. B. princeps juventutis, Ann. I, 3. XII, 41; principes viri, für Männer höchster Geburt und Stellung, III, 6; princeps bonarum artium, XI, 6; princeps fori, de Orat. 34; er braucht sogar princeps dies für den ersten Tag der Regierung Augusts, Ann. I, 9. Ähnlichen Sinn verbindet er mit dem mehrfach vorkommenden Ausdruck princeps locus, der sich Ann. III, 75, wo er von Atejus Capito sagt: principem in civitate locum studiis civilibus adsecutus, nur auf eine hohe, nicht auf die höchste Stellung im Staate bezieht.
Vor allem bezeichnet derselbe die römischen Herrscher an vielen Stellen, z. B. Ann. I, 1 und 9; Hist. I, 4. 5. 7. 15. 16. 37. 40. 44 und 56, durch princeps, deren Herrschaft mehrfach durch principatus.
Wenden wir uns nun zu den Germanen, so spricht schon die Vermutung dafür, daß auch bei diesen wieder princeps in jenem allgemeinen, nicht in genau begrenztem, gewissermaßen technischem Sinne, gebraucht werden.
So ist es in der Tat. Die Germanen hatten:
a) (Gaukönige, als welche wir die reges zu betrachten haben. Könige über ganze Völkerschaften kamen damals nur äußerst selten vor. Bestanden, was nicht bezweifelt wird, bleibende Vereinigungen mehrerer Gaue zu einer Völkerschaft als Staatenbund, wenn auch nur für beschränkte Zwecke, so hatten diese zwar Völkerschaftsversammlungen (concilia civitatis), aber kein dauerndes Haupt im Frieden und auch im Krieg nur einen frei gewählten Herzog für einen Feldzug, höchstens für mehrere Feldzüge in einem großen Krieg: Armin a. 9, später Italicus und Chariomer waren solche Gaukönige der Cherusker und beziehentlich Chatten, denen nicht erst die Römer den Titel König beigelegt hatten. D.)
b) Gaugrafen (Richter), was niemand bezweifelt,
c) Vorsteher der Centenen (wo solche vorkamen D.), auch einzelner Ortsgemeinden, und
d) Gefolgsherren.
Die ersten drei Kategorien nun bezeichnet Tacitus durch den Ausdruck princeps. Die sämtlichen Stellen sind verzeichnet und besprochen bei Dahn, Die Könige der Germanen I. München 1861. S. 67 f.
Daß Tacitus in folgenden Stellen:
Kap. 13: »Magna comitum aemulatio, quibus primus apud principem suum locus,« so wie
im ganzen 14. Kapitel, worin der Ausdruck princeps fünf Mal vorkommt, z. B. »Cum ventum in aciem, turpe principi virtute vinci, turpe comitatui virtutem principis non adaequare,« ferner:
»Principes pro victoria, comites pro principe pugnant«,
durch princeps den Gefolgführer als solchen bezeichnet habe, ist von niemand bestritten worden: denn auch diejenigen, welche das Dasein eines erblichen Fürstenstandes bei den Germanen jener Zeit leugnen, bezweifeln obiges nicht, behaupten vielmehr nur die subjektive Identität des princeps (Gaufürsten) und Gefolgführers, weil ersterer allein ein Gefolge halten durfte.
Das Gesamtergebnis dieser Erörterung ist, daß Tacitus durch princeps im Allgemeinen einen Häuptling bezeichnet, mochte dieser einem ganzen Volke Daß Tacitus unter principes bisweilen auch die reges mit einbegreift, ist nach G. c. 5, 12, 16, 22 und 38 nicht zu bezweifeln. Noch ist zu bemerken, daß er das Beiwort principalis nur einmal, Hist. I, 13, in einem Sinne braucht, wo es fürstlich bedeuten kann, principalis (i. e. Neronis) scortum, zugleich aber den Nebensinn der ersten, vornehmsten nicht ausschließt. oder nur einzelnen Gauen oder auch nur einem Gefolge, Comitate vorstehen.
Es ist noch eine besondere Stelle der Germania zu prüfen, Kap. 13: Insignis nobilitas aut patrum merita principis dignationem adolescentulis etiam assignant, ceteris robustioribus et jam pridem probatis aggregantur, nec rubor inter comites aspici. Vergl. v. Gerlach, Erläuterungen zu Tac. Germ. c. 13, v. Sybel: »Entstehung des deutschen Königtums« (Frankfurt a. M, 1844, S. 84) der älteren Auslegung beipflichtend; weitere Literatur bei Dahn, Könige I, S. 70 und jetzt bei Waitz I. 3. Aufl. 1. S. 283. Bekanntlich verstand man unter principis dignationem früher allgemein die Würde eines princeps (d. i. hier Gefolgsführer), während zuerst Oreilli, dann Bahrt, Waitz und Paul v. Roth dignatio durch die Würdigung, d. i. Auszeichnung, Begünstigung eines adolescentulus durch den Fürsten erklären.
Vom philologischen Standpunkt aufgefaßt, scheint mir die ältere Erklärung aus folgenden Gründen entschieden den Vorzug zu verdienen:
a) Tacitus versteht unter dignatio, wie v. Roth selbst zugibt, in der Regel nur den objektiven Begriff: Amt, oder Ansehen. Letzerer führt nun zwar die Stelle Ann. II, 53: Excepere Graeci (Germanicum) quaesitissimis honoribus vetera suorum facta dictaque praeferentes, quo plus dignationis adulatio haberet, für sich an, kaum aber mit Recht, weil auch in dieser die Handlung nicht in der dignatio, sondern in der adulatio liegt und der Beisatz nur den objektiven Charakter der Schmeichelei, »damit sie desto mehr Gewicht habe«, bezeichnen soll, keineswegs aber den einer von einem bestimmten Subjekt ausgehenden Handlung.
b) Die Verbindung assignare alicui dignationem (im aktiven Sinne) hat, wegen der doppelten Handlung in einem Satze, nach meinem Gefühle, etwas Unnatürliches und Sprachwidriges.
Vom kritischen und sachlichen Gesichtspunkt aus scheint es mir dagegen darauf anzukommen, ob man die gewöhnliche Lesart: ceteris So auch Müllenhoff. ( D.) in das durch keine Handschrift verbürgte ceteri So Lipsius und Haupt. ( D.) zu verändern berechtigt ist, indem bei der alten Erklärung das ceteris mit dem unmittelbar darauffolgenden nec rubor kaum zu vereinigen sein dürfte.
Ich verstehe die fragliche Stelle in ihrem ganzen Zusammenhange so:
Tacitus handelt im Kap. 13 vom Kriegsdienst und zwar zunächst vom Eintritt in diesen: sodann von der Ausbildung für denselben. Erstere erfolgt durch die feierliche Wehrhaftmachung vor der Gemeinde. Für letztere bot das Comitat eine häufige Schule. Hiernach würden nun die streitigen Worte meines Erachtens folgenden Sinn haben, und zwar
aa) nach der alten Auslegung mit ceteri:
Wenn der Wehrhaftgemachte dem höchsten (insignis) Adel angehört oder sein Vater große Verdienste hat, kann er auch in noch sehr jugendlichem Alter schon Gefolgsherr werden. Alle übrigen, ceteri, d. i. diejenigen, welchen solche Auszeichnung nicht zuteil wird, werden den schon gedienten Gefolgsgefährten beigesellt, indem es niemandem unehrenhaft ist, in einem Gefolge zu dienen.
bb) nach der neueren:
Junge Leute von hohem Adel oder großem Verdienste der Väter können auch etwas früher schon als andere wehrhaft gemacht und vom Fürsten in sein Gefolge aufgenommen werden. Sie werden dann den Robusteren und schon Bewährten beigesellt: auch ist es nicht unehrenhaft für sie, in einem Gefolge zu dienen.
Es ist nicht zu verkennen, daß die unmittelbar darauffolgende Stelle: gradus quin et ipse comitatus habet, judicio ejus quem sectantur, letztere Auslegung insofern unterstützt, als sie an die vorhergehende Idee knüpft, daß dergleichen vom Fürsten Bevorzugte nicht bloß sozusagen als Gemeine zu dienen brauchen, sondern auch, bald wenigstens, »Offiziere« werden können. Das – und noch anderes – ist entscheidend für diese Erklärung. ( D.)
Faßt man des Tacitus gedrängte, überall nur das wichtigste hervorhebende Schreibart in das Auge, so ist kaum zu bezweifeln, daß die frühere Erklärung seinem Geiste mehr entspricht, als die neuere, weil die Möglichkeit, daß schon ein adolescentulus Gefolgsherr werden konnte, etwas ungleich Bemerkenswerteres war als der sehr bedeutungslose Umstand, daß durch Geburt höher Gestellte etwas früher als andere in ein Gefolge eintreten konnten. Die folgende Stelle: »nec rubor« würde hiernach den Sinn haben: unerachtet der Vorliebe der Germanen für Freiheit halten sie doch den Eintritt in den Dienst eines Gefolgsherrn für ehrenhaft.
b) Erörterung des Streitpunktes aus der Geschichte und Verfassung
Nicht unmittelbar im Wege kritischer Hermeneutik überhaupt aber, nur mittelbar aus klarer Auffassung des Gesamtbildes der germanischen Verfassung, aus der Geschichte und dem Leben, läßt sich Ursprung und Wesen der germanischen principes richtig erklären.
Daß auch die Germanen, gleich anderen Völkern, einen Geschlechtsadel kannten und ehrten, ist, den so zahlreichen als zweifellosen Zeugnissen der Quellen gegenüber (zusammengestellt bei K. v. Maurer und Waitz), noch von keinem Forscher bezweifelt worden: nur über dessen Wesen und Bedeutung daher bewegt sich der Streit, zum Teil offenbar mehr über Worte, als über die Sache.
Zu näherer Feststellung des eigentlichen Streitpunktes ist zunächst vorauszuschicken, daß zu des Tacitus Zeit von einem Adelsstande späterer und moderner Art durchaus nicht die Rede sein kann.
Der germanische Adel war ein Erzeugnis, nicht eine Beschränkung der Volksfreiheit. Denn darin gerade gefiel sich der germanische Freiheitsstolz, daß er williger dem Sprößling eines durch alte Überlieferung oder neues Verdienst ausgezeichneten, über andere hervorragenden Geschlechts sich unterordnete – so weit dies überhaupt unentbehrlich war – als einem seinesgleichen.
Der Adel war sonach eine faktische Abstufung oder Klasse im Volke Er war die gesteigerte Gemeinfreiheit, die Edelfreiheit. ( D.), wie sich dergleichen fast bei allen Urvölkern finden. Solche Klassenverschiedenheit ist es denn auch, welche Tacitus durch den mehrfach gebrauchten Gegensatz von principes, proceres In den Stellen Ann. I, 55 und II, 15 sind unter proceres ausdrücklich die principes mit inbegriffen., primores und plebs oder vulgus andeutet (z. B. Germ. c. 10; Ann. I, 55; II, 15; Hist. IV, 14 und 25), Ausdrücke, welche dessen scharf unterscheidender Verstand auf das bloße Verhältnis der Obrigkeit zu den Untergebenen gewiß nicht angewandt haben würde.
Völlig undenkbar ist es, daß ein solcher im sechsten Jahrhundert in den Volksrechten ausdrücklich anerkannter Adel unter dem freiheitsstolzesten Volke der Menschengeschichte überhaupt habe entstehen können, wenn das Dasein eines solchen deren innerstem Freiheitsgefühle widersprochen hätte und nicht vielmehr gerade umgekehrt ihrer urtümlichen Sitte, ja ihrem Glauben möchten wir sagen, entsprossen wäre.
Als Vorzüge des Adels bezeichnen die Quellen:
1) die entscheidende Stelle bei Tacitus Kap. 7: Reges ex nobilitate sumunt, welche auch durch Kap. 42: »Marcomannis Quadisque usque ad nostram memoriam reges manserunt ex gente ipsorum; nobile Marobudui et Tudri genus« bestätigt wird. (Es ist höchst lehrreich, daß Tacitus hier nicht, wie sonst gewöhnlich, neben dem rex auch den princeps nennt: weil eben nur reges, nicht auch Grafen aus dem Adel genommen werden mußten: so daß die Abweichung von dieser Gewohnheit (bei Witichis) ganz besonders als seltenste Ausnahme hervorgehoben wird. D.) XI, 16 und 17, entscheidet der Vorzug des Geschlechts des Italicus sogar für den Römling und Verräters Sohn.
Es beweisen in letzterer Stelle auch die Worte, welche Tacitus bei dem späteren Parteistreit über Italicus dessen Gegnern in den Mund legt: adeo neminem iisdem in terris ortum, qui principem locum impleat, daß es bei der Wahl zum princeps locus, d. h. zum rex, vor allem auf die origo, das ist auf die Geburt von edlem Geschlechte, ankam.
2) Von nächstfolgender Wichtigkeit war ein zweiter (aber nur tatsächlicher ( D.)) Vorzug des Adels, daß dessen Genossen zu Haltung eines Gefolges zwar gewiß nicht für ausschließlich berechtigt, aber doch für vorzugsweise berufen und geeignet angesehen werden (s. unten).
3) Dies vorausgesetzt mußte der Adel auch, weil der Gefolgsherr nach Kap. 14 die Genossen mit Rossen, Waffen und Nahrung zu versehen hatte, vorzugsweise vermögend sein.
Nur auf einen Grundadel späterer Art darf durchaus nicht geschlossen werden: nicht der größere Besitz hatte den Adel, sondern umgekehrt der Adel tatsächlich den größeren Besitz zur Folge.
4) In der Volksversammlung führten nach Germ. Kap. 11 diejenigen vorzugsweise das Wort, welche entweder durch persönliche Würde und Eigenschaft, oder durch Adel sich auszeichneten.
5) Obwohl bei den Germanen, fast allein unter den Barbaren, regelmäßig Monogamie herrschte, so gestattete doch die Sitte nach Kap. 18, des Adels wegen, ob nobilitatem, mehrere Frauen, d. i. es ward für erlaubt angesehen, durch eine zweite Gemahlin aus edlem Geschlecht sich Zuwachs von Ansehen und Macht zu verschaffen, wie dies Ariovists Beispiel nach Cäs. I, 63 erläutert.
6) Wenn schon auch zu Tacitus Zeit, nach Kap. 12, der Totschlag unzweifelhaft durch eine an die Sippen zu zahlende Buße geahndet wurde, so wird doch eines höhern Wehrgeldes für Edle von ihm nicht ausdrücklich gedacht. Gleichwohl läßt das spätere allgemeine Vorkommen dieser Verschiedenheit in allen Volksrechten nicht bezweifeln, daß diese, in uralter Volksmeinung wurzelnd, auch zu Ende des ersten Jahrhunderts schon bestanden habe.
Waren dies die uns bekannten rechtlichen und faktischen Vorzüge, deren der germanische Adel jener Zeit genoß, so erscheint dessen Bestehen, wenn auch nicht als eigner, von den Freien grundsätzlich gesonderter Stand Höheres Wehrgeld ist das einzige Vorrecht: denn nicht einmal den Vor-Anspruch auf die Krone wird man als Recht, nur als einen moralischen, in der Geschichte und Gepflogenheit wurzelnden Vorsprung fassen dürfen. ( D.), doch als eine durch die Volksmeinung bevorzugte Klasse über jeden Zweifel erhoben.
Nicht Person oder Vermögen, einzig das Geschlecht ist es, welches auch dem Unerwachsenen, den Frauen und Töchtern des Adels höhere Würdigung verleiht (vergl. Tacitus G. c. 8 u. 13, sowie Ann. I, 57 in Verbindung mit 60), so daß die Völker sogar durch nichts wirksamer verpflichtet wurden, als dadurch, daß auch edle Die Lesart nubilis statt nobilis ist gewiß nicht haltbar. ( D.) Jungfrauen als Geiseln von ihnen verlangt wurden.
Gelang es, vorstehend das Bild des germanischen Adels in seinen Hauptzügen richtig zu entwerfen, so gewährt dasselbe zugleich den Schlüssel zu klarem Verständnis des germanischen Königtums, dessen Ursprung aus dem Adel, und zwar dessen erlauchtesten Geschlechtern, vorstehend genügend nachgewiesen sein dürfte. (Das königliche ist das edelste Adelsgeschlecht. D.) Kein erblicher Fürstenstand im heutigen Sinne, so wenig wie ein moderner Adelsstand. Es war ein faktischer Vorzug einzelner erlauchter Geschlechter, daß Könige nur aus ihnen genommen wurden, aber kein Erbrecht, keine Erbfolgeordnung: unter mehreren Söhnen oder Vettern wählte immer das Volk, dessen Bestätigung jedenfalls erst die Krone gab, wie dies die Folgezeit, obwohl in ihr das monarchische Ansehen schon weit ausgebildeter war, ganz außer Zweifel setzt. Nicht des Volkes Herren, nur dessen Häupter waren die Könige, deren Absetzung daher nicht Aufruhr, sondern legaler Volksbeschluß, bei den Burgundern sogar von Alters her (ex ritu vetere) wegen Kriegsunglücks oder Mißwachs üblich (Ammian. Marcellin. XXVIII, 5) war.
(Der Souverän ist auch in den königlichen, wie in den von Grafen geleiteten Staaten das Volk. D.)
Daß von obiger Regel nie eine Ausnahme stattgefunden, wird niemand zu behaupten wagen, die Quellen aber gedenken solcher nur in viel späteren Jahrhunderten S. Waitz I,1. Aufl., S. 71, Anm. 1 (Witichis) und Landau, S. 339 und 340, wo jedoch das Beispiel Odovakars mit Unrecht angeführt wird, da dieser kein vom Volk erwählter princeps, sondern nur Offizier eines geworbenen Kriegerhaufens war., während für des Tacitus Zeit gerade umgekehrt der Fall des Italicus beweist, wie sehr eine solche des Volkes innerstem Gefühle widerstrebte da es selbst in diesem Falle, wiewohl der dringendste Grund dafür vorlag, von dem alten Geschlechte nicht abging. Kein Gesetz beschränkte des freien Volkes Recht und Macht, auch minder Edle und Freie zu Königen zu wählen, aber die Sitte – der Glaube möchten wir sagen – aller Naturvölker höchstes und heiligstes Gesetz – stand gebieterisch entgegen.
(Auch zu Grafen wurden wohl sehr oft, ja meistens Edle gewählt – doch bestand hierfür keine moralisch-religiös gefärbte Verpflichtung: nur konnte dieses Amt immer nur Reicheren, d. h. also später größeren Grundbesitzern zufallen; der kleine Gemeinfreie konnte nicht so viele Zeit, als dies Amt erheischte, seiner Wirtschaft entziehen; auch hatten wohl nur die Edeln in der Regel die Beziehungen zu den Fürsten der Nachbarvölker, den weitern Blick über den Gau hinaus, der für die Leitung der äußeren Politik wünschenswert, wenn auch deren Entscheidung beim Volke stand. D.)
Zu II
Die Streitfrage ist folgende:
War bei den Germanen bis zu des Tacitus Zeit die Haltung eines Comitats ausschließliches Vorrecht der Könige und Fürsten, als Obrigkeiten, oder fanden auch damals schon Privatgefolge, d. i. solche, die dem Führer nicht in seiner Eigenschaft als Obrigkeit dienten, statt?
Erstere Meinung, nach welcher die Comitate ein integrierender Teil des Volksheeres, gewissermaßen ein stehendes Gardecorps des Fürsten waren, wird, in dieser Schärfe wenigstens, wohl nur von Waitz Waitz, S. 94, selbst gibt zu: »Ein ausdrückliches Zeugnis, daß es auf den Adel (nicht) ankam, um ein Gefolge halten zu dürfen, lasse sich freilich nicht anführen.« S. 94–100 und 124–127 (1. Aufl.), sowie von Paul v. Roth, S. 17–22 u. folg. verteidigt.
Neuere französische Schriftsteller, namentlich auch Guizot, gewöhnlich klarsehend, aber nicht überall auf den Grund gehend, erklären die germanischen Stämme fast durchgängig für eine bloße Vereinigung von »Bandenchefs« welche keine Art staatlichen Zusammenlebens kannten. (Dem gegenüber haben jene deutschen Forscher das Gefolge für eine Staatseinrichtung erklärt. D.)
Caesar d. b. g. VI, 23 berichtet von den Germanen im Allgemeinen:
»Latrocinia nullum habent infamiam, quae extra fines cuiusque civitatis fiunt. Atque ea juventutis exercendae ac desidiae minnendae causa fieri praedicant. Atque, ubi quis ex principitus in concilio se dixit ducem fore, ut qui sequi velint, profiteantur, consurgunt ii, qui et causam et hominem probant, suumque auxilium pollicentur: atque ab multitudine collaudantur: qui ex iis secuti non sunt, in desertorum ac prodilorum numero ducuntur: omniumque rerum iis postea fides abrogatur.«
Das Concilium, dessen Cäsar an dieser Stelle gedenkt, ist das des Gaues. Wenn nun nach dieser Stelle: » aliquis ex principibus« zur Teilnahme an einem Zuge aufforderte, so kann damit nicht der Gaufürst, als einziger princeps, im engern Sinne gemeint, vielmehr muß der Ausdruck hier in weiterem Sinne gebraucht sein.
Tacitus fährt in der Stelle vom Comitat Kap. 13, deren Eingang bereits unter I, b erwähnt ward, folgendermaßen fort:
»Haec dignitas, hae vires, magno semper electorum juvenum globo circumdari, in pace decus, in bello praesidium. Nec solum in sua gente cuique, sed apud finitimas quoque civitates id nomen, ea gloria est, si numero ac virtute comitatus emineat: expetuntur enim legationibus et muneritus ornantur, et ipsa plerumque fama bella profligant. Cum ventum in aciem turpe principi virtute vinci, turpe comitatui virtutem principis non adaequare. Iam vero infame in omnem vitam ac probrosum, superstitem principi suo ex acie recessisse. Illum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriae ejus assignare, praecipuum sacramentum est. Principes pro victoria pugnant, comites pro principe. Si civitas, in qua orti sunt, longa pace et otio torpeat: plerique nobilium adolescentium petunt ultro eas nationes, quae tum bellum aliquod gerunt, quia et ingrata genti quies, et facilius inter ancipitia clarescunt, magnumque comitatum non nisi vi belloque tueare; exigunt enim principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam victricemque frameam. Nam epulae, et quamquam incomti, largi tamen apparatus, pro stipendio cedunt.«
In dieser Stelle ist der Satz: »si civitas longa pace torpeat, plerique nobilium adolescentium bis: quia magnum comitatum non nisi vi belloque tueare« entscheidend, die Streitfrage aber folgende:
Hat Tacitus durch die plerique nobilium adolescentium die principes oder die comites bezeichnen wollen?
Ersteres behaupten die älteren, letzteres einige neuere Ausleger.
Liest man den ganzen Satz von: si civitas bis magnumque comitatum non nisi vi belloque tueare, ohne den darauffolgenden, so ist es, weil in diesen letzteren Worten unzweifelhaft von der Haltung eines Gefolges die Rede ist, in der Tat fast unmöglich, unter den edlen Jünglingen etwas anderes als Gefolgsherren zu verstehen. Nur der Nachsatz: »exigunt enim principis sui liberalitate« etc., der sich offenbar auf die Gefährten bezieht, hat die Meinung hervorgerufen, daß auch der Vordersatz sich auf die comites beziehe. Es ist nicht zu leugnen, daß des Tacitus – bisweilen beklagenswerte – Kürze zu einem Zweifel hier Anlaß gibt, weil er im zweiten Satze, ohne dies anzugeben, das Subjekt wechselt, was durch Beisatz des einzigen Wortes: »comites«, nämlich: »exigunt enim comites etc.« vermieden worden wäre. Unstreitig fand er dies überflüssig, weil sich der zweite Satz selbstredend nur auf die comites beziehen kann. Ebenso aber der erste, an sich betrachtet, auf die Gefolgsherren oder principes. Tacitus sagt: Wenn daheim langer Frieden, suchen die meisten edlen Jünglinge fremde Völker auf; wo eben Krieg ist, weil
1) dem Volke Ruhe unbehaglich,
2) in Gefahren Ruhm zu erwerben und
3) ein großes Gefolge nur im Kriege zu behaupten ist.
Nach der von Waitz angenommenen Auslegung Erste Auflage. wäre aber letzteres nicht persönlich, sondern nur objektiv zu verstehen; weil große Gefolge überhaupt nur im Kriege gehalten werden können, also nur in solchem ausreichende Gelegenheit des Eintritts in ein Comitat vorhanden ist.
Drei Motive führt Tacitus an: zwei subjektiver Selbstbestimmung, die sich allerdings sowohl auf die Gefolgsführer, als auf deren Genossen beziehen können: diesen schließt sich dann das dritte an, welches mit den ersteren durch die Copula und verbunden ist, und dem Wortlaute nach unzweifelhaft auf Gefolgsherren sich bezieht, in diesem Sinne aber, wie die beiden ersteren, ebenfalls nur ein Grund subjektiven Ermessens ist. Hätte nun Tacitus damit bloß den objektiven Satz: » daß große Gefolge überhaupt nur im Kriege gehalten würden,« ausdrücken wollen, so wäre dies so leicht deutlich zu bezeichnen gewesen, daß man ihn geradezu einer groben Unklarheit, welche er sofort fühlen mußte, beschuldigen würde, wenn man jener Stelle, statt des einfachen buchstäblichen, jenen anderen Sinn unterlegen wollte. Damit aber sollte man, einem scharfen Denker wie Tacitus gegenüber, vorsichtig sein, im Zweifel mindestens voraussetzen, daß er sich richtig ausgedrückt habe.
Ferner konnten die comites an sich ihrer größten Mehrzahl nach nicht nobiles, sondern nur ingenui sein. Hätte daher Tacitus durch plerique nobilium adolescentium gerade die comites, im Gegensatze zu dem princeps, bezeichnen wollen, so würde er dafür ein im Wesentlichen unwahres Beiwort gebraucht haben. Oder man müßte annehmen, nicht bloß die Freien, sondern nur die Adligen unter den comites hätten das Vorrecht gehabt, in das Ausland nach Krieg, Beute und Ruhm auszuziehen – eine Ansicht, die zu absurd wäre, Widerlegung zu verdienen.
Endlich handeln beide Kapitel ausschließlich von dem Gefolgsherrn und dessen Gefährten, in jedem Satze fast wechselt das Subjekt, überall aber ist nur von dem einen in Bezug auf den andern die Rede. Nicht so nach der neuen Auslegung. Nach solcher könnten die edlen Jünglinge überhaupt gar keine comites gewesen sein: denn diese handeln nicht selbständig, sondern folgen ihrem princeps: Tacitus müßte hier daher in dem »petunt ultro eas nationes etc.« auf eigene Faust ausziehende Abenteurer gemeint haben, die, bisher keinem Comitate angehörig, sich im Auslande erst einen princeps suchen, also erst comites werden wollten.
Dies hätte mindestens nicht zum Bilde des fertigen Comitats gehört, vielmehr, als eigentümlich und anomal, wohl besonderer und zwar deutlicherer Hervorhebung bedurft.
Aus allen diesen Gründen dürften die nobiles adolescentes gewiß nur auf Gefolgsführer bezogen werden können, mithin allerdings für meine Meinung beweisen, obwohl ich nur unsicher der Hoffnung mich hingebe, meine Gegner durch obiges überzeugt zu haben. Die Stelle spricht von Gefolgsherren und von Gefolgen; auf beide gehen die ersten beiden angegebenen Motive gleich stark, das dritte mehr auf die Herren, aber auch auf die Gefolgen. ( D.)
Tacitus berichtet Hist. IV, 12 von den, nach Britannien geschickten Kohorten der Bataver »quas vetere instituto nobilissimi popularium regebant.«
Diese Kohorten waren auxilia, welche, nach Paul v. Roths gründlicher Erörterung eigene vaterländische Führer hatten, wie dies selbst bei den Galliern (großenteils wenigstens) und bei den Thrakern stattfand, welche letztere (Ann. IV, 46) sagen: »si mitterent auxilia suos ductores praeficere.«
Waitz wendet ein (1. Aufl.) S. 91: dies sei Besonderheit der Bataver, und eben deshalb hervorgehoben, was man in dem Falle allerdings wohl anzunehmen hätte, wenn es bei Beschreibung der Eigentümlichkeiten dieses Volkes etwa in der Germania gesagt würde. Aus obiger gelegentlicher geschichtlicher Erwähnung aber läßt sich eine derartige Ausnahme von einem allgemeinen germanischen Brauche für die Bataver um so weniger folgern, da diese nicht einmal einem besondern Stamme, sondern, wie an dieser Stelle kurz zuvor und Germ. 29 bemerkt wird, ursprünglich dem der Chatten angehörten.
Ob jene Kohorten freiwillige Gefolge oder zum Felddienste ausgehobene Kohorten waren, ist gleichgültig: ja für Stellung und Ansehen des Adels würde es sogar noch mehr beweisen, wenn selbst mobile Nationaltruppen nach alter Sitte stets unter adligen Führern stehen mußten.
Cäsars kurze Grundzüge und des Tacitus lebendige Schilderung stimmen darin überein, daß das Comitat ein rein persönliches Verhältnis seltener Innigkeit war.
Wenn der princeps aufruft, sagt ersterer, melden sich die, qui et causam et hominem probant. Dies kann sich nicht auf den Fürsten als Obrigkeit beziehen: (denn nicht als Obrigkeit hatte er ein »latrocinium« zu beschließen: die Volksgemeinde beschloß den Krieg, nicht ein solches latrocinium D.). Tacitus aber, von der Großartigkeit germanischen Heldentums und seiner Treue, die im Comitate hervortritt, ergriffen, schildert fast mit Begeisterung dies Bild wechselseitiger Treue und Hingebung.
Der Gefolgsherr muß der Erste im Kampfe sein, die Gefährten bringen ihm Leben und Ehre in freudiger Selbstverleugnung dar. Ein solches Verhältnis muß notwendig ein durch und durch freies gewesen sein. Dies hörte auf, wenn nur die Obrigkeit ein Gefolge zu halten berechtigt war.
Feindliche Parteien bestanden auch im Volke, was Tacitus von Segest, Armin, Inguiomer, Italicus u. A. ausdrücklich berichtet. Nach der Vorliebe für diesen oder jenen, nicht nach der obrigkeitlichen Stellung, richtete sich dann sicherlich der Eintritt in das Gefolge, ein Einwand, der sich nur dadurch beseitigen ließe, wenn man, aller Wahrscheinlichkeit zuwider, annähme, die Partei habe sich überall genau nach den Gaubezirken abgegrenzt, die des einen Gauhäuptlings daher eben nur die Eingesessenen seines Bezirks umfaßt.
Der Gefolgsherr mußte ferner von ausgezeichneter Heldenkraft sein: der Gaugraf oder König wurde alt: (er zog nie auf latrocinia oder doch nicht mehr im Alter D.): die Ernennung eines Stellvertreters hätte die Freiheit der Gefährten, dessen Wahl durch letztere das Prinzip obrigkeitlichen Vorrechts gebrochen.
Vor allem aber ist es mit des Tacitus Geist und Darstellung unvereinbar, daß er das Gefolge für einen wesentlichen Bestandteil des öffentlichen Wehrsystems, dessen Haltung für obrigkeitliches Vorrecht angesehen hätte, ohne dieses wichtigen Umstandes auch nur mit einer Silbe zu gedenken.
Gelang es, vorstehend nachzuweisen, daß Könige und Grafen in der Regel nur aus den edelsten Geschlechtern gewählt wurden, so folgt hieraus, nach dem Schluß vom mehreren auf das mindere, gleichartiger faktischer Vorzug des Adels freilich auch für die Stellung als Gefolgsherren. Gerade bei dem ganz freiwilligen Eintritt in das Gefolge mußte sich das in der Volksmeinung wurzelnde Gefühl höhern Ansehens edler Geschlechter am naturgemäßesten bewähren, zumal bei ihnen, nach Tacitus Germ. Kap. 26, das dafür unentbehrliche bedeutendere Vermögen vorzugsweise vorauszusetzen war.
Daß die Gefolgsherren häufig über die Grenze zogen, nicht nur für einzelne latrocinia, sondern auch auf bleibende Eroberungen, daß sie an den Kriegen fremder Völker sich beteiligten, in Solddienst traten, ist teils aus Cäsar und Tacitus mit Sicherheit, teils im Allgemeinen mit so überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß v. Roth selbst S. 30 zu dem Schluß kommt: die Angriffskriege der germanischen Stämme seien häufig genug, nur nicht ausschließlich oder hauptsächlich, Sache der Gefolgschaften gewesen. Genauer: Die Streifzüge der Gefolgschaften gewährten gewaltsame Rekognoszierungen, Ausspähungen der Wege, der Grenzwehren, Truppenstellungen und Truppenstärke, waren sehr oft Vorbereitungen für den später folgenden Angriff des Volksheeres, die Ausbreitung des wandernden Volkes. ( D.)
Ist es nun, besonders in der früheren Zeit, wo die »latrocinia« so häufig waren, denkbar, daß der König oder Graf, welcher daheim den Frieden zu bewahren, Priestertum und Gericht zu pflegen, monatlich zwei Versammlungen der Gaugenossen zu leiten hatte, zugleich als Bandenführer im Auslande fungiert habe? Dies wäre nicht allein mit dessen Beruf, auch mit dessen Würde, aller Vorliebe der Germanen für den Krieg, selbst für Raubzüge unerachtet, endlich mit der einfachsten Politik geradezu unvereinbar gewesen, da des Königs oder Grafen Unternehmungen und Niederlagen nicht ohne Rückwirkung auf sein Volk bleiben konnten. Dies erkennen auch die Gegner, welche die Gefolge nur für einen Teil des Volksheeres halten, an, müßten dann aber, um konsequent zu sein, auch behaupten, daß es überhaupt niemals bloße Gefolgskriege, sondern lediglich Volkskriege gegeben habe, da nicht die Truppe, welche zunächst ins Feld rückte, sondern lediglich, von wem und in wessen Interesse der Kriegsbeschluß erfolgte, den Unterschied zwischen Volks- und Sonder- oder Gefolgskriegen begründen konnte.
Wir finden endlich in Tacitus mehrere Fälle, wo teils der Gefolgsführer nicht zugleich Fürst ist, teils aber, und das sind bei weitem die wichtigsten, die Gefolge in offenem feindlichen Gegensatze zu dem Nationalwillen stehen, was deren Auffassung als Teil des Nationalheeres geradezu widerstreitet.
Gannascus (Ann. XI, 18; vergl. die Geschichte dieses Ereignisses unten) war Kanninefate, hatte bei den Römern mit Auszeichnung gedient, desertierte aber zu den Chauken und unternahm mit chaukischer Mannschaft zuerst Raubzüge zur See besonders nach Gallien (levibus naviis praedabundus, Gallorum maxime oram investigabat), dann auch nach Niederdeutschland, wo ihn Corbulo vertrieb. Daß Gannascus nicht König oder Graf der Chauken war, steht, abgesehen von seiner fremden Nationalität, wohl außer Zweifel, da er bis zu seiner Desertion in römischem Kriegsdienst stand.
Daß seine Mannschaften Gefolgen waren, ist nicht ausdrücklich gesagt, kann aber bei der Natur solcher Raubzüge, die nur durch disziplinierte, kriegsgeübte Freiwillige ausgeführt werden konnten, kaum bezweifelt werden. Staat und Volk der Chauken aber haben solche Fahrten vielleicht insgeheim begünstigt, dadurch Feindseligkeit gegen Rom an den Tag gelegt, aber keinen Volkskrieg gegen dasselbe geführt.
Nach Ann. I, 57 bittet Segest die Römer um Hilfe adversus vim popularium, a quis circumsedebatur, und wird magna cum propinquorum et clientium manu der Gefahr entrissen. Da Segest, selbst nach der Meinung der Gegner, Gaukönig (nach anderen: Graf) war, sonach auch ein Gefolge haben mußte, so kann sich die magna clientium manus offenbar nur auf dessen Gau und Gefolge beziehen, welches hiernach also die Treue gegen den, wiewohl römisch gesinnten, Führer dem Willen und Gefühl der übrigen Völkerschaft vorzog. Armin selbst, als er (Ann. II, 88) nach längerem Kampfe mit dem Volke (dum varia fortuna certaret) gestürzt wird, kann sich im Wesentlichen nur mittelst seines Gaues und Gefolges gegen dasselbe eine Zeitlang behauptet haben.
Als Sueben und Cherusker ferner (Ann. II, 45) miteinander kriegen, geht Inguiomer, unstreitig ebenfalls cheruskischer Gaukönig (nach anderen: Graf), cum manu clientium zu Marobod über.
Derselbe Vorgang bei Marobod und Catualda, den markomannischen Königen (Ann. II, 63), denen ihre Gefolge auch nach der Vertreibung treu blieben. Auch Vannius folgen (Ann. XII, 30), als er dreißig Jahre später vertrieben wird, die Gefolgen in römisches Gebiet nach.
Schlagend bewähren diese Fälle, daß die Gefolge nicht der Obrigkeit, sondern nur der Person dienten, daß sie die Treue gegen ihren Herrn oft über Volksbeschluß und Nationalgefühl setzten.
Der vom Volk Bekriegte und Verbannte, der Überläufer, war nicht mehr König oder Graf, blieb aber immer noch seines Gefolges Herr. –
Nicht darin aber, ob der Gefolgsherr für seine Person zugleich ein königliches (nach anderen: obrigkeitliches) Amt bekleidete, wie bei Segest, Armin und Inguiomer allerdings der Fall war, sondern darin nur, ob dessen Gefolge ein öffentliches, ihm als Obrigkeit untergebenes Institut oder ein rein privates war, ruht der Kern der Streitfrage überhaupt. Die Gegner verwerfen die Privatgefolge als eine mit der Gemeindeordnung unvereinbare Anomalie, ihres Prinzips wegen, müssen aber doch selbst einsehen, daß es eine noch viel größere und gefährlichere Anomalie gewesen sein würde, der in ihrem öffentlichen Amte sonst vom Volkswillen abhängigen Obrigkeit (einem republikanischen Grafen! D.) die Haltung einer rein persönlichen, von letzterem unabhängigen Hausmacht zu gestatten, als einem bloßen Privaten, der als solcher immer noch der Obrigkeit untergeben war.
Ist in vorstehendem genügend dargetan, daß die Meinung der Gegner, in ihrer vollen Schärfe wenigstens, mit den Quellen und der Geschichte unvereinbar ist, so liegt noch ob, die entgegen stehende Ansicht über das Comitat und dessen Entwicklung bis zu des Tacitus Zeit im Zusammenhange darzulegen und damit die Widerlegung des aus der Unvereinbarkeit der Privatgefolge mit der germanischen Volkssouveränität entlehnten Haupteinwandes zu verbinden.
Die Wurzel des Gefolgswesens war eine doppelte:
Durch Blut, nicht durch Schweiß, trachtete der Germane zu erwerben (Germ. c. 14 a. Schl.). Undenkbar war damals eine Gemeinverfassung, welche die einzelnen behindert hätte, außerhalb des Bezirks des Gemeinfriedens (in feindlichem oder doch gleichgültigem, nicht befriedetem und befreundetem Lande D.) dem Betriebe ihres Lieblingsgewerkes nachzugehen. Um so undenkbarer, je wichtiger die Gefolgsfahrten als militärische Vorschule, oft als Vorbereitungen des Volkskrieges für das Gemeinwesen selbst waren.
Zu Cäsars Zeit blühten solche Fahrten (VI, 22. 6), z. B. gegen Helvetier und Gallier, wie der Sueben gegen die Ubier. Als Rom dem Schweifen Schranken gesetzt, wurde deren Schauplatz wesentlich beschränkt, Trieb und Gelegenheit aber nicht vernichtet. (Zu Civilis strömen solche Gefolgschaften wohl in reicher Zahl; im vierten Jahrhundert fechten alemannische Gefolgschaften eines den Römern unterworfenen Gaus wider Willen des Gaukönigs gegen die Römer. D.)
Daß nun die »latrocinia« Cäsars nicht Volks-, sondern Privatkriege einzelner Führer waren, hat schwerlich jemand geleugnet. Daraus folgt aber unabweisbar, daß nicht die Gaukönige oder Gaugrafen, als Obrigkeiten, dazu auszogen, sondern andere, welche durch persönliches Ansehen die nötige Mannschaft sammeln konnten.
Ob aber Cäsars »latrocinia« durch wirkliche ordentliche Comitate ausgeführt wurden oder nur durch außerordentliche, ad hoc gebildete Freischaren unter einem Führer, ist nicht zu entscheiden. Die Wahrheit liegt auch hier unstreitig in der Mitte. Die Heiligkeit der einmal übernommenen Verpflichtung, die Cäsar an jener Stelle hervorhebt, beweist, daß das ganze Verhältnis vom Volksgeiste getragen und begünstigt wurde. Der glückliche Führer wiederholte sicherlich seine Züge, entließ aber in der Zwischenzeit größtenteils die Mannschaft, nur einzelne Treue und Tapfere, gewissermaßen als Offiziere, bei sich behaltend, um deren Teilnahme für die Zukunft desto gesicherter zu bleiben.
Welche Ausbildung das Gefolgsystem zu Cäsars Zeit hatte, ist unerforschlich; daß es in seinen Grundzügen vorhanden war, nicht zu bezweifeln. Privatgefolge bestanden, gleich viel, ob bleibend oder vorübergehend, nach obigem schon unter Cäsar, wie zweifellos in späterer Zeit. Doch gehe ich nicht so weit, etwa Ariovists ganzes Heer von 120 000 Mann für lediglich aus Gefolgen zusammengesetzt zu erklären. Diese bildeten aber unstreitig den Kern und dienten der Formierung und Gliederung des Gesamtheers zur Grundlage, was dessen Teilung in Völker und Geschlechter keineswegs widerstrebte, vielmehr umgekehrt im Wesentlichen daraus hervorgegangen war. Wenn v. Roth, S. 22, sagt: Die Wikingerzüge und die sächsischen Seeräuber bewiesen dafür gar nichts, weil dies lediglich organisierte Räuberbanden gewesen, so hat er übersehen, daß auch die latrocinia Cäsars, des Gannascus und viele andere, deren die Geschichte gedenkt, nichts als Raubzüge waren, die Organisation dafür aber eben das Gefolgsystem darbot.
Es fragt sich nun, welchen Privatpersonen das Recht, ein Gefolge zu halten, zustand, und wie sich deren Stellung mit der Ordnung des Gemeinwesens vereinbaren ließ?
Die Haltung eines Gefolges war keine Rechts-, sondern lediglich eine Tatfrage. Wer das persönliche Ansehen hatte, Gefährten um sich zu sammeln, die Mittel, solche zu bewaffnen, teilweise wenigstens zu ernähren (und endlich Durst nach Tat und Ruhm ( D.)), der hielt sich ein Gefolge.
Bestand nun überhaupt (was auch Löbell und Waitz zugeben) ein Erbadel, aus dessen erlauchtesten Geschlechtern, wie letzterer mindestens einräumt, die Könige gewählt wurden, bestand ferner Verschiedenheit des Vermögens, die sich bei der Ackerteilung secundum dignationem, wie in Kleidung und Bewaffnung kund gab (Germ. c. 26. 17 und 6), so würde es höchste Unnatur sein, zu bezweifeln, daß der Adel in der Regel vorzugsweise angesehen und vermögend war. Undenkbar wäre es in der Tat, einen Erbadel überhaupt anzunehmen, der, ohne rechtliches Privilegium (abgesehen vom höheren Wehrgeld D.), nicht einmal auf faktischen Vorzügen beruht habe. Muß daher derselbe dergleichen besessen haben, so wurzelt auch hierin notwendig dessen vorzugsweise faktische Befähigung zu Haltung von Gefolgen.
Aus dem allen folgt aber keineswegs, daß der Adel bei den Germanen über Verdienst gestanden, dies verdrängt hätte. Wie unter den Genossen des Adels unstreitig die Persönlichkeit entschied, so hinderte gewiß auch nichts den einfachen Freien (wie dies z. B. Gannascus vielleicht war), der ausgezeichneten Kriegsruhm und genügendes Vermögen dafür besaß, Gefährten um sich zu versammeln.
Nur ist dies, dem Volksgeiste gegenüber, welcher sich dem Adel, der aus ihm lediglich seine Kraft saugte, williger unterordnete, als Ausnahme zu betrachten.
Die Existenz unabhängiger »Bandenchefs«, welche sich der Gemeinde gegenüber stellten, ihre persönliche Macht über die der Gemeinde erhoben, Freiheit und Sicherheit der einzelnen gefährdeten (vergl. Waitz S. 94 und 95), ist auf keine Weise vorauszusetzen. Der Gefolgführer war Mitglied und Untertan der Gemeinde. Die Sitte, so mächtig im Volke, National- und Pflichtgefühl wehrten dem Mißbrauche persönlichen Einflusses.
Auch fehlte sicherlich zu solcher Auflehnung die Macht, da nicht allein das Volksheer, sondern auch die Gefolgschaft des Königs oder Grafen, gewiß zahlreicher als das des Privaten, solchem Frevel entgegengestanden haben würde.
Endlich gingen die Gefolge in der Heimat und im Frieden größtenteils auseinander: nur ein kleiner Stamm, wohl auch die Verpflichtung, auf Geheiß sich wieder zu sammeln, blieb vorbehalten. Endlich wurden die Gefolgschaften zu des Tacitus Zeit, weil die Gelegenheit zu latrociis beschränkter, das internationale Verhältnis der Völker ausgebildeter und befestigter war, überhaupt seltener, als in der Cäsars: nur der Behauptung völliger Nichtexistenz und absoluter Unstatthaftigkeit ist zu widersprechen (da sie ja in noch viel späterer Zeit begegnen. D.).
Für die Staatsordnung aber war es gleichviel, ob sie von Fürsten oder Privaten mittelst ihrer Gefolge durchbrochen wurde: nur drohte ungleich höhere Gefahr in den Comitaten der Fürsten, weil sich hier die persönliche Macht mit der amtlichen in einer Person verband.
Fügen wir noch einiges über Geschlechtsverfassung bei.
Daß die Familie der erste Kreis menschlicher Vereinigung, der Familienvater das erste natürliche Oberhaupt war, daß bei der wachsenden Zahl der Familien in diesen das Bewußtsein eines gemeinsamen Geschlechts fort und fort lebendig und wirksam blieb, die hiernach zusammengehörigen Geschlechter daher einen gemeinsamen Stamm bildeten, ist noch von niemand bezweifelt worden. Je mächtiger in den Urvölkern aber der Naturtrieb war, um so sicherer mußte sich die erste rohe Befriedigung des Bedürfnisses geselliger Ordnung allenthalben an diese, naturgemäß dafür schon vorhandene Gliederung anschließen.
So wurde die Geschlechtsverfassung die Grundlage (richtiger: Vorstufe; D.) der ersten staatlichen oder politischen Ordnung.
Wie dies die denkende Betrachtung ergibt, so bestätigt es die Geschichte. Bei denjenigen Völkern, deren Altertums wir am kundigsten sind, bei Griechen und Römern, beruht es außer Zweifel: ja bei solchen Völkern, namentlich höherer Rasse, welche dem großen europäischen Kulturprozeß fremd geblieben sind, wie Tscherkessen und Beduinen, Albanesen und Kurden, finden wir heute noch die Reste der Geschlechtsverfassung in lebendiger Wirksamkeit.
Die fortschreitende Entwicklung aber bedurfte weiterer, dem komplizierteren Bedürfnisse entsprechender Ausbildung, wozu die Geschlechtsverfassung nicht überall bildsam und dehnbar genug sein mochte. Dies galt vor allem von dem germanischen Volksstamme, dem Wandertrieb und Kriegslust Uranlage waren. Die Zehnteilung, hauptsächlich in ihrer zweiten Stufe, der Hundertschaft, nebenher aber auch in der ersten und dritten der Tausendschaft war bei manchen (nicht allen D.) germanischen Völkern vielleicht eine Fortbildung der urtümlichen Geschlechtsverfassung zu militärischen Zwecken. Aber gewiß ruhte diese nicht auf Organisationswillkür, auf nivellierendem Zerreissen des alten Bandes und planmäßigem Durcheinanderwerfen sich fremder Elemente.
Keine Revolution, nicht einmal eine Reform in unserm Sinn lag darin: nur eine praktische Entwicklung, um die alte Verfassung für das neue Bedürfnis passender einzurichten.
Dies ergibt sich am sichersten daraus, daß die oberste Verfassungseinheit, die Völkerschaft, von der Neuerung unberührt blieb: daher das Geschlechtsprinzip, worauf diese doch selbst beruhte, bei dessen weiterer Gliederung im Innern unmöglich verlassen worden sein kann.
Für die Germanen wird dies übrigens durch Tacitus Germ. Kap. 7 außer Zweifel gesetzt, indem er, von deren Heerordnung redend, hinzusetzt: »non casus, nec fortuita conglobatio turmam aut cuneum facit, sed familiae et propinquitates.«
Wir können daher nicht zweifeln, daß, indem auch Germanenvölker (gleich den Römern) aus einleuchtenden militärischen Rücksichten eine Schar von Hunderten zum untersten Gliede der taktischen Einheit bestimmten, bei deren Zusammensetzung die geschlechtliche Verbindung; so weit die höhere militärische Rücksicht es irgend gestattete, fortwährend maßgebend geblieben sei.
Die erste Niederlassung der Germanen war nichts als eine stehende Lagerung des mobilen wandernden Heeres: daher ward selbstredend das eingenommene Land ebenso abgeteilt, wie das Heer, von jeder Gliederung dieses letzteren ein entsprechender Bezirk eingenommen, die Vorsteher der Stämme wie der Hundertschaften wurden nun auch Vorstände der Gaue und Cente und als solche bürgerliche Obrigkeiten.
Das Detail dieser Bildung ist unerforschlich, die Hauptsache steht zweifellos fest.
Wenn bei der Abteilung des Heeres die wirkliche Zahl der Mannschaften mit der Sollzahl, welche der Name ausdrückte, unstreitig nahe übereinstimmend war, so mußte dies doch in der Zeit der Seßhaftigkeit, in Folge des, zumal ungleichartigen, Anwachsens der Bevölkerung, wesentliche Änderung erleiden. In dieser Zeit schrieb Tacitus, sagt daher G. c. 6 mit Recht: »quod primo numerus fuit, jam nomen et honor est«. Die unmittelbar vorhergehende Stelle: centeni ex singulis pagis sunt: idque ipsum inter suos vocantur, et quod primo etc. setzt es ebenso, wie die Stellen, wo Cäsar d. b. g. I, 37 und IV, 1, und Tacitus c. 12 auch für mich außer Zweifel, daß diese Schriftsteller die Zahlen mit dem Abteilungs- oder Bezirksnamen zum Teil verwechselt haben. Dies macht auch die Erklärung jener ganzen, von der Mischung des Fußvolks mit Reiterei handelnden Stelle sehr schwierig. Sie lautet: »mixti proeliantur, apta et congruente ad equestrem pugnam velocitate peditum, quos ex omni juventute delectos, ante aciem locant. Definitur et numerus: centeni ex singulis pagis sunt, idque ipsum inter suos vocantur, et quod primo numerus fuit, jam nomen et honor est.«
Die wörtliche Übersetzung: »Je Hundert sind es aus jedem Gau«, ist mit dem Nachsatz nicht füglich zu vereinigen. Landaus Erklärung, S. 311, centeni seien die Häuptlinge der Centen, welche die Schar jedes Cent befehligten, ist mit dem Wortlaute völlig unvereinbar.
Die centeni, weil aus den Centen zu diesem Dienst kommandiert, führten vielleicht den technischen Namen der »Hunderter« (Centleute).
Das Mißverhältnis mußte auch so lange fortwährend wachsen, bis eine neue Abteilung oder Gliederung der Landteilung eintrat, bei welcher jedoch sicherlich schon politische und Kulturzwecke die militärischen weit überwogen, obwohl die alte Heerordnung im Wesentlichen gewiß so lange sich erhalten hat, als der Heerbann oder das allgemeine Nationalaufgebot überhaupt bestand. (Bei einzelnen Germanenvölkern haben auch Tausend- und Zehntschaften bestanden: so bei Ost-, West-Goten, Vandalen. D.)Auf die Ausbildung der Verfassung aber haben diese Teilungen nur untergeordneten Einfluß ausgeübt. Als Beweis für eine urtümliche Abteilung nach Tausendschaften auch bei Westgermanen ließe sich etwa die Stelle Cäsars d. b. G. IV, 1 anführen, wonach die Sueben jährlich 1000 Bewaffnete auf Kriegszüge über die Grenze sandten. Häufiger als die Tausendschaften sind übrigens die Zehntschaften, Decanien.
Die Gliederung im Volke war also eine doppelte: eine persönliche militärische und eine dingliche oder territoriale, beide im Ursprunge identisch, weil die Landteilung unmittelbar aus der Heerteilung hervorging, aber verschieden in Entwicklung, Bedeutung und Folgen. Natürlich: weil das alte Heerwesen, später durch das Lehnssystem immer mehr überflügelt, seiner Auflösung entgegen welkte, indes der politische Fortschritt der schon bestehenden Landteilung sich anschloß, diese weiter ausbildete, vor allem aber durch Erweiterung der territorialen Gewalten die gegenseitige Abgrenzung der Bezirke derselben wichtiger und wirkungsvoller machte.
Als sich nun das Volk und das Heer zuerst bleibend gelagert hatte, d. i. seßhaft geworden war, bedurfte es der Bezeichnungen für das sowohl von ihm überhaupt als von dessen einzelnen Gliedern eingenommene Gebiet: und zwar wiederum in doppelter subjektiver persönlicher und in objektiver territorialer Beziehung. Die Besitznahme oder Anweisung irgendeines Landesteils kann ohne dessen vorgängige, wenn auch nur ganz rohe Begrenzung gar nicht gedacht werden.
Die Abgrenzung (Gemarkung) war also deren erstes Erfordernis. Was natürlicher nun, als daß man das durch die Marke (als Grenze) umschlossene Gebiet selbst Mark nannte. Mark bedeutet daher nichts anderes als Bezirk oder Distrikt überhaupt, den großen wie den kleinen. Zuerst ist es auch für den Bezirk der obersten Einheit der Völkerschaft oder doch des Gaus angewendet worden: jetzt ist es nur noch für den kleinsten Maßstab (Feldmark, Gemeindemark, wüste Mark), in Gebrauch.
Während man nun für die rein territoriale Bezeichnung an sich nur ein einziges Wort hatte, kam für diejenige, welche zugleich den Kreis der Insassen angab, später eine mehrfache in Anwendung, besonders für Gau und Cent. Da aber das persönliche Prinzip in der Verfassung immer mehr von dem territorialen überwogen und verdrängt wurde, so nahmen auch letztere Bezeichnungen immer mehr eine rein geographische Bedeutung an, was besonders von dem Gaue, pagus, gilt, während bei den Centen der Name wenigstens fortwährend an die alten Hundertschaften erinnert.
Daher finden wir große und kleine Gaue und Centen und in den Urkunden späterer Jahrhunderte wird Gau, pagus, schlechterdings nur als allgemeine territoriale Bezeichnung überhaupt ganz synonym mit dem heutigen Worte: Bezirk angewendet, so daß der Ausdruck: Gau ausnahmsweise bisweilen sogar ein ganzes Land (pagus Saxoniae, Turingiae), bisweilen aber auch nur eine einzelne Dorfmark bedeutet.
Es ist müßig, zu streiten, ob Gau und Mark identisch oder verschieden sind, denn sie sind beides. » Mark bezeichnet einen rein örtlichen, lediglich den Grund und Boden umfassenden, einheitlichen Bezirk, Gau aber eine, auf der Gliederung des Volkes in Stämme beruhende, kurz eine politische Abteilung.« Landau, die Territorien, S. 190.
Aber jeder Gau hatte auch seine Mark: und in späterer Zeit wenigstens ward Gau, wo nicht ausschließlich, doch gewiß meist nur für einen territorialen Bezirk, also identisch mit Mark gebraucht.
Für die Urzeit ist die Frage von Wichtigkeit: was zu des Tacitus Zeiten unter Gau, pagus, verstanden worden sei.
(Es gab offenbar kleine Völkerschaften mit etwa nur zwei Gauen (Fosi): ja vielleicht auch Einzelgaue (pagi), die zu keiner Völkerschaft mit anderen verbunden waren, während größere Völkerschaften wie Brukterer, Chauken, Cherusker usw. auf Vereinigung mehrerer Gaue beruhten. Vergl. Dahn, Könige I, s. v. civitas, pagus. Von den Cheruskern wird dies durch Strabo, der VII, S. 291 von den υπήκοοι der Cherusker spricht, unterstützt. Die Chauken werden von Plinius d. Ä. XVI, 1 ausdrücklich haucorum gentes genannt. Landau, S. 257, führt die Chatten als Beispiel der Stetigkeit der Verhältnisse an und meint, die beiden »Gaue«, der fränkische Hessengau und der Oberlahngau, habe von jeher die Einteilung des Chattenlandes gebildet. Gewiß hat man später bei Bildung der fränkischen Gaue alte vorgefundene Gliederungen verwertet; wahrscheinlich bildeten schon mehrere alte pagi Chattorum je die Mittelgruppe des einen und andern späteren Gaues, aber daß ein alter pagus so viel Land umfaßt hätte, wie jeder dieser beiden Gaue, ist nicht anzunehmen. (Die Chatten hatten viel mehr als zwei Gaue. D.) Tacitus selbst aber bezeichnet durch das in der Germania vorkommende Wort pagus unzweifelhaft nur den Gaubezirk.
Sowohl im Gebiete der zu einem größeren Bund vereinigten Völkerschaft als in dem Gaue und dem Cent fanden Versammlungen (concilia) statt, deren Cäsar und Tacitus oft gedenken: dieser Ausdruck bezieht sich unzweifelhaft auf alle Kategorien von Tingen.
Am seltensten natürlich haben Versammlungen der ganzen Völkerschaft, die man vielleicht als Bundestage bezeichnen könnte, für gewisse Gesamtangelegenheiten durch hierzu Abgeordnete stattgefunden, wobei aber auch jeder freie Mann erscheinen durfte.
Auf der Gauversammlung beruhte dasjenige, was wir die zentrale Staatsregierung nennen würden: Krieg und Frieden des Gaus, Entscheidungen der Streitigkeiten der Cente unter sich und Aburteilung der schwersten Verbrechen; vor die Centversammlung dagegen gehörte das nur ihren Bezirk Betreffende, wahrscheinlich auch Verlöbnis, Wehrhaftmachung und Eigentumsübertragung, die zwar auch in den Versammlungen der bloßen Ortsgemeinden geschehen konnten. Gewiß ist diese Kompetenz auch Gegenstand fortwährenden Wechsels gewesen, je nachdem sich die politische Entwicklung mehr zur Zentralisation hinneigte oder wie bei den Sachsen und Friesen mehr in der alten lockeren Verbindung verharrte.
Im Lateinischen wird übrigens bei Tacitus die oberste Einheit in politischer Beziehung als civitas (Völkerschaftsstaat), in geschlechtlicher als gens (Völkerschaft), bezeichnet. D.)
Also waren die Germanen am Schluß des ersten Jahrhunderts.
Nicht ohne Wichtigkeit für unsern Zweck ist die Verteilung des Gesamtgebiets unter die einzelnen Völker, mit Genauigkeit und Sicherheit aber die Aufgabe zu lösen teils an sich, teils deshalb unmöglich, weil die Sitze ursprünglich ohne Stetigkeit waren, deren Angabe daher immer nur für einen gewissen Zeitpunkt wichtig sein kann. In diesem Sinne ist der Versuch einer solchen in dem ersten Anhang und der Karte entworfen.